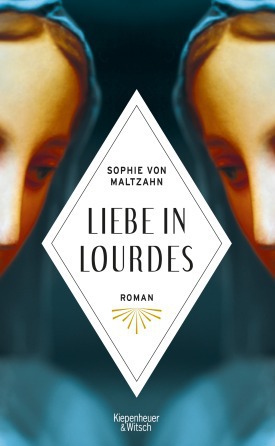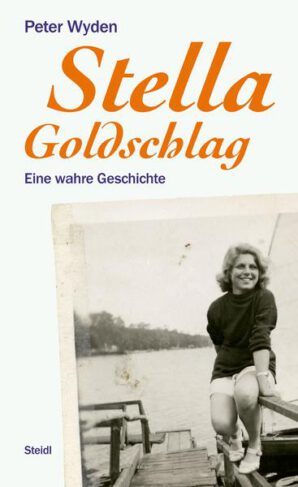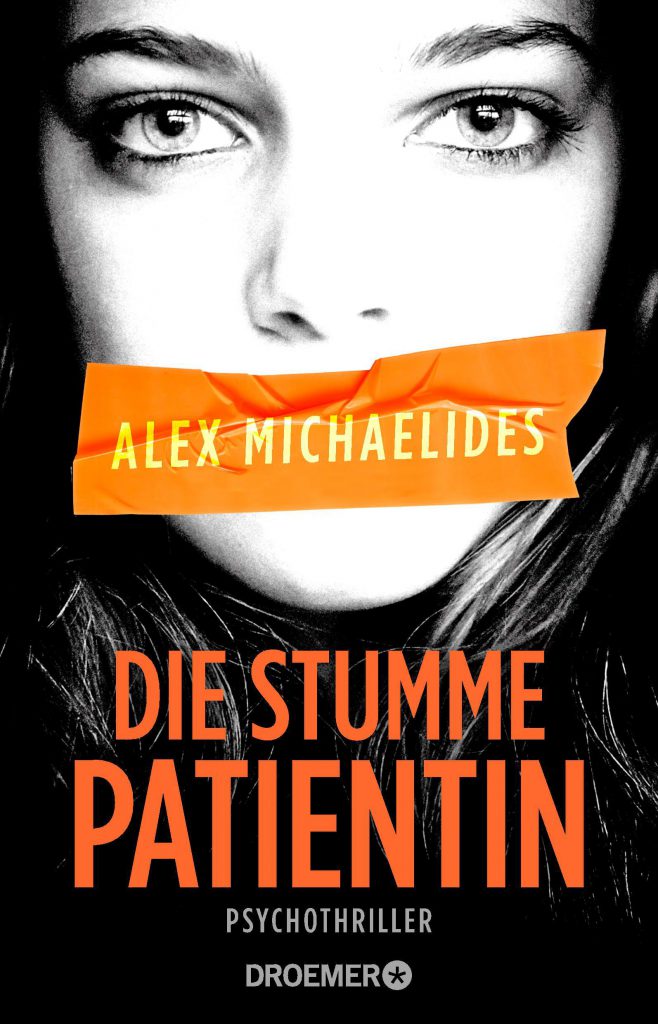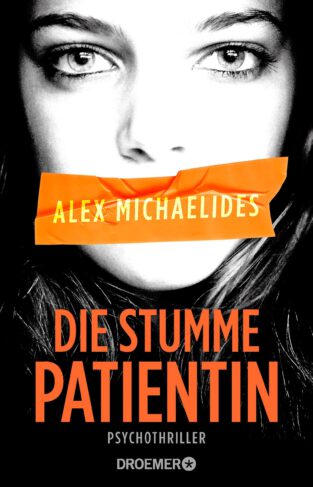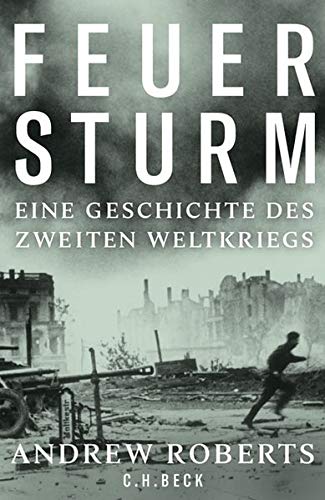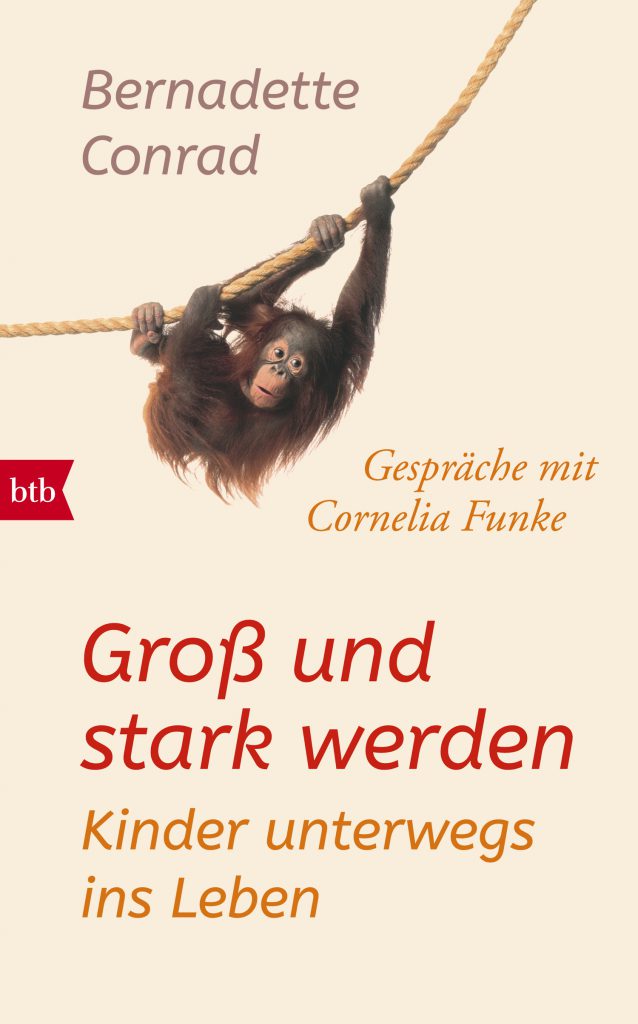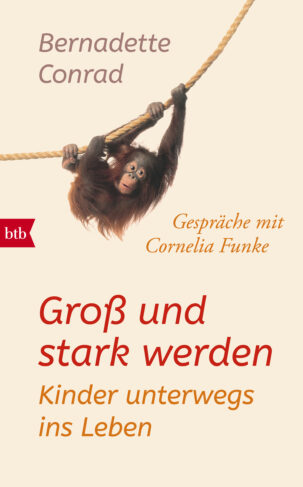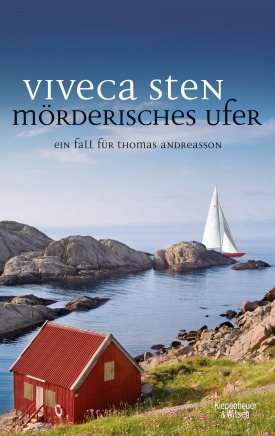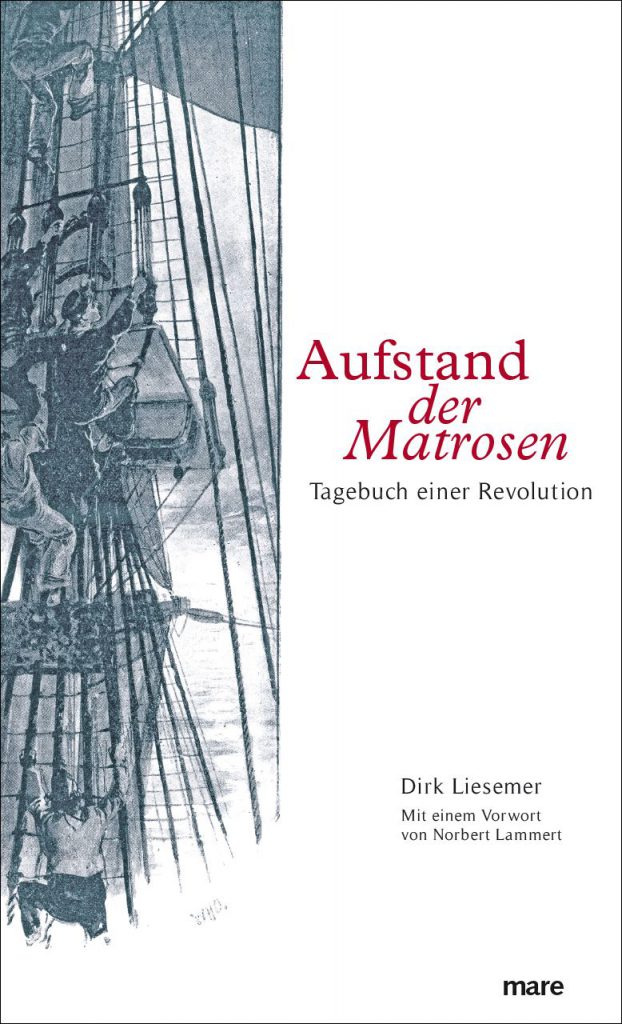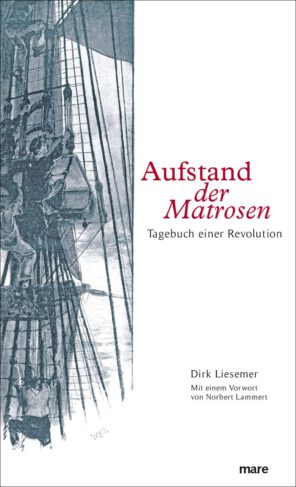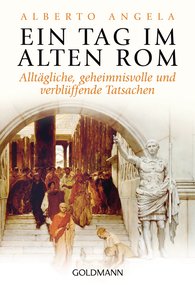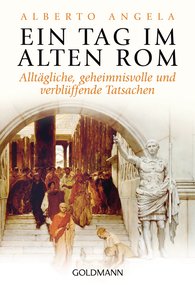Per Christian Jersild: Die Insel der Kinder
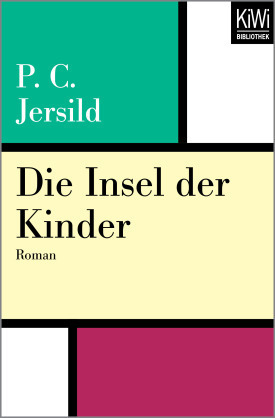
Inhalt:
Ein elfjähriger Junge. Hungrig, wach, weit offen für alle Eindrücke. Den schwedischen Sommer soll Reine Larsson eigentlich in einem Ferienlager für Kinder verbringen, doch er hat andere Pläne. Heimlich stielt er sich davon und versucht die großen Geheimnisse der Welt zu ergründen, die jedes Kind vor der Pubertät beunruhigen.
Mit Witz, Geschick und Charme versucht er sich in der Welt der Erwachsenen zu behaupten. Die Mutter bricht ahnungslos in den Urlaub auf und Reine unternimmt Streifzüge durch Stockholm und Umgebung. Reine betreibt Forschungen ganz eigener Art und findet dabei zu sich selbst. (eigene Inhaltsangabe)
Rezension:
Anfang der 1980er Jahre wurde ein schwedischer Gesellschafts- und Coming-of-age-Roman verfilmt, der aufgrund expliziter Szenen mittlerweile wohl Skandalpotenzial hat, was jedoch nicht darüber hinweg täuscht, dass diese Geschichte der wohl größte Erfolg des schwedischen Schriftstellers Per Christian Jersild ist.
Erzählt wird ein schwedischer Sommer aus den wacheen Augen eines Kindes, der ganz eigene Pläne hat. Anstatt sich von der Mutter ins Sommerferienlager schicken zu lassen, fingiert er seine Abreise nur, bleibt aber in Stockholm und nutzt die Tage, um seine Umgebung in sich aufzusaugen.
Der letzte Sommer der Kindheit, ihn will Reine in sich aufnehmen, immer mit der Angst von den allzu nahen Vorzeichen der Pubertät überollt zu werden. Es ist das liberale Schweden der 70er und 80er Jahre, welches hier feinfühlig dargestellt wird, ebenso wie die graue Vorstadtperspektive und die damit verbundenen Ängste aus den Augen eines Elfjährigen, der lieber Kind bleiben würde, als einer der verlogenen und undurchschaubaren Erwachsenen zu werden, die ihn umgeben.
Feinfühlig beschreibt der Autor aus der Perspektive von Reine, den man als Leser einfach liebgewinnen muss, wie sich dieser zwischen verworrenen zuständen zurechtfindet und sich auf mehr oder weniger besondere Erwachsene einstellen muss.
Dabei scheint einzig und alleine reine als unschuldige, aber bereits das Kommende ahnende, Figur, ausreichend ausgearbeitet zu sein, während die Erwachsenen allesamt Negative der reinen und unschuldigen Kindheit darstellen. Kaum jemand von dieser seite dient als Identifikationsfigur, so dass sich der Leser zwangsläufig an die einzig möglich Figur heften und ihr folgen muss.
Dies ist zu wenig, wenn auch die Beschreibungen der Athmosphäre flirrender Vororte sehr eindrücklich wirken. Zu wenig erfährt man von den anderen Protagonisten. Gerne hätten die Beobachtungen Reines noch ausschweifender erzählt und beschrieben werden können. So bleibt ein Roman im halbgaren Zustand.
Da macht der Film schon viel wett, jedoch würde dieser heute so auch nicht mehr gemacht werden können. So bleiben beide Medien in diesem Falle zeitdokumente, unausgereift und nur teilweise fassbar. Schade eigentlich.
Autor:
1935 geboren, ist Per Christian Jersild ein schwedischer Schriftsteller und Arzt gewesen, der von 1960 an verschiedene Romane veröffentlichte. Ab Mitte der 1980er Jahre war er als Kolumnist für verschiedene Zeitungen tätig. Seine Romane wurden mehrfach übersetzt und teilweise verfilmt. „Die Insel der Kinder“, ist sein größter Erfolg.
Per Christian Jersild: Die Insel der Kinder Weiterlesen »