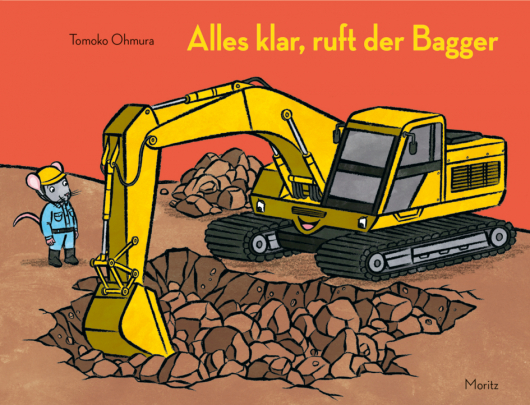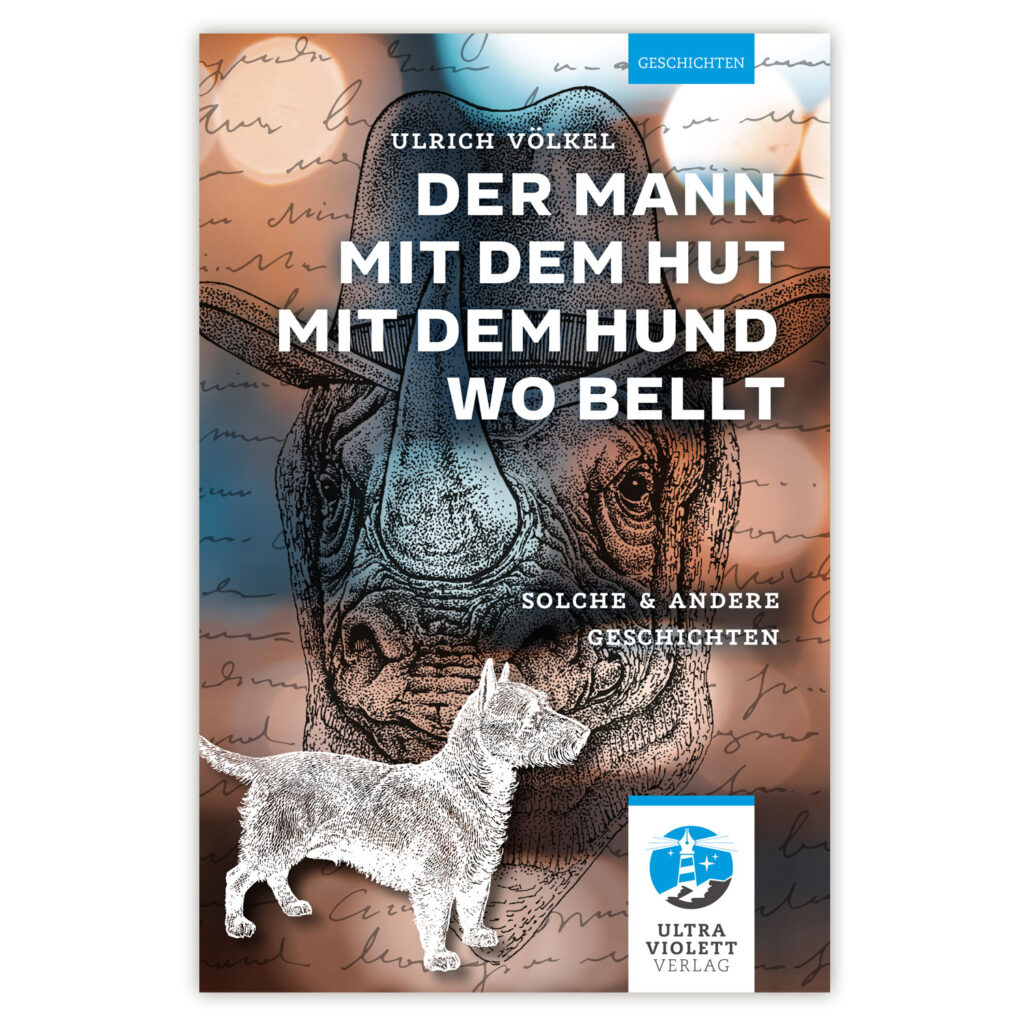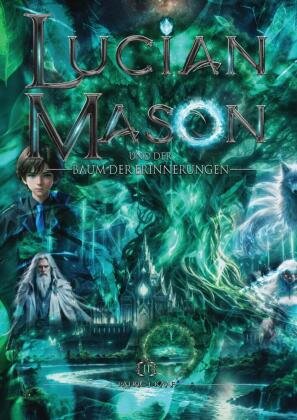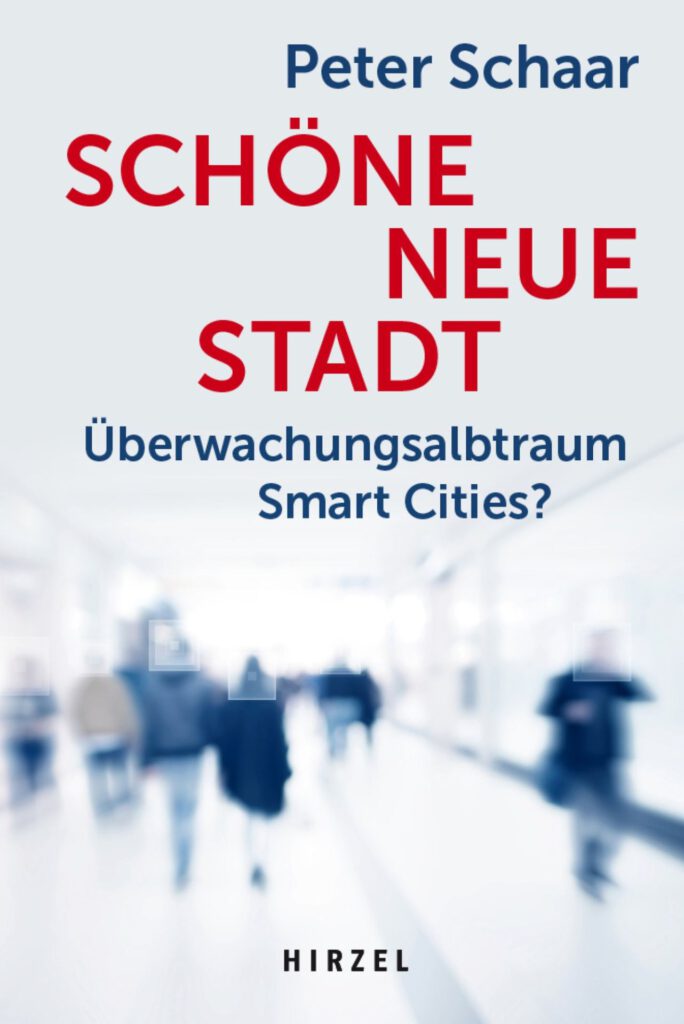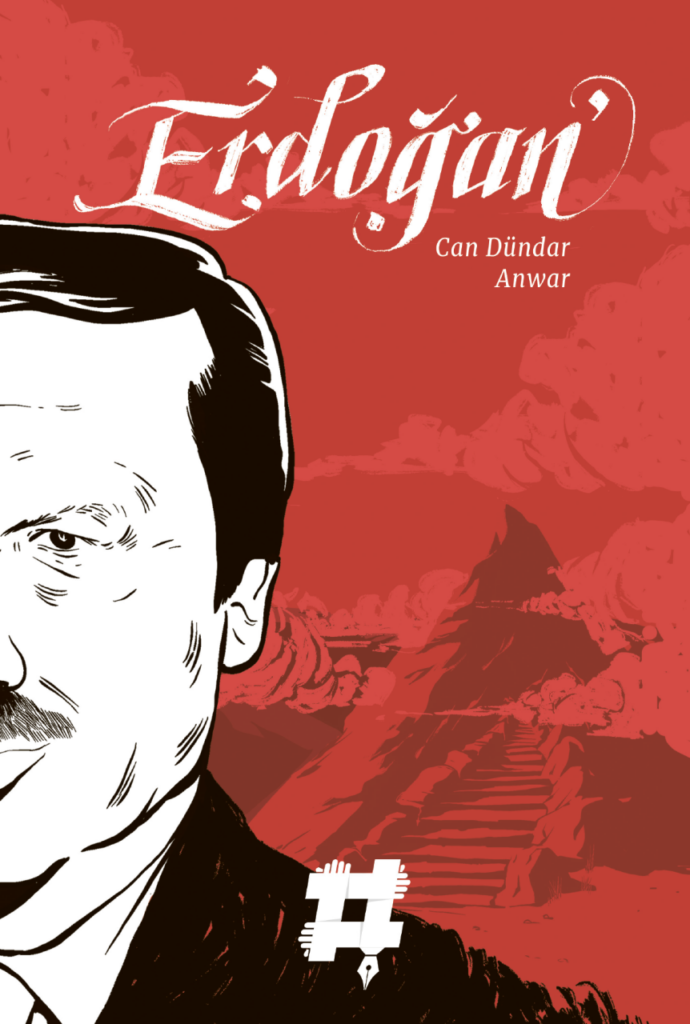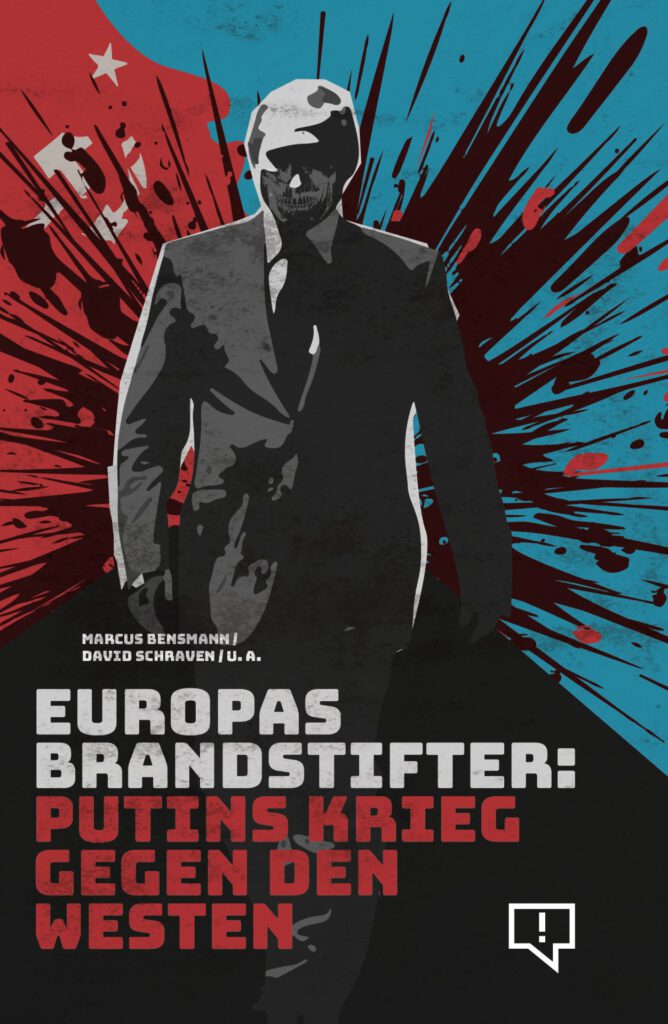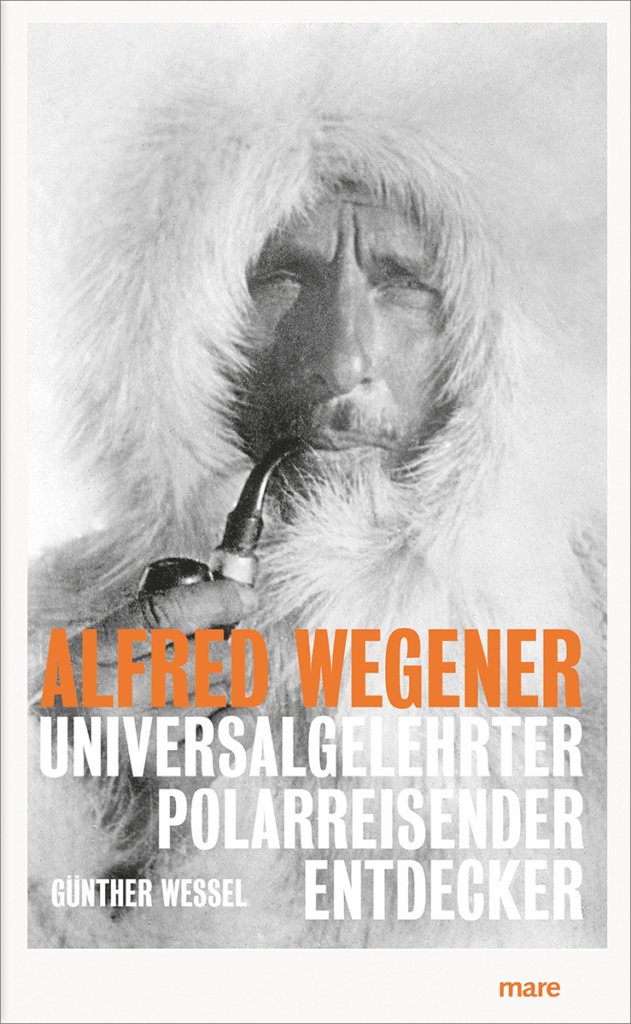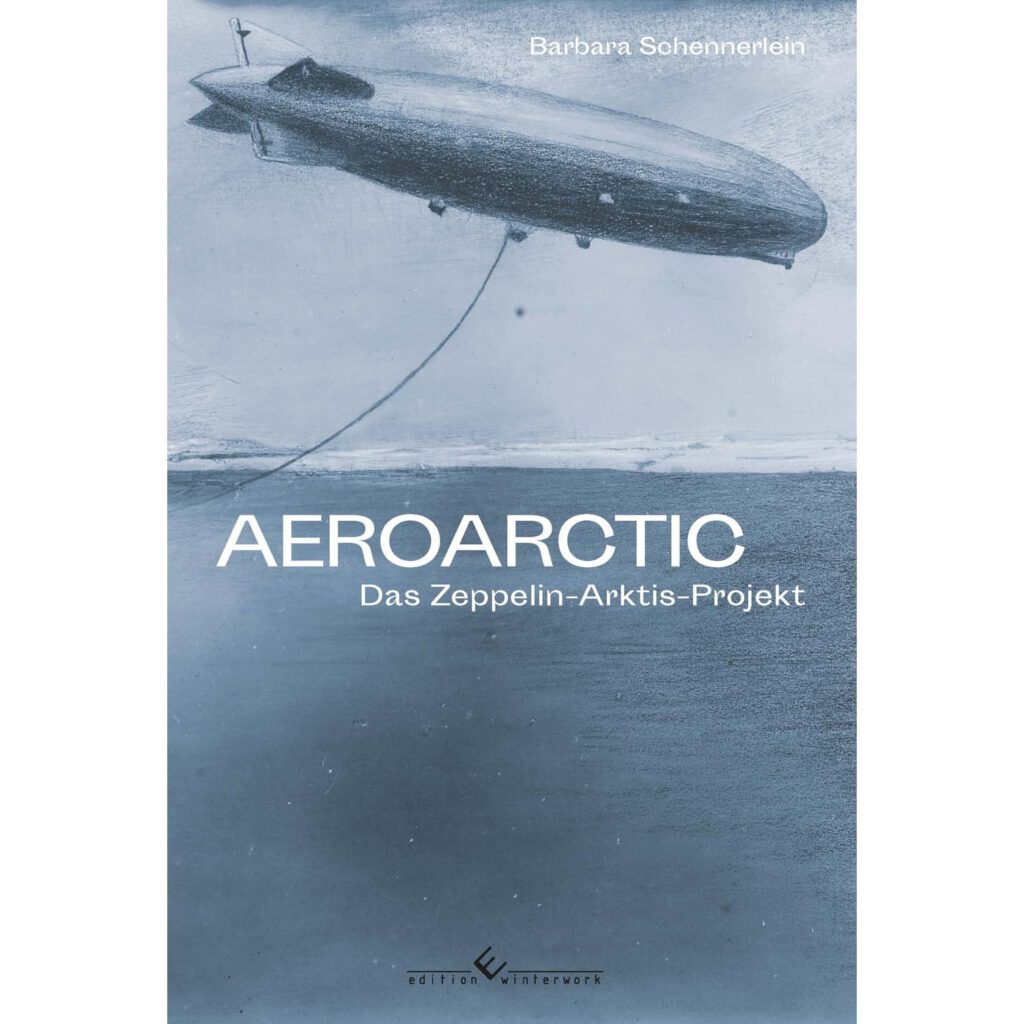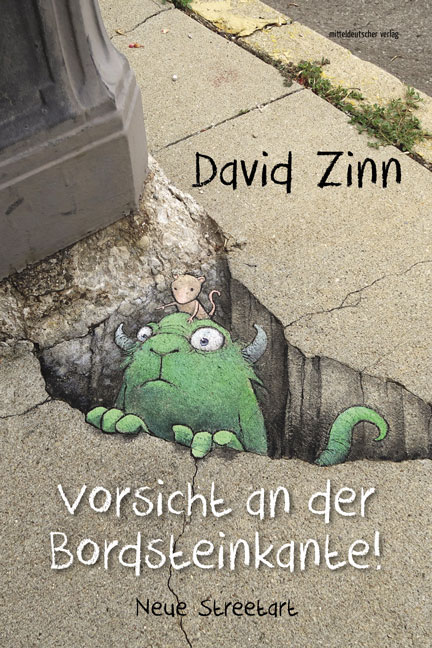Inhalt:
Lucian Mason kehrt nach Moridan zurück, doch diesmal ist alles anders. Nach seinem triumphalen Sieg über Sivenna erwartet Lucian ein ruhiges Schuljahr. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Zusammen mit seinen Freunden wird er mit Geisterproblemen, Lichtklingen, Monstern und Streit konfrontiert. Eine mysteriöse Katze und ein geheimnisvoller Wolf kreuzen seinen Weg und stellen ihn vor ungeahnte Herausforderungen. Als Lucian plötzlich an einem Ort landet, wo ein gewaltiger Baum auf ihn wartet, muss er erneut seinen Mut beweisen. Das Abenteuer, das vor ihm liegt, übersteigt alles, was er sich je vorstellen konnte.
Tauche ein in eine magische Welt und erlebe ein Abenteuer voller Magie, Geheimnisse und Mut.
Denn wir sind Moridan.
(Klappentext)
Rezension:
In der Tradition typischer Internatsliteratur mit magischen Einsprengseln entführt uns Patric J. Kaaf erneut in die magische Welt Lucian Masons ein, der nun nach einem turbulenten ersten sein zweites Schuljahr im magischen Moridan beginnen soll. Die Geschichte, die erneut Coming of Age und Jugendliteratur gekonnt in eine Urban Fantasy einbindet, zeigt, wie eine Fortsetzung gelingen und ein zweiter Band keineswegs immer der schlechtere einer Reihe sein kann.
Dabei treten zu Beginn wieder Akteure auf, die für den Verlauf der Erzählung eine Rolle spielen werden, ohne zu viel vorweg zu nehmen, gleichzeitig gelingt es dem Autoren Lesende in den Bann einer Handlung zu ziehen, die zugleich ihre dunklen Schatten vorauswirft, ohne die jenigen zu verlieren, deren magische Reise mit den Auftaktband schon eine ganze Weile her ist.
Eine zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse bekommt man praktisch innerhalb des Anfangs der Geschichte mitgeliefert, so dass ein schneller Wiedereinstieg gelingt und man sich voll und ganz den Charakteren, ihren Abenteuern und den Herausforderungen widmen kann, vor denen diese stehen.
Wieder im Vordergrund steht der titelgebende Hauptprotagonist, der auch hier empfindsamer und vielschichtiger sein darf, als auch wortwitziger auftreten darf, als dass eine gewisse Figur eines britischen Epos‘ sein darf, was eine Wohltat ist, ebenso wie die feine Zeichnung von Nebencharakteren, die noch mehr Raum bekommen, ebenso Herausforderungen zu bestreiten. Lucians größte, sich auf Ruhmeszuschreibungen einzulassen und auch Neid und Missgunst zu widerstehen, zugleich seinen Gerechtigkeitssinn zu Tage treten zu lassen, gelingt hier durch den gesamten Handlungsstrang hinweg, der mit zunehmender Seitenzahl ordentlich am Tempo zieht.
Nebst der Darstellung der Charaktere muss das Worldbuilding hervorgehoben werden, sowie das Magiesystem, welches eine ganz besondere Rolle in diesem Band bekommt. Der Herausforderung, eine Lichtklinge zu erlangen, mächtiges magisches Instrument dieser Welt, sind nicht alle Schülerinnen und Schüler gewachsen, aber auch Grundlage und Handlungstreiber für allerhand Abenteuer, in denen sich Lucian ohne es zu wollen, wiederfindet.
Hier nicht den Faden zu verlieren, ohne größere Logikfehler und unglaubwürdigen Wendungen, hat funktioniert. Auch merkt man deutlich, wie sich Schreib- und Erzählstil Patric J. Kaafs verbessert haben, trotzdem der Auftaktband und dieser als Fortsetzung natürlich nur zusammen funktionieren.
Die temporeich erzählten Kapitel fördern eine Lesegeschwindigkeit, durchsetzt mit zahlreichen Spannungsmomenten, auch Gegensätze funktionieren in diesem Setting gut. Trotz eingearbeiteten Lektorat stößt man hin und wieder aber auf Rechtschreibfehler, trotzdem meine ich auch hier eine Besserung im Gegensatz zum Erstling zu bemerken. So widmet man sich, wenn man denn stolpert, schnell wieder den Kampf zwischen Gut und Böse, Lüge und Wahrheit und Lucians Willen, auch mehr über sich selbst herauszufinden und zu bestehen.
Auch spürt man das Brodeln unter der Oberfläche, wobei die Herausarbeitung des Temperaments vom besten Freund der Hauptfigur mal witzig, mal erschütternd ist zu verfolgen, jedoch immer gelungen. Man fiebert mit. Man leidet mit. Auch ist man mal wütend. Das schafft eine teilweise sehr filmische Beschreibung. Lucian Mason als Miniserie wäre hier sehr gut vorstellbar.
Zeitebenen und Perspektiven wechseln, rahmen vor allem die Geschichte ein, um sich dann und wann zu berühren und am Ende teilweise zu verschwimmen. Wenn man junge Jugendliche als Zielgruppe ansetzt, könnte das durchaus eine Herausforderung beim Lesen bedeuten, auch ist die stetige unterschwellige Bedrohung und Düsternis ein Markenzeichen des Bandes, der mit seinen Beschreibungen von Auseinandersetzungen an japanische Kampfszenen erinnert. Auch das ist ein Element, welches selten so gelungen beschrieben wird.
In diesem Zusammenspiel funktioniert diese Fortsetzung des Auftaktbandes noch besser, da insgesamt rasanter aber auch harmonischer wirkend. Gerne bleibt man dran, um mehr über Lucian und die magische Welt zu erfahren, der behutsam neue Elemente hinzugefügt werden, deren Ausgestaltung Patric J. Kaaf im Verlauf der Reihe noch weiter forcieren wird. Einige Nebenfiguren, auch neue, bekommen so mehr Raum, auch gelingt es dem Autor sich in den passenden Momenten zurückzunehmen und diese in den Vordergrund treten zu lassen.
Habe ich für den Auftaktband noch wohlwollende vier Sterne gegeben, hält diese Bewertung nun auch unter Zuhilfenahme strengerer Gesichtspunkte stand. Dass ich praktisch eine Version mit Anmerkungen des Lektorats erhalten habe, dürfte der Aufregung einerseits, andererseits meinem Kaufverhalten geschuldet sein. In einer späteren Version sind sie nicht mehr anzutreffen.
Die Reihe lohnt sich folglich, sie weiter zu verfolgen, zudem gerade aus dem deutsprachigen Raum ich wenig vergleichbares gefunden habe. Auch wer bestimmte Urban-Fantasy-Elemente in Verbindung mit einer Coming of Age Geschichte sucht, wird hier fündig werden. Abenteuersuchende ohnehin. Denn, wir alle sind Moridan.
Autor:
Schon immer von Games und Filmen fasziniert, wollte Patrick J. Kaaf in diese Branche Fuß fassen. Als dies nicht funktionierte, begann er auf Anregung hin, seine Ideen aufzuschreiben. So entstand u. a. sein Roman „Lucian Mason und der Splitter des Schicksals“, der den Auftakt einer neuen Fantasy-Reihe bildet.
Der virtuelle Spendenhut
Dir hat der Beitrag gefallen? Dann freue ich mich über eine virtuelle Spende. Vielen lieben Dank.
Folgt mir auf folgenden Plattformen: