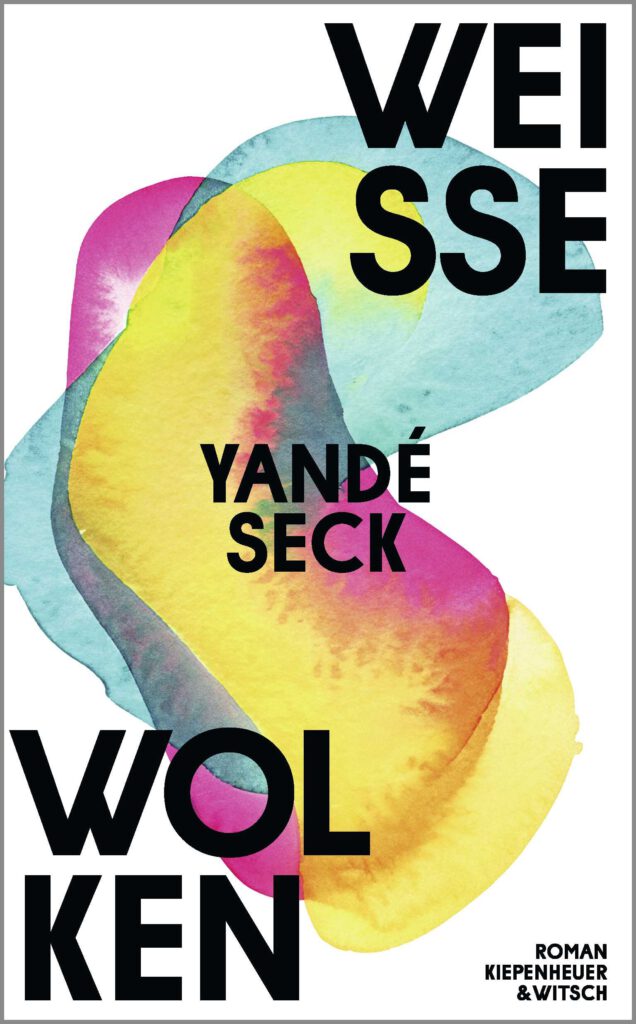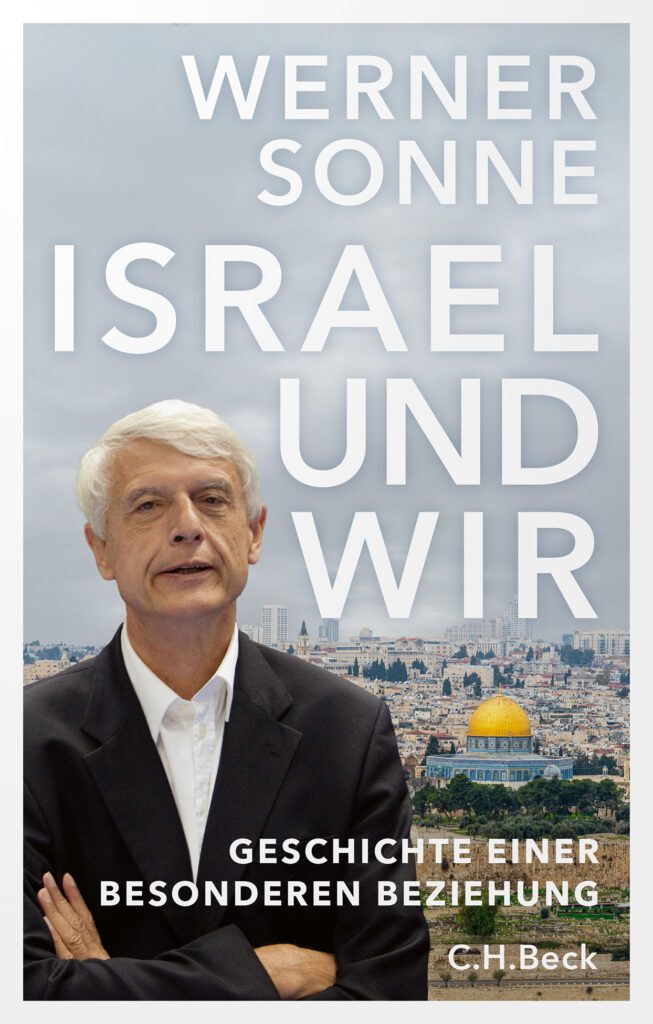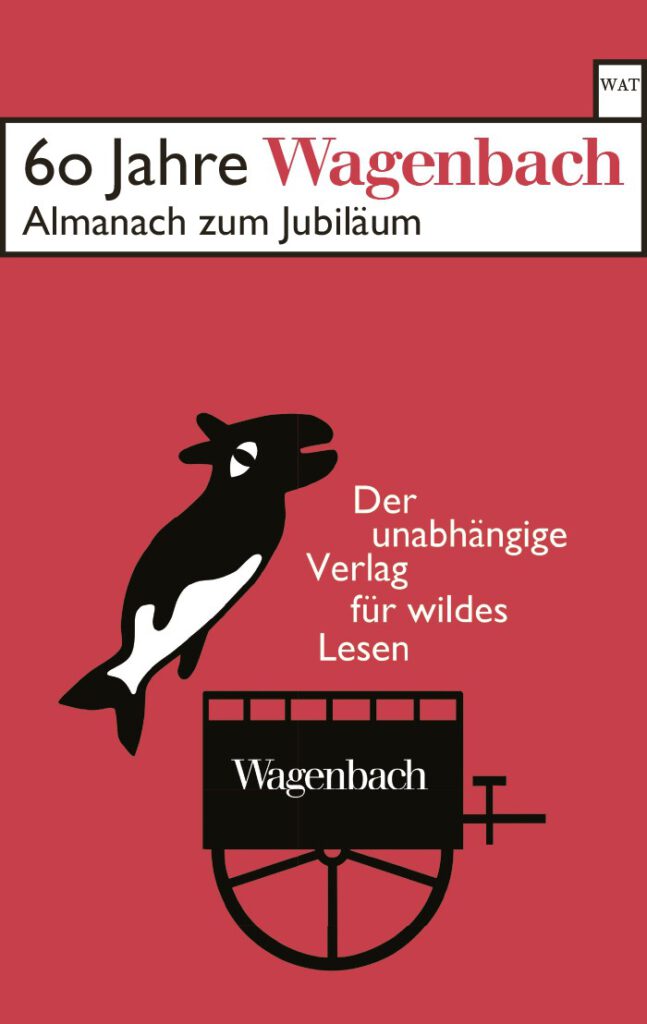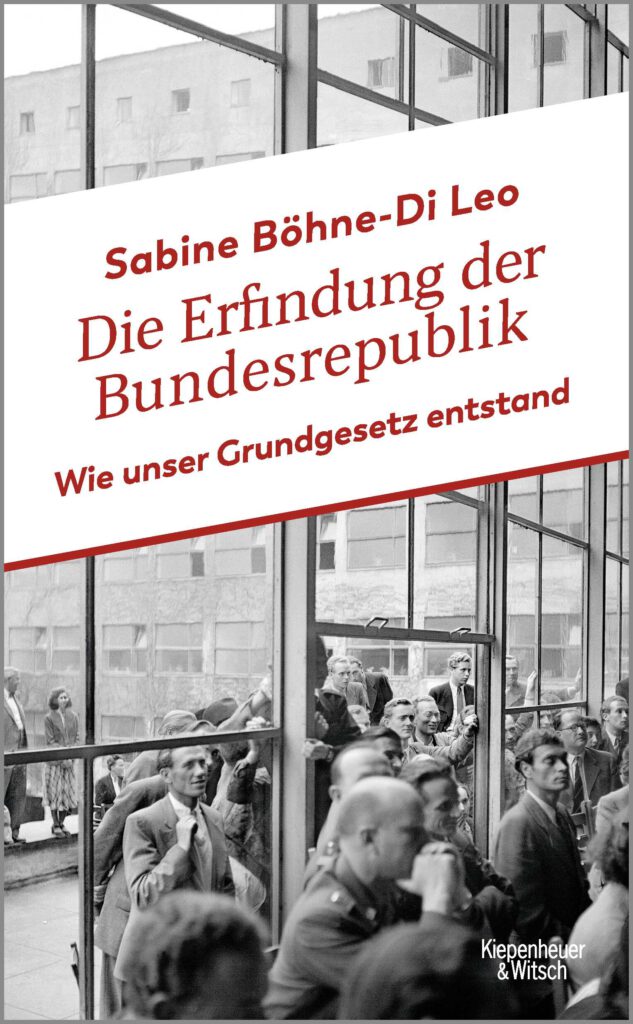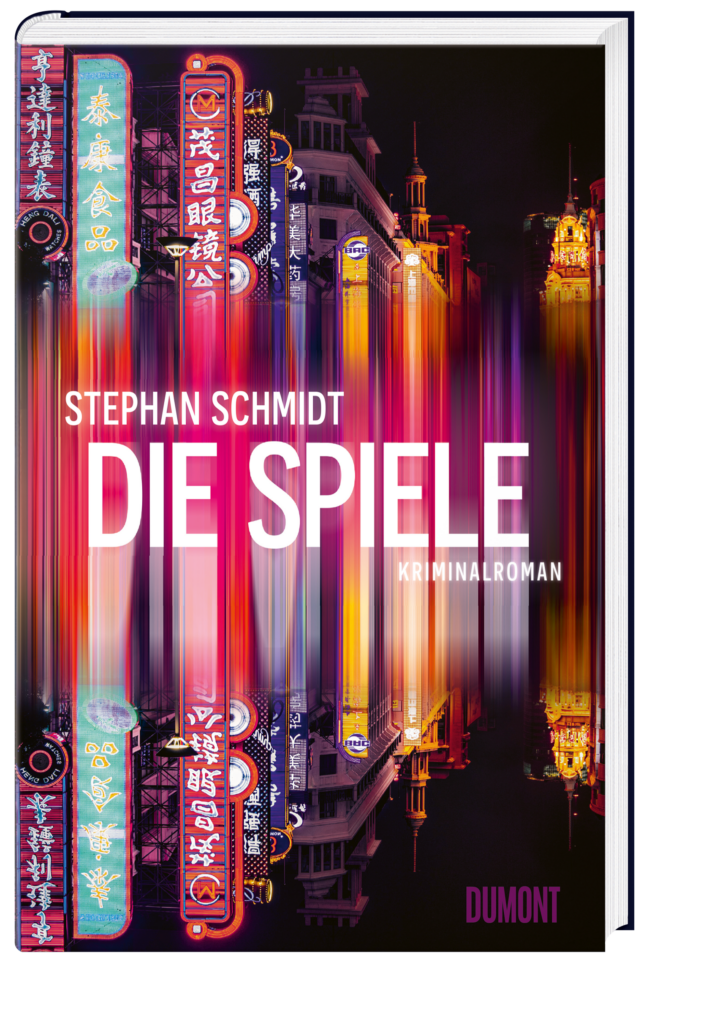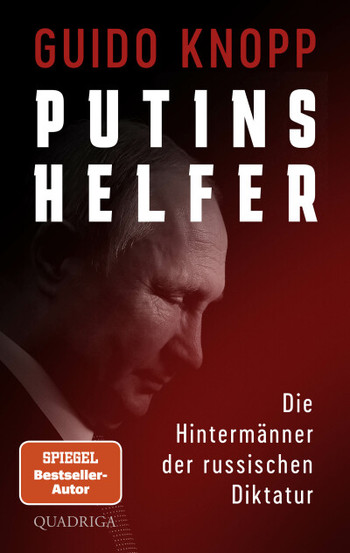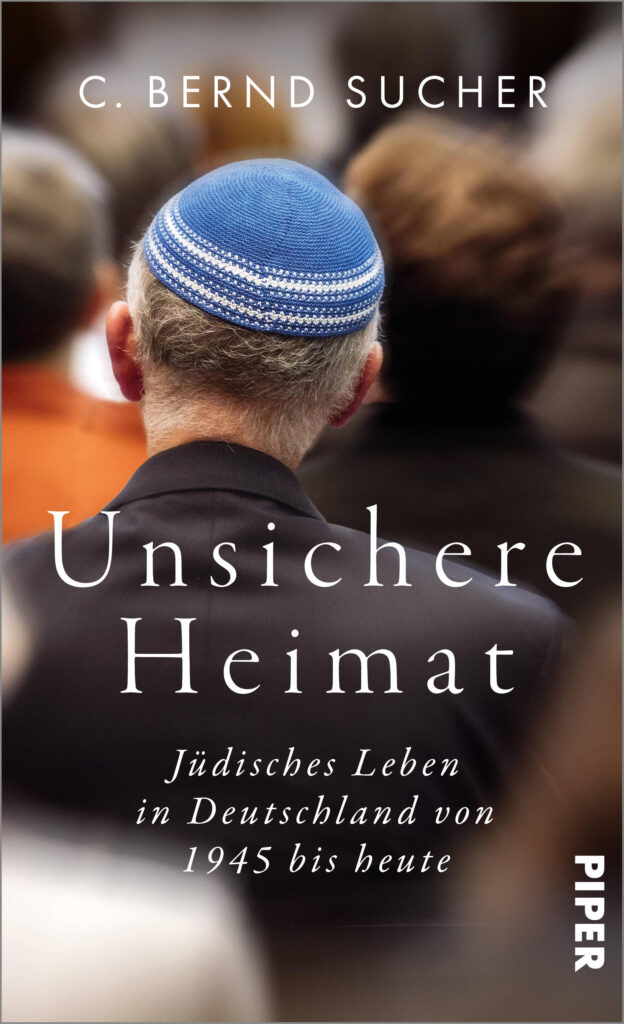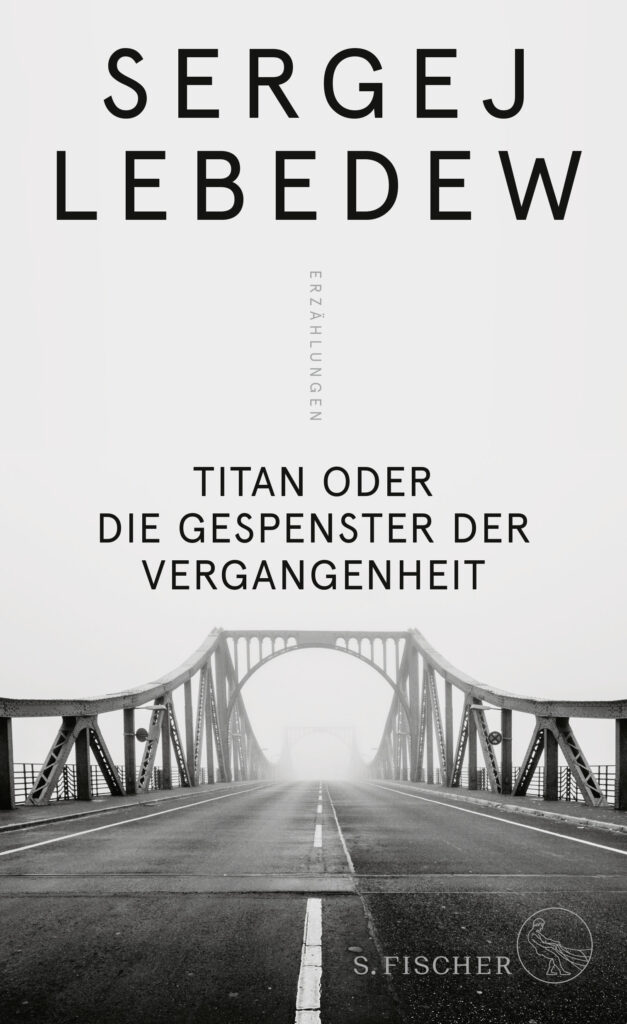Wolfgang Kraushaar: Israel

Inhalt:
Als die Hamas am 7. Oktober 2023 über 1.100 Israelis ermordete, schien auf einen Schlag der von den Nazis verübte eliminatorische Antisemitismus zurückgekehrt zu sein. Premierminister Netanyahus Versuch, den Aggressor umgehend auszuschalten, führte jedoch im Gaza-Streifen zu einer humanitären Katastrophe. Die Bilder, die seitdem um die Welt gehen, haben zu einem Aufflammen des Antisemitismus und zu Debatten geführt, die von einer Begriffsverwirrung erheblichen Ausmaßes gekennzeichnet sind.
Wolfgang Kraushaar ordnet die unterschiedlichen Diskurse, trennt die antisemitschen Stereotype von triftigen Argumenten und stellt die unverzichtbaren zivilisatorischen Minimalforderungen heraus, nicht ohne den Umgang mit den Problem- und Grenzfällen zu präzisieren. (Klappentext)
Rezension:
Einen Tag nach Beginn des Jom-Kippur-Krieges fünfzig Jahre zuvor, am jüdischen Feiertag Simchat Tora brachen zunächst Unmengen von Raketen über die Mitte und den Süden Israels herein. Damit wurde der seit 2014 zwar fragile, aber bestehende Waffenstillstand gebrochen, doch war dieser Angriff nur Ablenkung für das, was folgen sollte. Kämpfer der Hamas durchbrachen die Grenzanlagen und forderten über 1.100 Todesopfer, 3.000 Verletzte. Unzählige Menschen wurden in den Gaza-Streifen verschleppt. An keinem Tag seit dem Holocaust zuvor sind so viele Jüdinnen und Juden getötet worden, wie am 7. Oktober 2023.
Das ganze Ausmaß der Bestialität wurde erst nach und nach deutlich. Je detaillierter die Informationen ausfielten, desto massiver wurden die Schockwellen. Zugleich suchte man nach Worten, einen Begriff für diese Barbarei. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar ordnet darauf Begrifflichkeiten ein, beleuchtet die Phrasen und Narrative einer kaum zu durchdringenden Diskussion und zeigt die Meta-Diskurse auf.
Zunächst beginnt der Autor beim jüngsten aller Konflikte und zeigt auf, was eigentlich am 7. Oktober geschehen ist und wie es überhaupt zu den dann stattfindenden Ereignissen kam. Er erläutert die Vorbereitungen der Hamas, aber auch die Reaktionen Israels in sehr kompakter Form, bevor er zunächst geografische Begrifflichkeiten einordnet, beginnend mit von der deutschen Politik beschworenen Solidarität mit dem jüdischen Staat. Was heißt dies überhaupt und können diese Worte überhaupt mit einer sinnvollen Bedeutung gefüllt werden oder ist dies letztendlich eine hohle Phrase ohne Wert, nur aus Pflichtbewusstsein?
Danach wird die politische Geografie aufgedröselt und zugleich auf die Geschichte der Region eingegangen. Was sind Israel und der Zionismus überhaupt? Wie sind Politiker, wie etwa ein Netnyahu einzuordnen, um dann widerum den Bogen zu Deutschland als Partner des Landes zu spannen. Auch wird die Gemengenlage im Gaza-Streifen erläutert, sowie im Westjordanland, ohne zu vergessen, dass wenn wir Israel betrachten, auch geklärt werden muss, was eigentlich Palästina in den unterschiedlichen Ansichten als geografischer Raum bedeutet und wie der Stelllenwert der Hamas ist. Auch wieder im Gegenlicht zu den Akteuren der Politik Israels.
So geht es weiter in der Lektüre, die zu weilen sehr theoretisch daherkommt, aber gerade bei dieser sensiblen Thematik sehr viel Wert darauf legt, Begrifflichkeiten korrekt einzuordnen. Dabei erklärt Kraushaar die verschiedenen Interpretationen und stellt sie einander gegenüber. Nur so entsteht ein klares Bild, für welches man jedoch durchgehend Konzentration benötigt, dieses in sich aufzunehmen. Einerseits politiktheoretisch, andererseits fast philosophisch wirkt diese Einordnung, die versucht, einem Konflikt sprachlich Herr zu werden. Zuweilen sehr distanziert scheint das, nicht jedoch vollends ohne Emotion zu sein.
Der Autor zeigt die Wendepunkte der Geschichte der Region als Verkettung. Unweigerlich kommt die Frage auf, was als nächstes passieren muss, was als nächstes passieren wird. Lehrreich ist das Sachbuch vor allem mit den letzten Kapiteln, in dem Parolen erläutert werden, die zu weilen auf Demonstrationen zu hören sind und wenn Meta-Diskurse kurz zusammenfassend dargestellt werden.
Man geht mit einer Fülle an Informationen und Wissen aus der Lektüre heraus, muss sich jedoch bis dahin sehr konzentrieren und zuweilen wiederholend lesen. Leicht zugänglich ist etwas anderes. Positiv anzumerken ist jedoch, dass Kraushaar nicht vergisst, anhand zusammengestellter Punkte zu erläutern, was im Endeffekt für die Auflösung eines Konflikts in der Region seines Erachtens erfolgen müsste. Ob das dann so funktioniert, steht jedoch in den Sternen.
Autor:
Wolfgang Kraushaar wurde 1948 geboren und ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Von 1987 bis 2014 arbeitete er am Hamburger Institut für Sozialforschung, seit dem bis zum 2023 für die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Seine Forschungsschwerpunkte sind Protestbewegungen und der linke Terrorismus. Er ist Autor verschiedener Werke zu diesen Thematiken.
Wolfgang Kraushaar: Israel Weiterlesen »