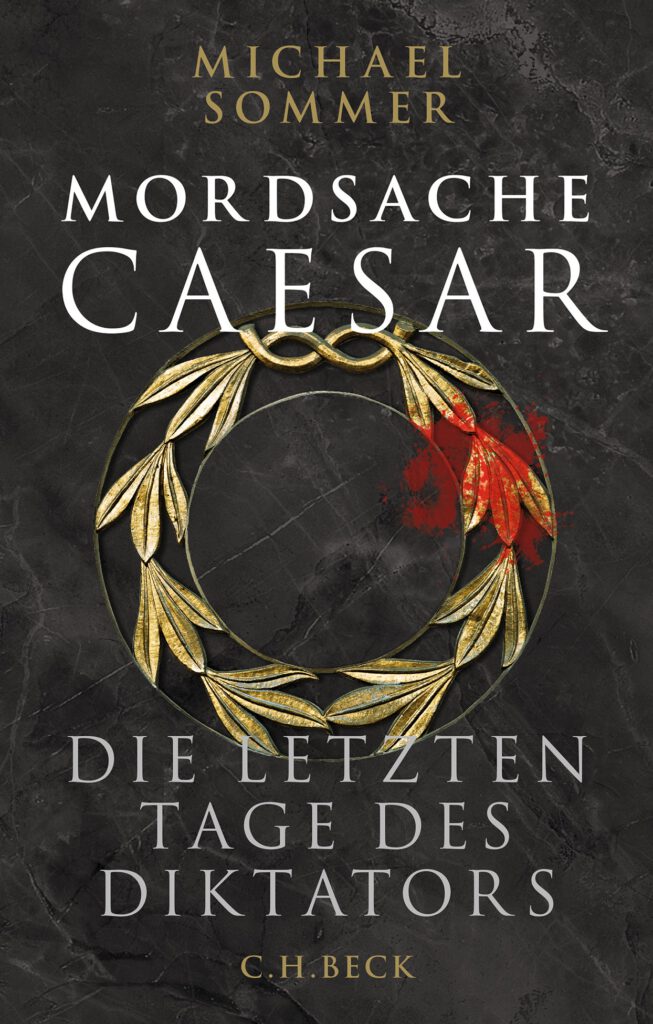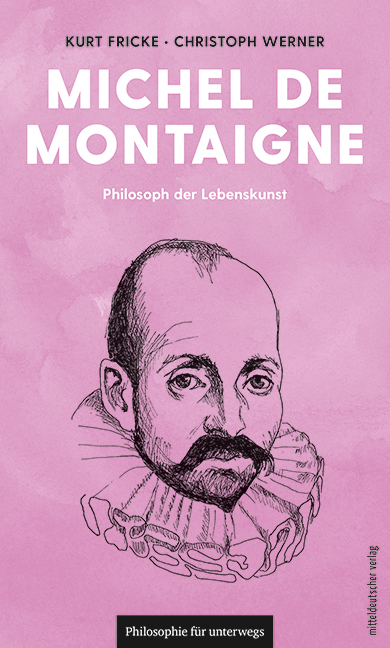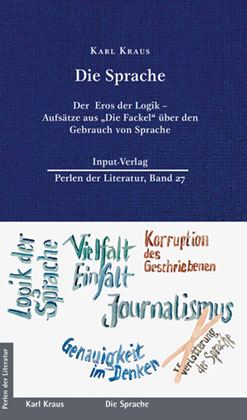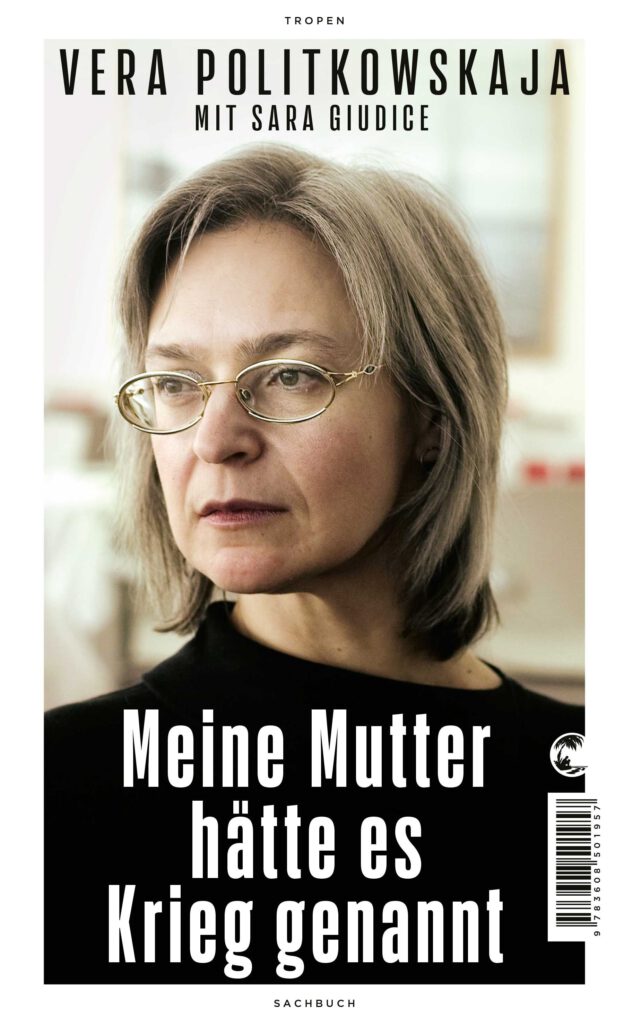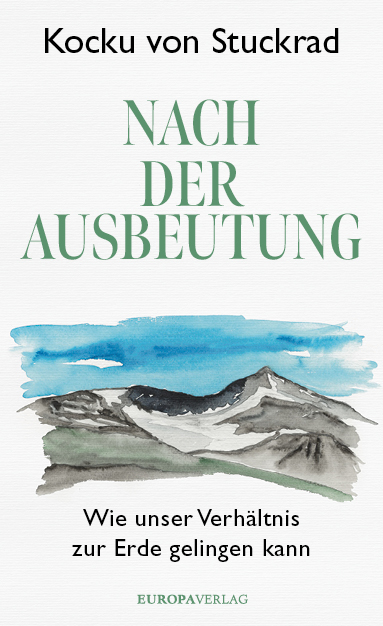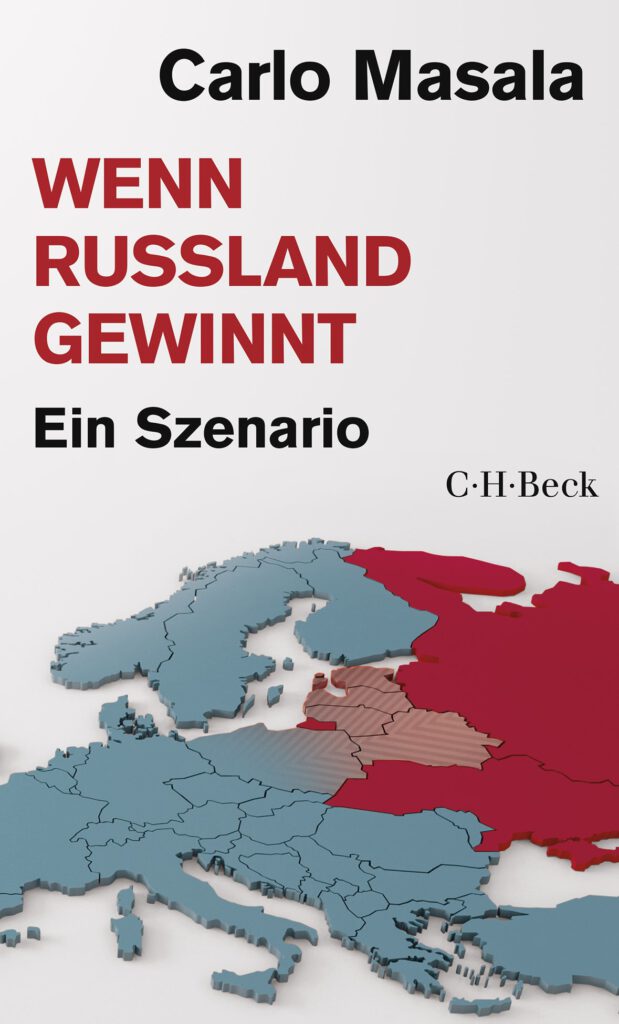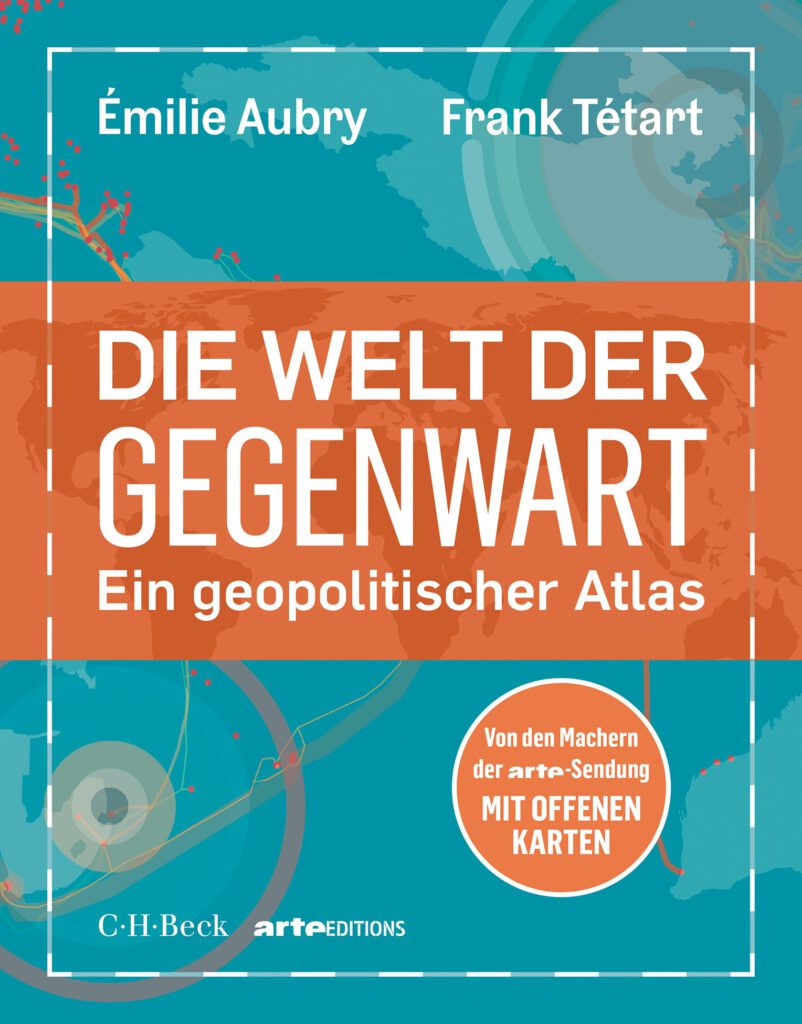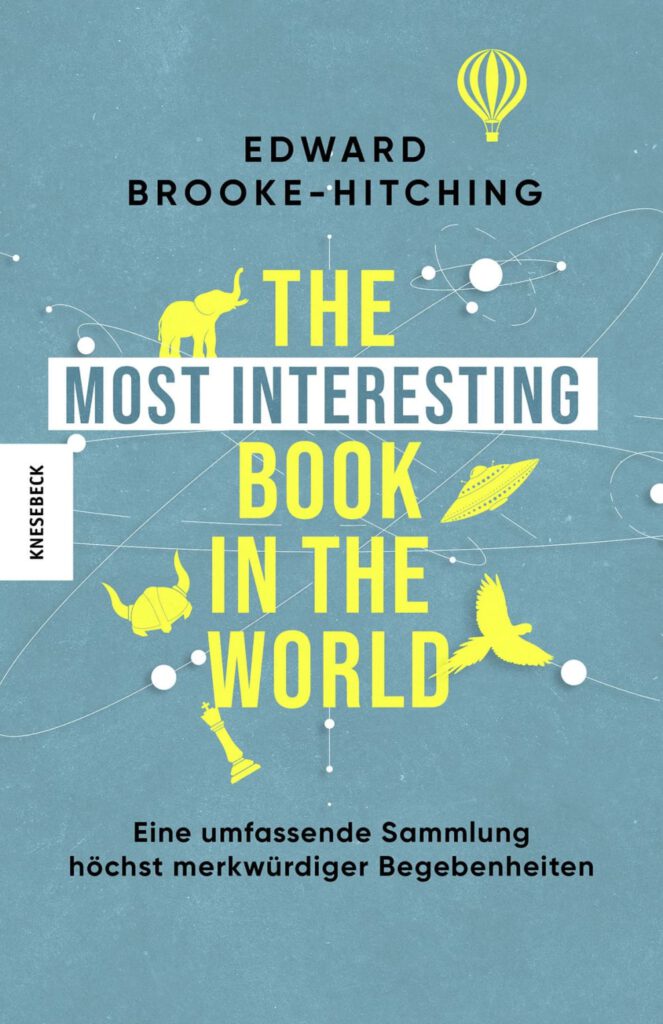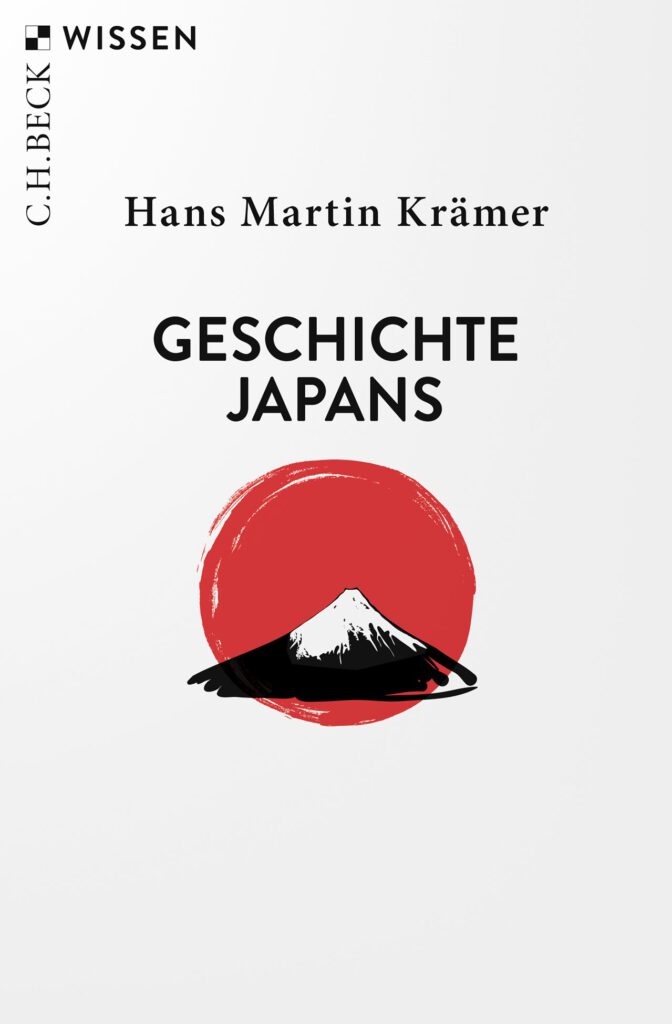Johann-Günther König: Anschluss verpasst!
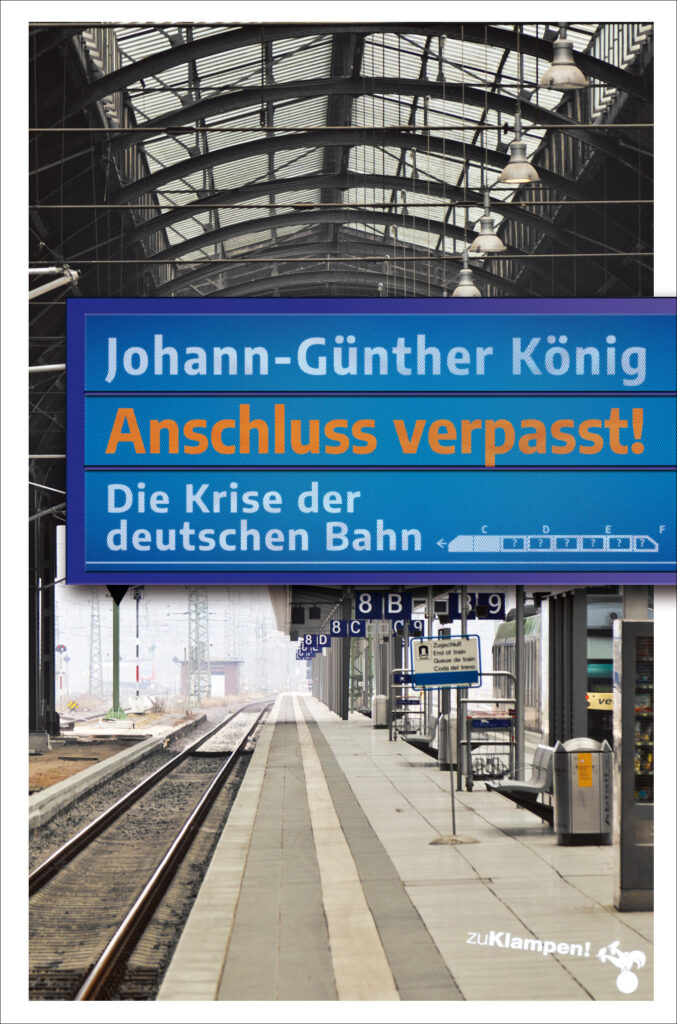
Inhalt:
„Wir bitten um Entschuldigung.“
Diese Durchsage bekommen Bahnreisende heutzutage viel zu oft zu hören. Verspätungen und Zugausfälle prägen mittlerweile das Alltagsgeschäft. Zuverlässigkeit ist längst kein Qualitätsmerkmal der Deutschen Bahn mehr. Die Gründe dafür sind vielfältig. Bislang hat stets der Straßen- und Luftverkehr verkehrspolitische Vorfahrt genossen. Nun ist es aber allerhöchste Eisenbahn, dem klimaschonenden Schienenverkehr oberste Priorität einzuräumen.
Doch wie ist es überhaupt zu dem Niedergang gekommen? Sind die Weichen mit den Gleissanierungen richtig gestellt? Führt der verordnete Wettbewerb die Bahn wirklich in die Zukunft?
Johann-Günther König beleuchtet Zusammenhänge und Hintergründe des akuten Desasters und welche Potenziale in der Deutschen Bahn schlummern. (Klappentext)
Rezension:
Ob im Nah- oder Fernverkehr, immer öfter liegen die Nerven blank. Fahrgäste, die vergeblich auf Züge warten oder durch sich aufsummierende Verspätungen Termine verpassen, in Züge ein steigen, die ebenso lawede sind wie die Bahnhöfe, die sie verlassen, sich mit immer kostenspieligeren Bauexperimenten konfrontiert sehen oder mit Streiks, den die mittlerweile auch entnervten Angestellten gegen das Management führen, welches selbst kaum Herr über schier undurchsichtige Unternehemsverflechtungen zu sein scheint. Dabei ist die Bahn eigentlich das Verkehrsmittel der Stunde und scheint in anderen Ländern durchaus zu funktionieren, auch wenn es hier und da Herausforderungen zu meistern gibt.
Der Autor Johann-Günther König hat sich auf Spurensuche zwischen den Bahngleisen begeben. Dabei entstanden ist ein informatives und gut recherchiertes Sachbuch, welches die Krise der Deutschen Bahn beleuchtet und zeigt, warum Aufgeben keine Option ist.
Jenseits von Satire- und Aufregerbüchern liegt mit „Anschluss verpasst!“ ein faktenreiches Sachbuch vor, welches die Geschichte und die Anfänge dessen, was wir heute als Krise eines großen Mischkonzerns betrachten dürfen, beleuchtet, der nicht nur den Spagat zwischen Nah- und Fernverkehr immer mehr schlecht als recht zu leisten versucht, sondern auch im Auslands- oder Logistikgeschäft mit seinen zahlreichen Verflechtungen stets die falschen Weichen zu stellen scheint, wenn die denn einmal funktionieren.
Sehr analytisch beleuchtet der Autor die Auswirkungen vergangener Bahnreformen und zeigt auf, welche Anteile daran, Akteure wie die Europäische Union, die Aufeinanderreihung verschiedener Verkehrsminister und eine Konzernstruktur hat, die, selbst wenn man ernsthaft Probleme angehen wollte, keine wirkliche Lösung zulässt. In kompakt gehaltenen Kapiteln werden Aspekte wie Bauprojekte oder der Deutschlandtakt analysiert, und die Schwachstellen aufgezeigt, die nicht nur die Passagiere mittlerweile auf den Zahnfleisch gehen lassen.
Ohne Polemik werden Fakten und Selbstdarstellungen der Bahn so genau unter die Lupe genommen, dass Kapitel, die sich eigentlich bequem für eine Bahnfahrt eignen, langsam und konzentriert zu Gemüte geführt werden müssen, aber auch, welche Punkte umgesetzt werden müssten, um die Bahn wieder auf die richtige Spur zu bringen.
Kenntnisreich ohne überflüssige Worte zeigt Johann-Günther König die Vielschichtigkeit dessen auf, an welchen Ecken und Enden es an Willen, Geld und Weitsicht fehlt und bei wem genau die Verantwortlichkeiten zu suchen sind, denn inzwischen sind einfach zu viele Akteure daran beteiligt. Nicht immer ist dies einfach zu lesen, doch macht die Lektüre vieles von dem verständlicher, was da passiert. Und diesen Schritt mitzufahren, ist ja schon einmal ein Anfang.
Autor:
Johann-Günther König wurde 1952 in Bremen geboren und ist ein deutscher Schriftsteller und Publizist. Nach der Schule studierte er Sozialpädagogik und arbeitete in der Kinderkulturforschung, währenddessen zugleich seine ersten literarischen Arbeiten erschienenn. Nach seiner Promotion wirkte er dann als Vertriebsmanagaer und Geschäftsführer für Unternehmen der Telekommunikation und Elektronik. Seit 1975 veröffentlicht er Prosa, Gedichte, literarische Reiseführer und Sachbücher, schreibt für verschiedene Zeitungen und Magazine.
Folgt mir auf folgenden Plattformen:
Johann-Günther König: Anschluss verpasst! Weiterlesen »