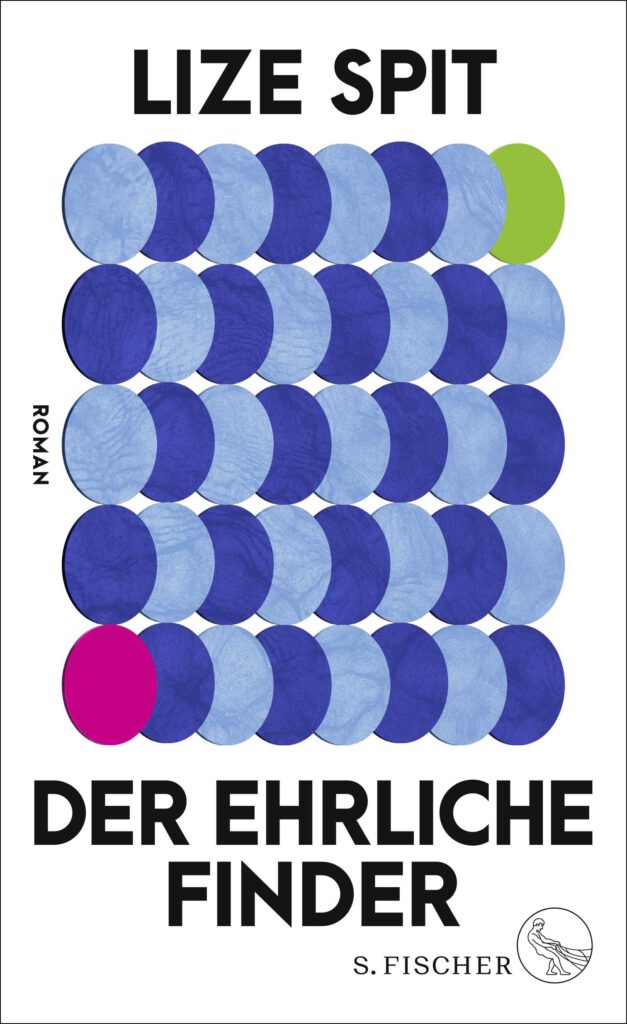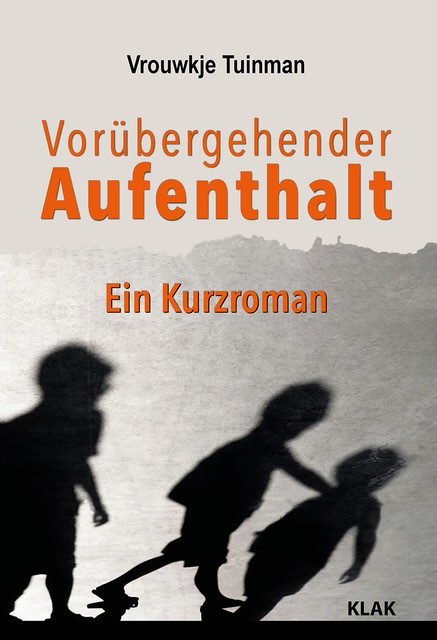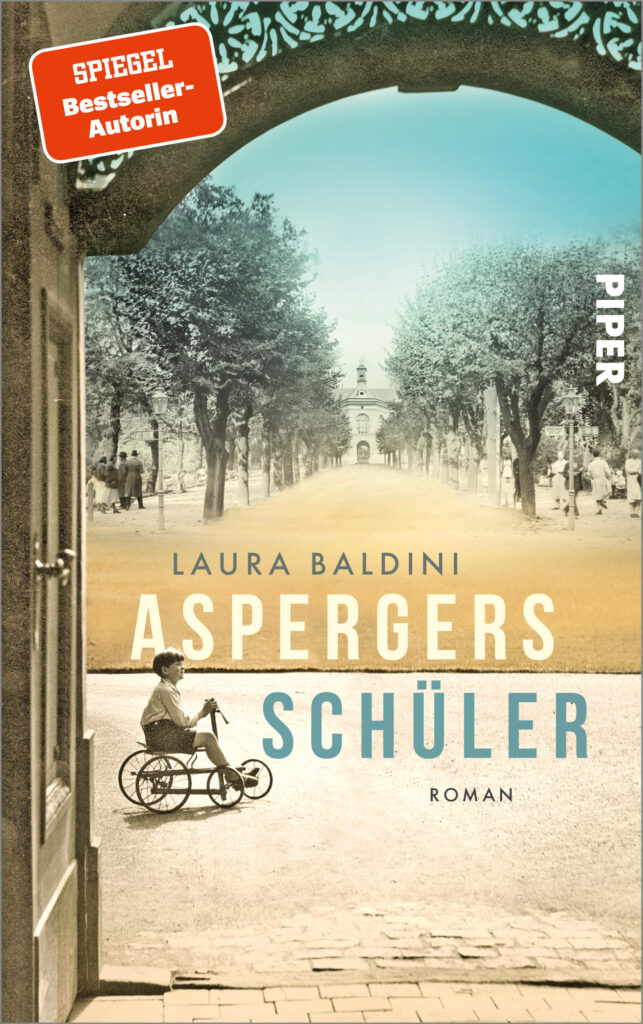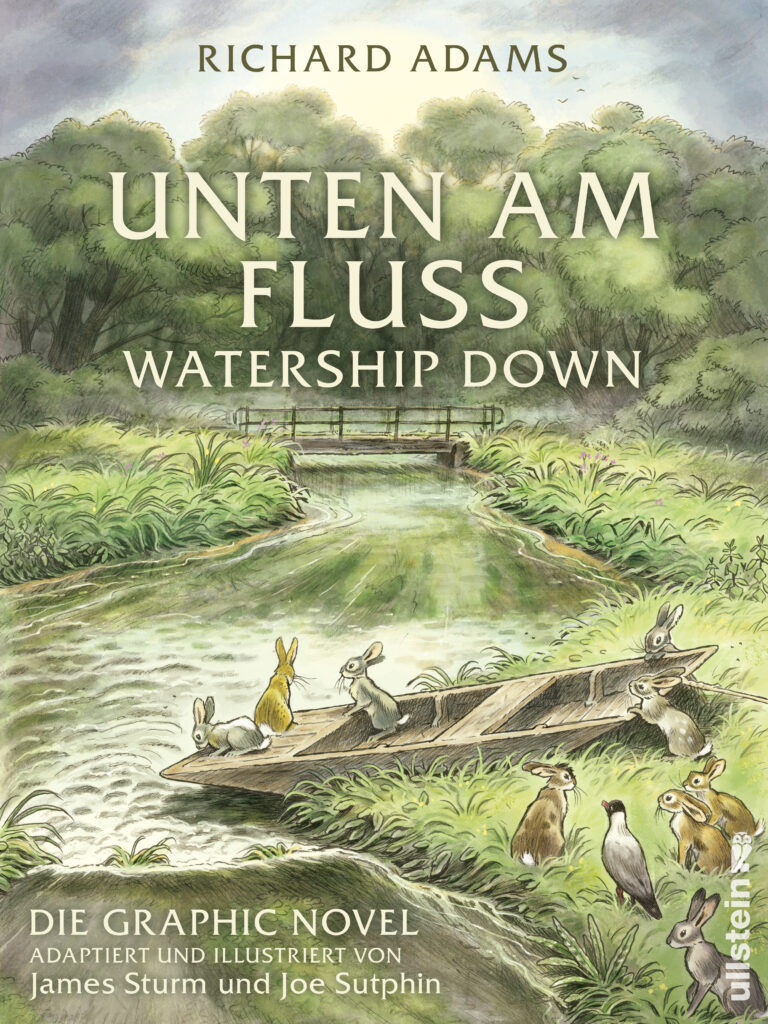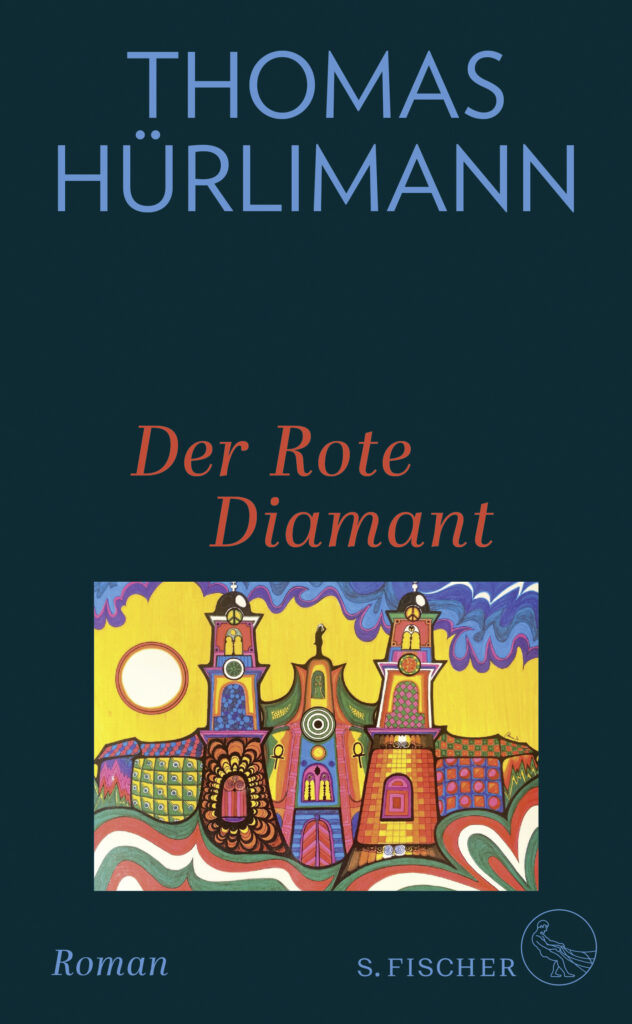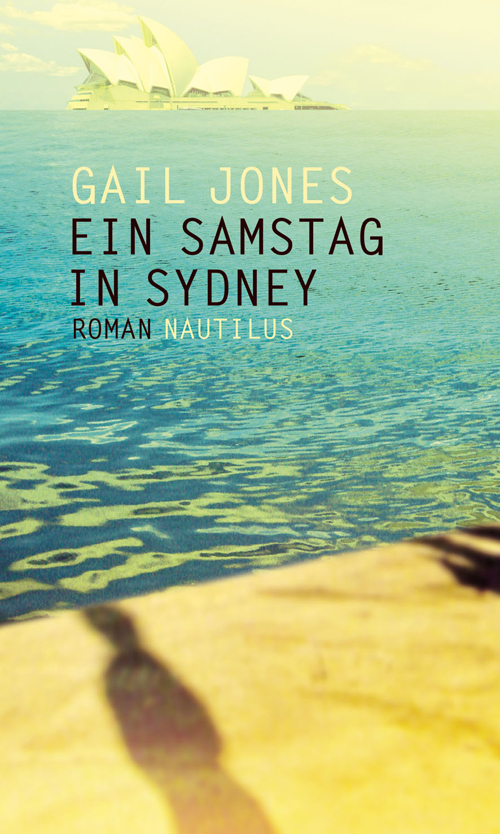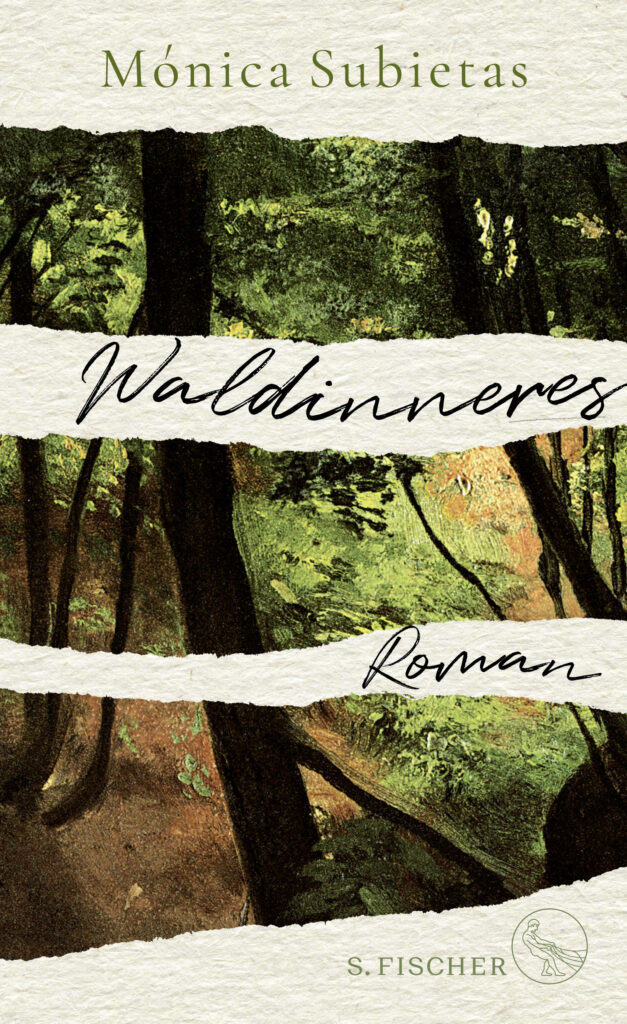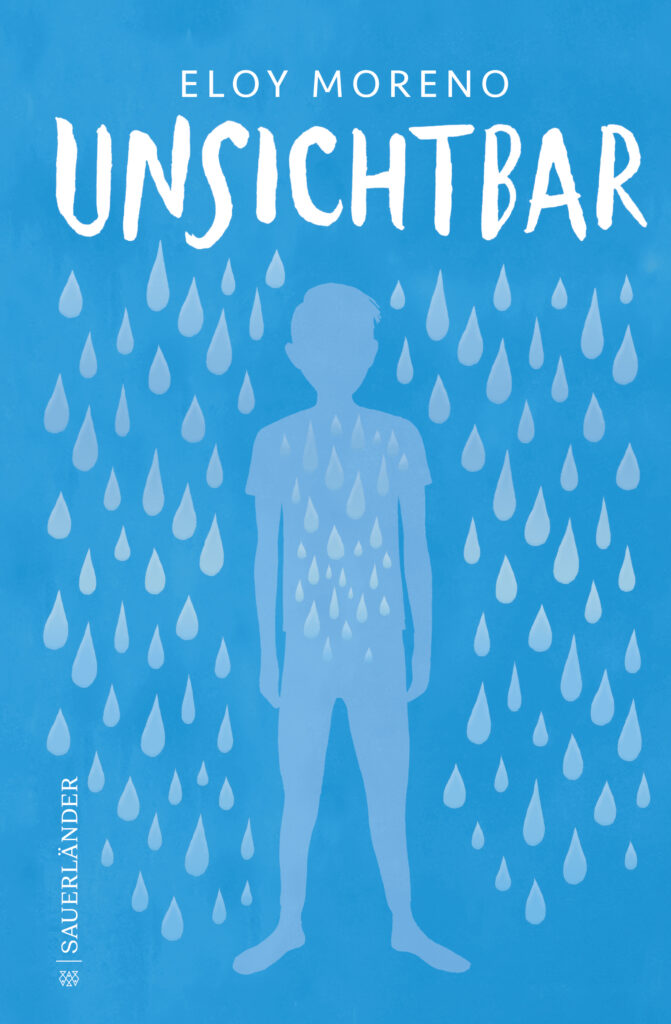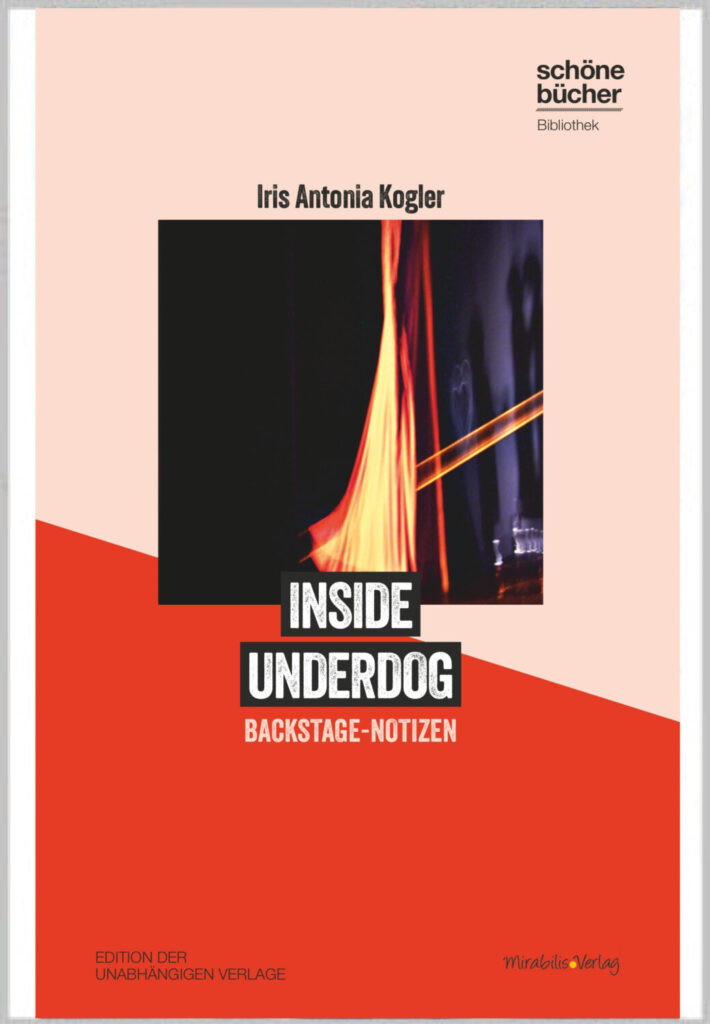Jeremias Gotthelf: Der Bauernspiegel
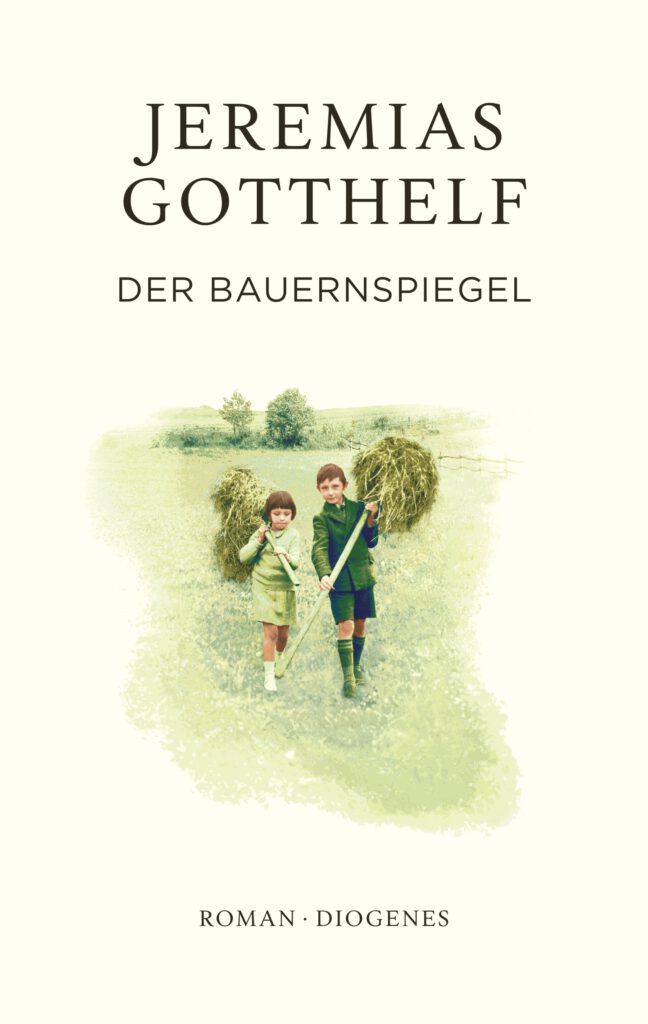
Inhalt:
Mit dem Bauernspiegel wurde aus dem Pfarrer Albert Bitzius der Schriftsteller Jeremias Gotthelf. In seinem ersten Roman erzählt er das Leben eines „Verdingbuben“, dessen Weg aus der Knechtschaft ihn bis ins Paris der Julirevolution führt. Die schonungslose und zugleich humorvolle Direktheit, mit der Gotthelf der eigenen Welt – den Bauernfamilien, aber auch den Schulmeistern und Politikern – den Spiegel vorhält, sorgte schon zu Zeiten der Erstveröffentlichung für Aufruhr und hat bis heute nichts an Brisanz und Aktualität verloren. (Klappentext)
Rezension:
In einer Mischung aus Bauernroman und damals sehr aktueller gesellschaftlicher Analyse rollt „Der Bauernspiegel“, der im Jahr 1837 veröffentlicht wurde, eine Thematik auf, die in veränderter Form noch bis hinein in die 1960er Jahre in Teilen der Schweiz Bestand hatte und auch in anderen Ländern unter verschiedenen Namen das Schicksal unzähliger, zumeist Waisenkinder bestimmte. In Deutschland z. B. unter den Begriff Schwabenkinder, im Schweiz als Verdingen bekannt, wurden diese an Pflegefamilien vermittelt, zumeist in der Landwirtschaft als billige, nahezu rechtsfreie Arbeitskräfte eingesetzt und oft genug physisch und psychisch brutal misshandelt.
Doch noch zu Hochzeiten dieses sklavenartigen Systems gab es Stimmen, die sich für die Rechte dieser Kinder und Jugendlichen einsetzten. Einer der ersten Schweizer gehört den Pfarrer Albert Bitzius, dessen erster Roman diese Thematik aufgreift und schon zur Zeit der Erstveröffentlichung für Diskussionen sorgte.
Unter Pseudonym verfasst, durchleben wir die Geschichte des gleichnamigen Protagonisten, der gleichsam das alte Ego des Autoren ist und das Aufwachsen eines Verdingkindes verfolgt, bis zu seiner Emanzipation von diesem auf Willkür und Gewalt beruhenden Systems. Erzählt wird es aus der Perspektive des Kindes, welches eine Welt um sich herum zu zerbrechen sieht und förmlich von einer Katastrophe in die nächste rutscht und erst mit dem Älterwerden Schritt für Schritt seine Erfahrungen nutzen kann, um sich zur Wehr zu setzen. Bis dahin durchlebt der Protagonist, aus dessen Perspektive der Roman erzählt wird, ein Martyrium, durchbrochen von zu wenigen Momenten des Durchatmens. Von Glück kann dabei lange Zeit nicht die Rede sein.
Der Handlungsverlauf verfolgt ein halbes Menschenleben und veranschaulicht überdeutlich ein System, welches uns in reichen Ländern heute die Haare zu Berge stehen lässt, doch in der Vergangenheit Europas bittere Realität gewesen ist, dessen Gesellschaftskritik doch nichts von seiner Aktualität verloren hat. Kinderarbeit gibt es, in veränderter Form, noch immer in Teilen der Welt. Die Realitäten dürften davon auch in der Moderne nicht allzu weit davon entfernt sein.
Jeremias Gotthelf, um den Autoren mal beim Pseudonym zu nennen, erzählt ausschweifend im altschweizerischen Dialekt, in dem vor allem die Dialoge verfasst sind, welches langsames und konzentriertes Lesen erforderlich macht, vor allem, wenn man sonst nur das Hochdeutsche gewohnt ist. Hinten angestellt gibt es ein Glossar mit Begriffen, was die Lektüre deutlich erleichtert, sowie eine Übersicht über im Roman erwähnte alte Maß- oder Währungseinheiten.
So geglättet gelingt die Lektüre, in der ein aus heutiger Sicht großformatig historisches Panorama eröffnet wird, mit tief gezeichneten Figuren, wobei das Hauptaugenmerk auf den Protagonisten liegt, dessen Entwicklung wir verfolgen. Es gelingt Gotthelf hier eine Verbindung zu schaffen, die über den gesamten Erzählstrang trotz Längen anhält. Längen, die zwangsläufig entstehen, da das Erzähltempo im Gegensatz zur Moderne gemächlich anmutet. Dennoch gelingt das Portrait dieser damals untersten Gesellschaftsschicht und der Schweizer ländlichen Gegenden gut, ebenso wie der Kontrast, hier gestaltet als „Ausbruch“ ins revolutionäre Paris.
Trotzdem möchte man den Hauptprotagonisten schütteln, was mit dem Wissen und Selbstverständnis der heutigen Zeit jedoch leicht gesagt wird, sich zu wehren, was aus unserer Sicht viel zu spät im Handlungsverlauf passiert, was noch verstärkt wird durch die gegensätzlich gestalteten Charaktere, die in der Überzahl erscheinen und sich an Grausamkeiten und Gemeinheiten förmlich überbieten. Unwillkürlich fragt man sich dabei, wie ein solches System so lange Zeit Bestand haben konnte.
In sich schlüssig ist diese Erzählung, die ohne große Sprünge auskommt, auch ohne allzu lange Wendungen, aber mit erhobenen Zeigefinger, der zur damaligen Zeit wohl notwendig gewesen ist. Der Autor konnte aus Beobachten seiner Umgebung Ideen in seine Geschichte einfließen lassen, die dieser in jeder Zeile zu Gute kommen und dabei von Mut- und Trostlosigkeit bis hin zu winzigen Hoffnungsschimmern nicht nur den Protagonisten vor sich hertreiben.
Im Wissen um die historische Realität ist die Erzählung, auf die man sich jedoch einlassen muss, ein wichtiges Dokument der Schweizer Gesellschaftsgeschichte, ohne jemanden unberührt zu lassen. Aus damaliger Sicht ist dies Gesellschaftskritik, politischer Aufruf und aktueller Roman, heute ein Historienroman, in dem man das Anliegen von Albert Bitzius stringent vorgeführt bekommt. Wer sich darauf einlässt, kann dies mit Gewinn lesen. Man sollte jedoch ein Faible oder zumindest die Übung haben, Dialekt verschriftlicht zu sehen. Dies nicht gewohnt, ist die Lektüre zuweilen sehr anstrengend. Zumindest heute.
Autor:
Jeremias Gotthelf ist das Pseudonym des Schweizer Schriftstellers und Pfarrers Albert Bitzius. Dieser wurde 1797 in Murten geboren und starb 1854 in Lützelflüh. Nach Besuch der Literarschule in Bern studierte er Theologie und war 1819 Gründungsmitglied des Schweizerischen Zofingervereins. Nach einem Vikariat setzte er sein Studium fort und wurde nach einigen Stationen Vikar in Herzogenbuchsee.
Als Pfarrgehilfe begann er 1829 in Bern und wechselte anschließend in die Pfarrei Lützelflüh, wo er zum Pfarrer gewählt wurde. Neben der Schulpflicht setzte er sich für Verdingkinder aus armen Familien ein und gegen Alkoholismus. Nach Gründung einer Familie wurde Bitzius 1835 Schulkommissär und gründete im selbigen eine Armenerziehungsanstalt, ab 1828 betätigte er sich zudem journalistisch. Sein erster Roman erschien 1837, weitere Schriften und Erzählungen folgten bis zu seinem Tod 1854.
Jeremias Gotthelf: Der Bauernspiegel Weiterlesen »