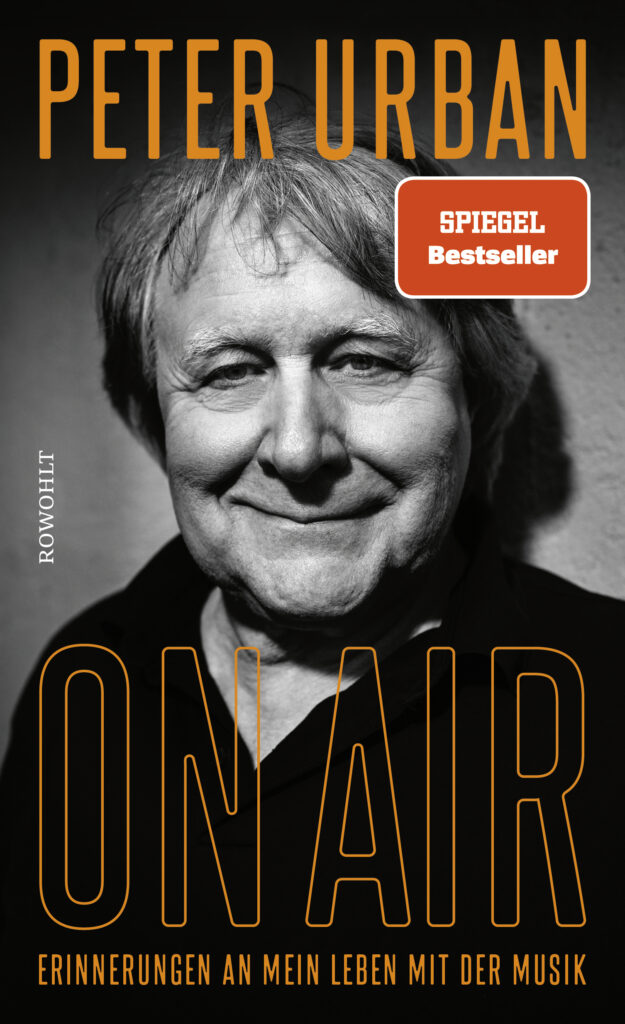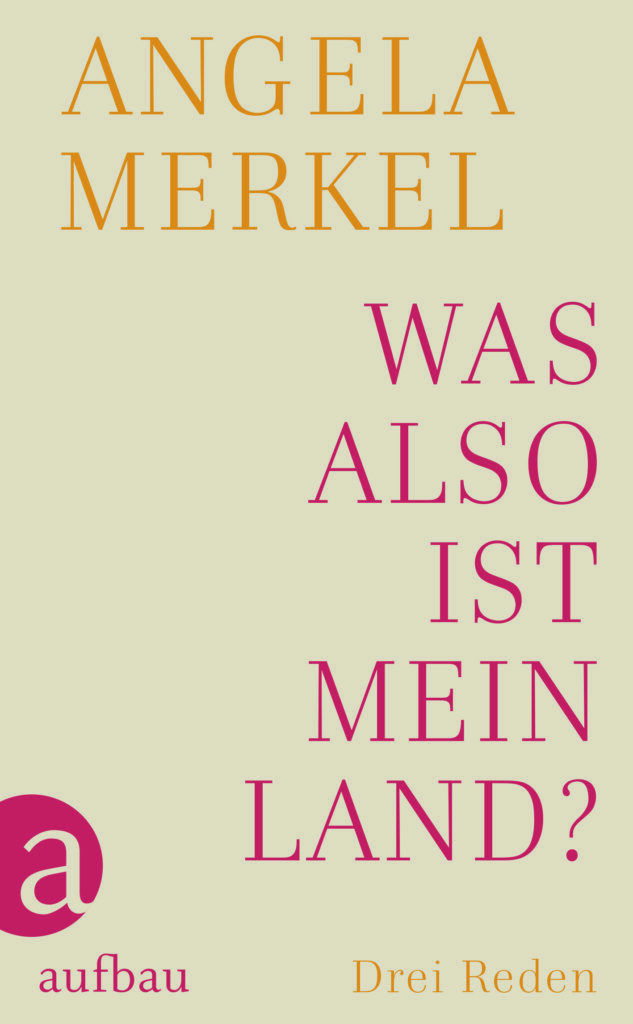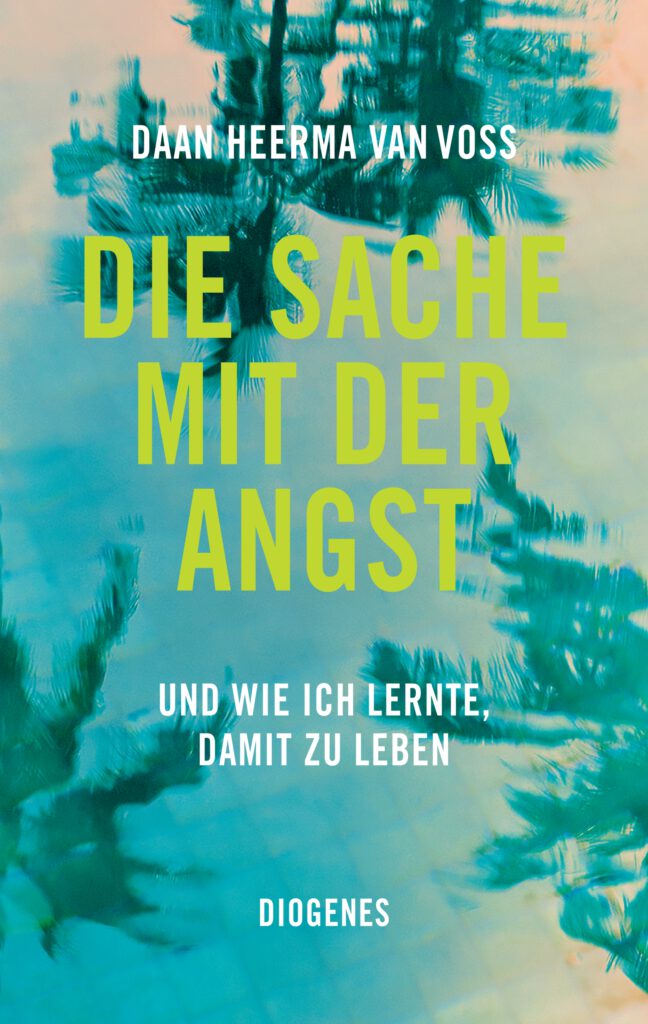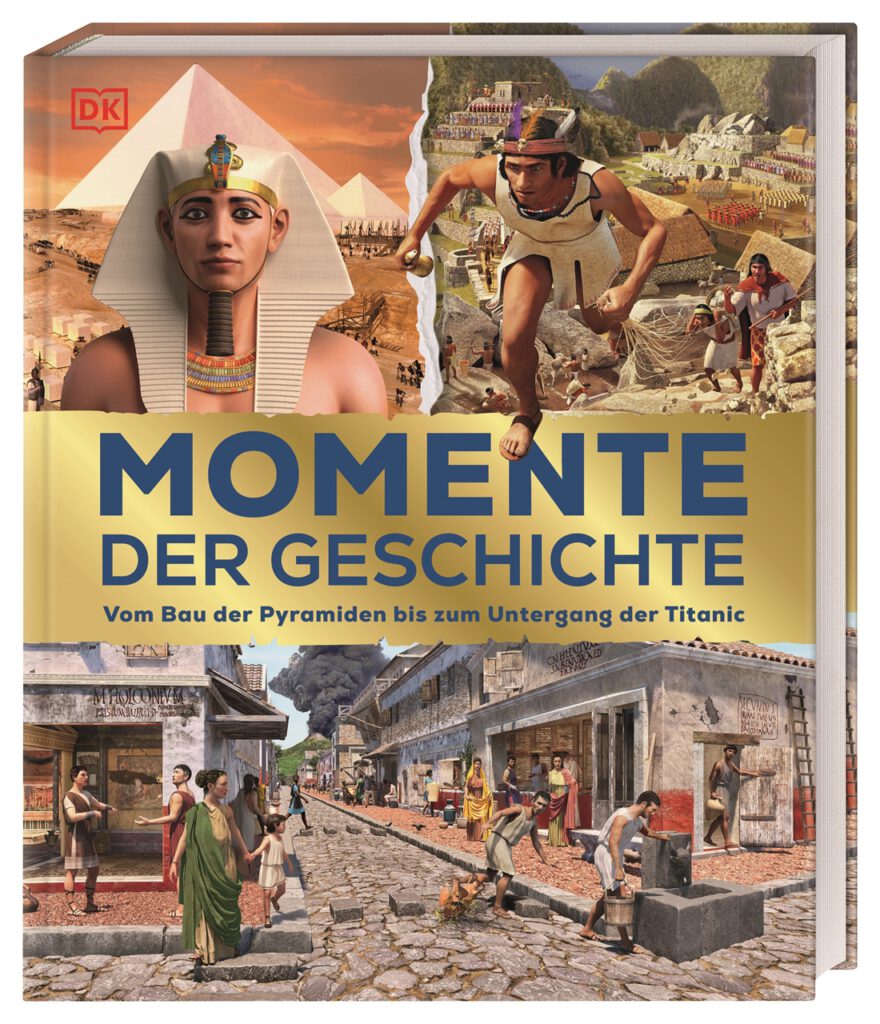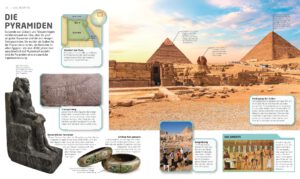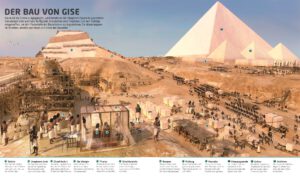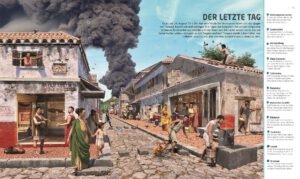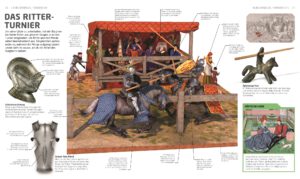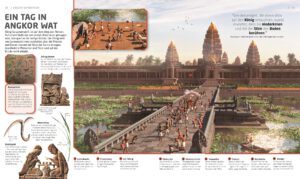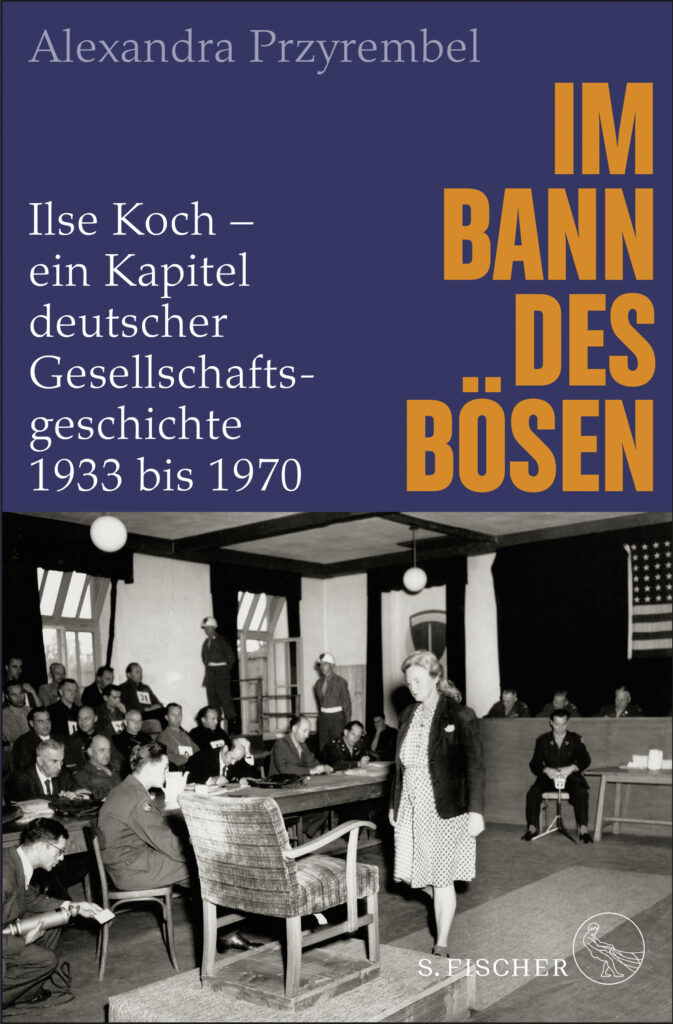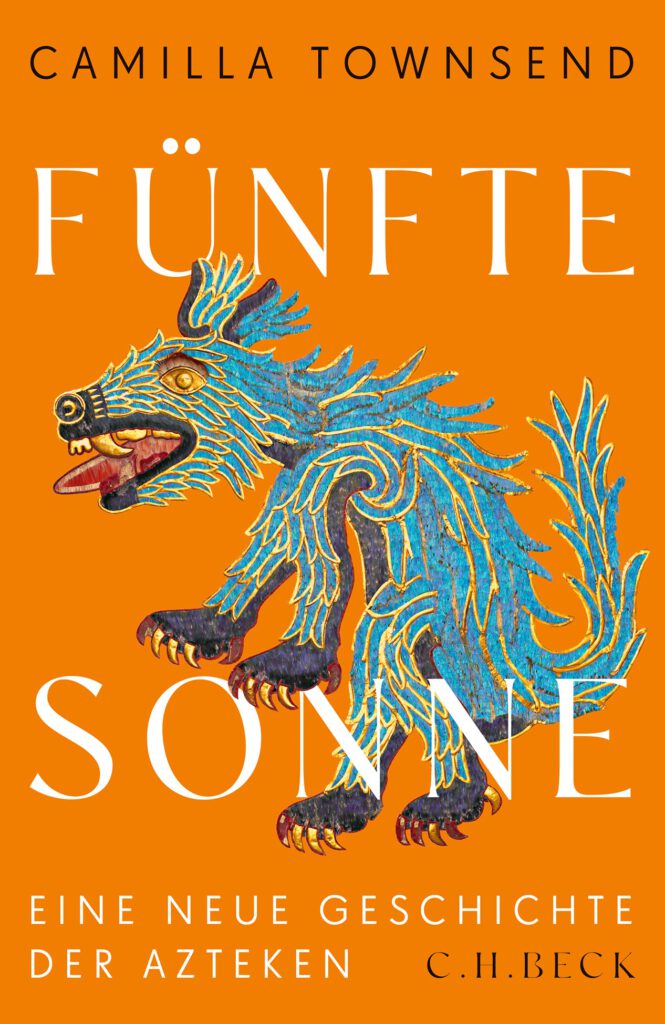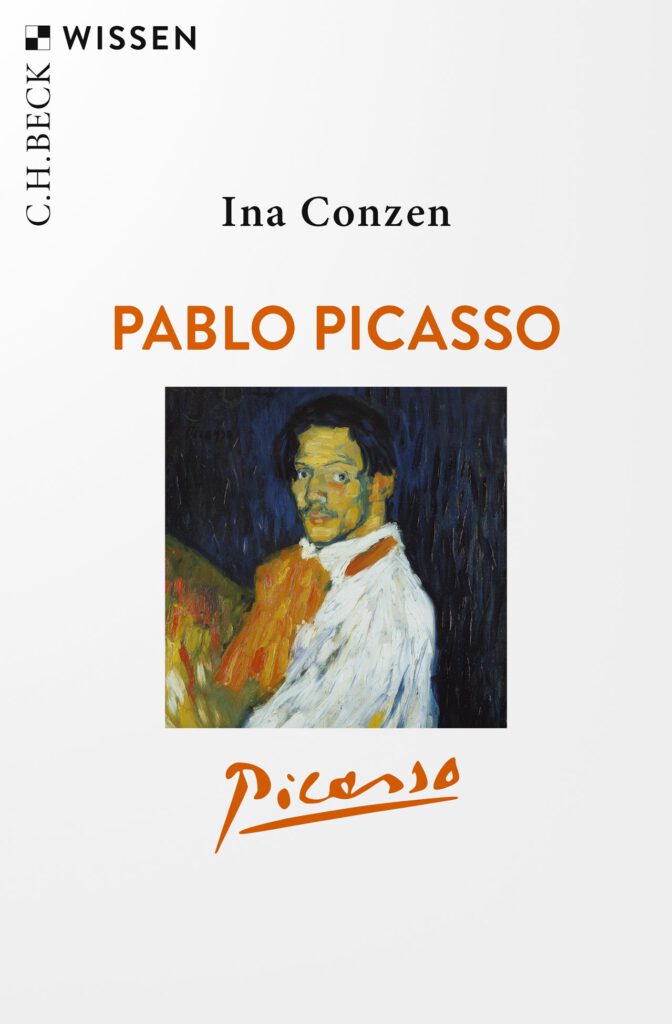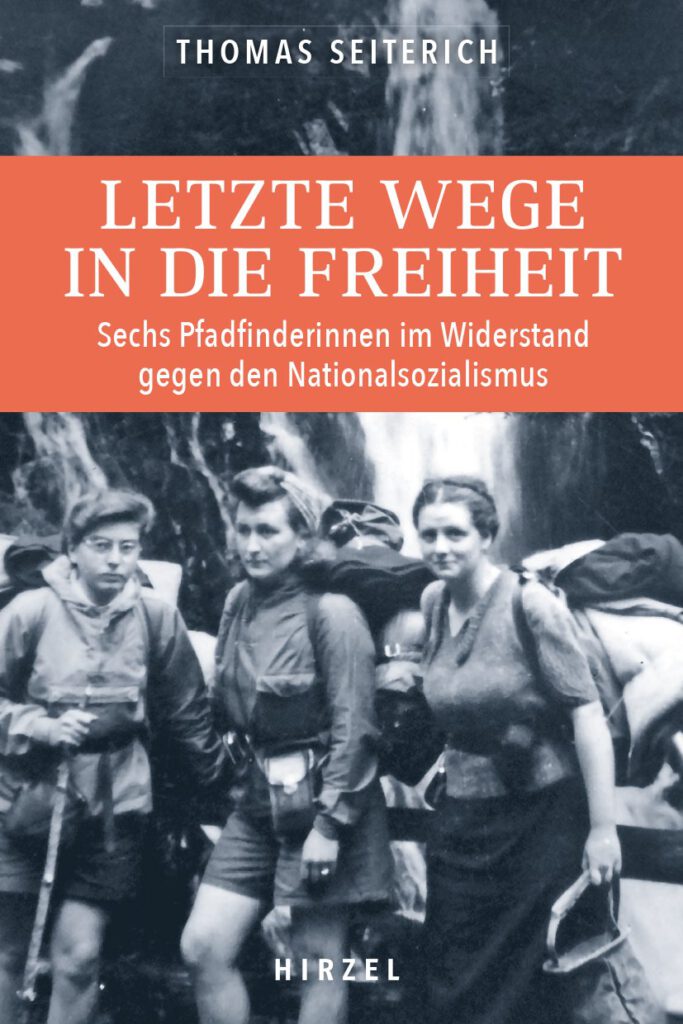Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
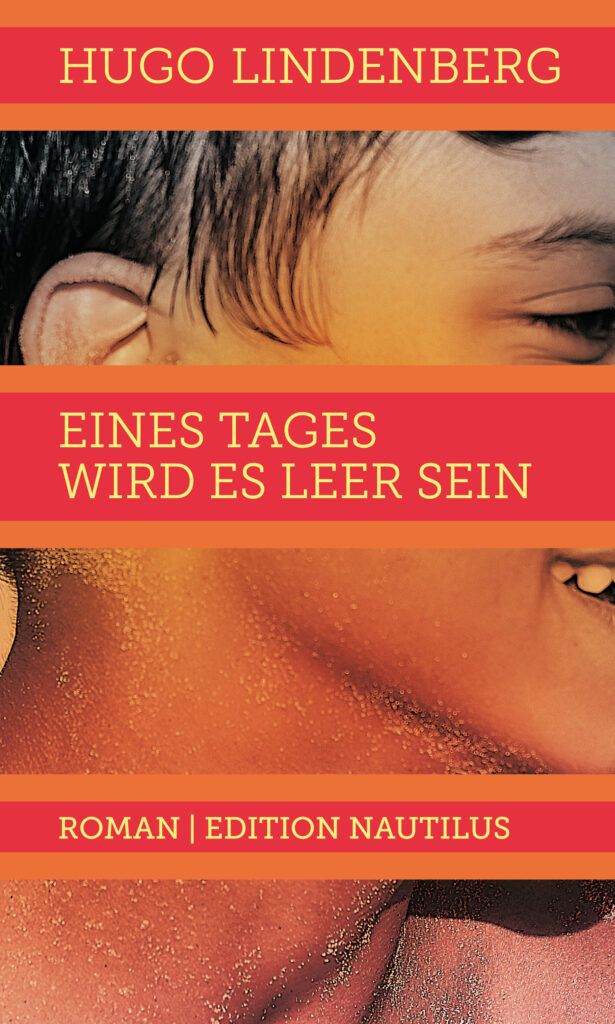
Inhalt:
Ein Sommer in der Normandie, in den 1980er Jahren. Der zehnjährige Erzähler verbringt die Ferien mit seiner Großmutter am Meer. Er ist noch in diesem Zustand der Kindheit, wo man alles intensiv erlebt, wo man noch nicht genau weiß, wer man ist oder wo der eigene Körper beginnt, wo eine Ameiseninvasion der Erklärung eines Kriegs gleichkommt, den man mit all seinen Kräften wird führen müssen. Eines Tages trifft er einen anderen Jungen am Strand, der ihm die Freundschaft anbietet, eine Freundschaft, die auf einem Ungleichgewicht beruht. Denn Baptiste ist ein »richtiger Junge«, hat eine »richtige Familie« – für den Erzähler der Inbegriff eines Glücks, das er dort erstmals findet und das er in jedem Moment wieder zu verlieren fürchtet.
Seine geliebte Großmutter, die den Holocaust überlebte und deren Schtetl-Akzent ihn vor den anderen Familien am Strand mit Scham erfüllt, und seine verhasste »monströse« Tante bedeuten für ihn zugleich widerwillige Geborgenheit und die beständige Gegenwart einer Vergangenheit, deren Trauma auf seinen Schultern liegt.
In so gefühlvoller wie genauer Sprache erzählt Hugo Lindenberg diesen Roman in einer Reihe von Szenen des Sommers, der Stille, des Lichts, der Begegnungen, in einer Stimmung sich dem Ende zuneigender Sommerferien und doch durchzogen von einer Unheimlichkeit und Bewegungslosigkeit, die unter die Haut gehen. (Inhalt lt. Verlag)
Rezension:
Es ist ein unbestimmtes, nicht zu erklärendes und doch alles beschreibende Gefühl im Inneren, welches der Junge besitzt, welches ihm besitzt und mit ihm unzähliger Nachfahren von jenen, die dem Schrecken nicht entkamen. Warum lebe ich? Warum haben es andere Linien meiner Familie nicht geschafft, konnten den Unheil nicht entkommen?
In der Psychologie spricht man da vom transgenerationalem Trauma, szenischem Erinnern, welches selbst jene erfasst, die die unmittelbaren Schläge aufgrund schon des Abstands zur Historie nicht erlebt haben können. Eine von vielen Problemstellungen, mit denen die Nachfahren Holocaust-Überlebender zu kämpfen haben. Was schon in der Theorie schwierig ist, zu erfassen, hat der französische Autor Hugo Lindenberg in eine Erzählung zu gießen versucht. Dabei herausgekommen ist ein erdrückender und zugleich berührender Debütroman.
Dieser wird aus der Sicht des Protagonisten erzählt, einen namenlosen Jungen, der seine Ferien am Strand verbringt, bei seiner Großmutter und Tante, jedoch zumeist sich selbst überlassen. Dort beobachtet er die Menschen, die ihn umgeben. Familien faszinieren ihn und er stellt sich vor, ein Teil von ihnen zu sein. Vollständige Familien sind für ihn, der das nicht hat, Inbegriff des Glücks und so denkt er sich in die Leben anderer hinein, bleibt dennoch unsichtbar.
Seit meiner Ankunft, eigentlich serit immer schon habe ich mit meiner Großmutter mit niemandem geredet.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
Ein Junge, der keine Stimme findet, wie soll er auch, wird kaum auch von anderen bemerkt. Bis auf einem, der das Spiel unterbricht. Zusammen töten beide Quallen am Strand. Der Junge aber beginnt einen Sommer lang zu leben.
Nichts ist mir fremder als Jungen in meinem Alter.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
Sätze, die sich in die Netzhaut einbrennen, sind es, die der Autor gekonnt setzt, um seine Geschichte und die unzähliger Menschen zu erzählen. Selten wurde Leere so schön beschrieben, doch erreichen die Worte hier auch die Lesenden. Können sie auch nicht anders, doch diese Traurigkeit, Melancholie, die im nächsten Moment in die Unsicherheit des Jungen zu kippen droht, muss man aushalten können. Da die Gefühlswelt für diesen kaum zu beschreiben ist, verlegt er sich aufs Sachliche und versucht doch eine Normalität zu erreichen, die ihm nicht gegeben ist.
Ich muss mich konzentrieren, damit man mir meine Aufregung nicht anmerkt, damit ich wie ein kleiner Junge wirke, der Zärtlichkeit gewohnt ist.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
Der kleine Protagonist gewinnt so, mit zunehmender Seitenzahl an Ecken und Kanten, derer viele. Die sich aufbauende Jungenfreundschaft symbolisiert das Durchbrechen. Es scheint, als wäre gefühlsmäßig zum ersten Mal für den Jungen etwas greifbar. Die Angst, das zu verlieren, schimmert Zeile für Zeile durch. Leuchtet hell.
Beschrieben wird ein unbestimmter Zeitraum von wenigen Tagen bis ein paar Wochen. Genauer wird es nicht, ist auch nicht wichtig, in der Kindheit verläuft die Wahrnehmung von Zeit ohnehin anders. Dieses Gefühl wiederzugeben ist Hugo Lindenberg gelungen, wie auch der Aufbau der anderen Figuren, von denen nur zwei, die der Großmutter und der Tante, Konturen bekommen. Sie umkreisen den Jungen, sind nah und doch so fern. Baptiste ist hingegen das, was der Junge sich wünscht, der seinerseits die Ferienbekanntschaft ebenso faszinierend findet.
Der Gegensatz ist folglich keine Gegenüberstellung aus Gut und Böse, eher unterschiedlicher Vorstellung von Leben. Was wäre, wenn? Was ist mit mir? Was mit meiner Familie? Große Fragen, versammelt in diesem sehr kompakt gehaltenen Roman. Kein Wort ist hier zu viel.
Der kleine Hauptprotagonist lässt uns seinen Gedanken folgen. Gesprochene Sätze fallen auf, da sie so rar gesät sind. Wie Nadelstiche oder Sandkörner auf der Haut fühlt sich das an. Nach und nach enthüllt sich die Traurigkeit der Hauptfigur, die nur in Rollen lebt, die sie zu spielen zu müssen meint. Was aber genau macht das mit einem? Diese Frage seziert der Autor und lässt sie den Jungen ergründen. Oberflächlich passiert nicht viel. Aus Kindersicht um so mehr. Zu viel für die schmalen Schultern der Hauptfigur?
Normalerweise fragten die anderen, wo ist denn deine Mutter, und ich wusste, dass sie es wussten, abver sie wollten den Tod hören, wegen dem Nervenkitzel. […] Sie blieben, solange der Nervenkitzel anhielt, dann wandten sie sich leicht angeekelt ab.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
Nur in Bruchstücken erfährt man Hintergründe, wie auch der Junge nur lose Fetzen Erinnerungsstücke festhält. Der Vater abwesend, keine Mutter mehr vorhanden und die ihn direkt umgebenden Erwachsenen haben ja auch keine Worte. Für ihn, das Kind, ohnehin nicht. Der Protagonist ahnt nur, weshalb er leidet.
Ich kenne meine Rolle genau. Zehn Jahre alt, hasenzähne, große schwarze Locken und lange Wimpern, Sommersprossen auf der Nase, ziemlich schüchtern, brave Kleider, einen kleinen Strauß Magnolien in der Hand. Ich bin das Leben.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
In beinahe poetischer, dann wieder ins Nüchterne wechselnde Sprache hat Hugo Lindenberg diese Erzählung, gleichsam eine Novelle aufgebaut, die einem auch nach Umblättern der letzten Seite kaum loslassen wird. Zunächst wird man hineingesogen in die Geschichte, spürt den Sand unter die Zehen knirschen, den Lärm der Umgebung, der ausgeblendet wird, wenn sich der Protagonist fokussiert. Mit dieser Dichte die hintergründige Thematik veranschaulicht zu bekommen, ist selten in dieser Form zu lesen.
Dieses Bild von mir würde ich nicht mehr loswerden, das wusste ich. Und tatsächlich bin ich es bis heute nicht losgeworden.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein
Sowohl sprachlich, damit ist nicht gemeint, dass man praktisch jeden zweiten Satz sich anstreichen und herausschreiben möchte, als auch erzählerisch zieht einem die Lektüre hinein und wirft die Lesenden dann um. Heftiger kann eine ruhige Erzählung kaum wirken. Nur im ersten Moment meint man eine Coming of Age Geschichte vor sich zu haben, doch entdeckt darunter noch so viel mehr. Sachbücher gibt es wohl einige, die sich mit dem Übertragen von Traumata in die nachfolgenden Generationen beschäftigen. In Romanform ist zumindest mir dies so noch nicht untergekommen.
Von der sich dadurch umgebenden Heftigkeit sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen. Es ist ja gerade dadurch auch eine wunderbare Lektüre. Hier ist Hugo Lindenberg ein tolles Debüt gelungen, auf Grundlage dessen, was sich in vielen Familiengeschichten wieder findet. Ungesagtem eine Stimme zu geben, hat hier wunderbar funktioniert.
Eine absolute Lese-Empfehlung.
Autor:
Hugo Lindenberg wurde 1978 gebopren und ist ein französischer Journalist. „Eines Tages wird es leer sein“, iost sein erster Roman, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Der Autor lebt in Paris.
Hugo Lindenberg: Eines Tages wird es leer sein Weiterlesen »