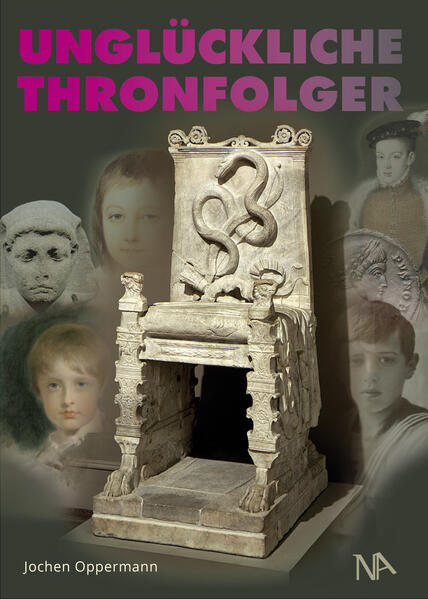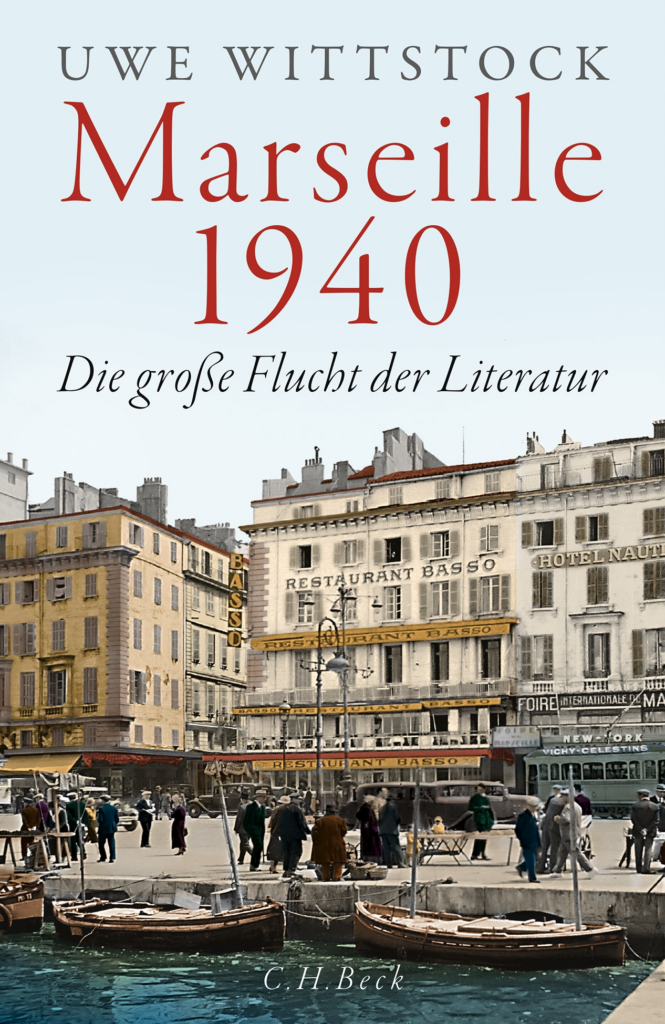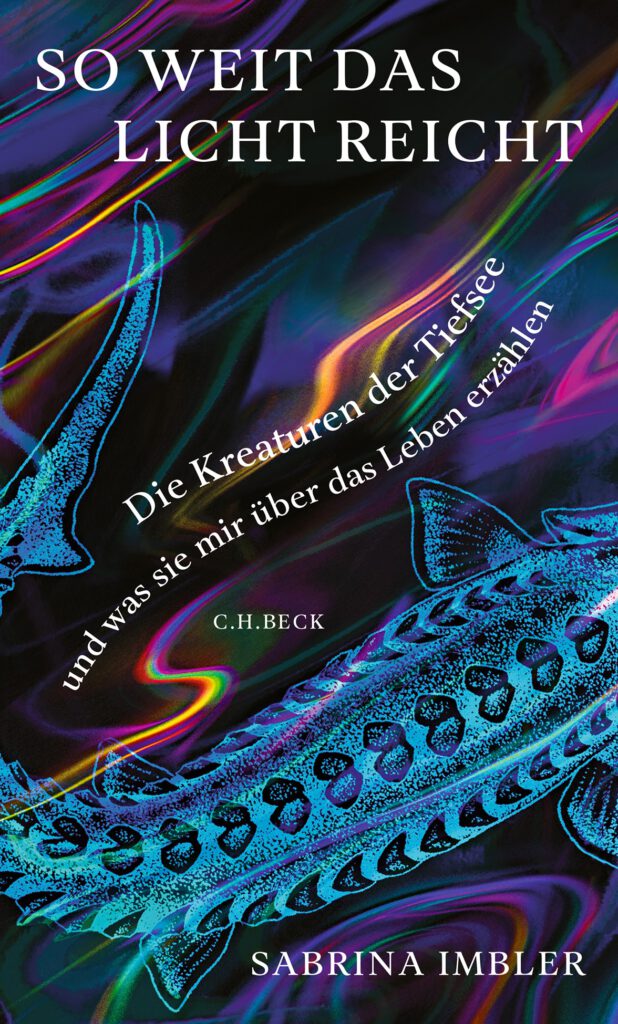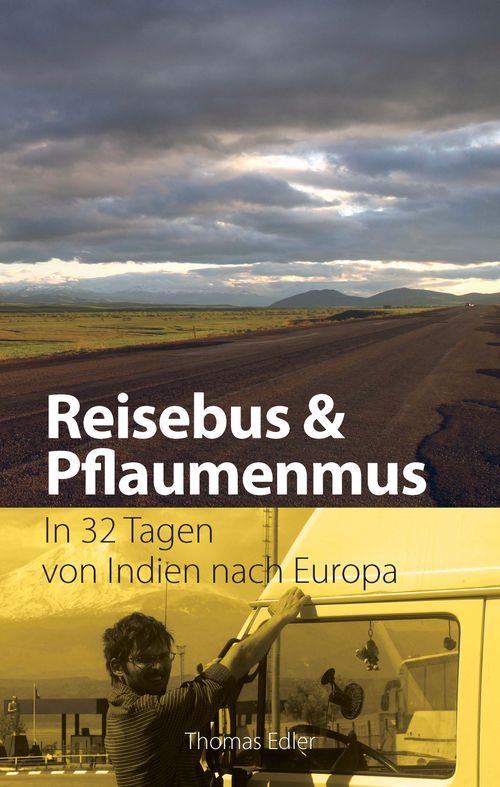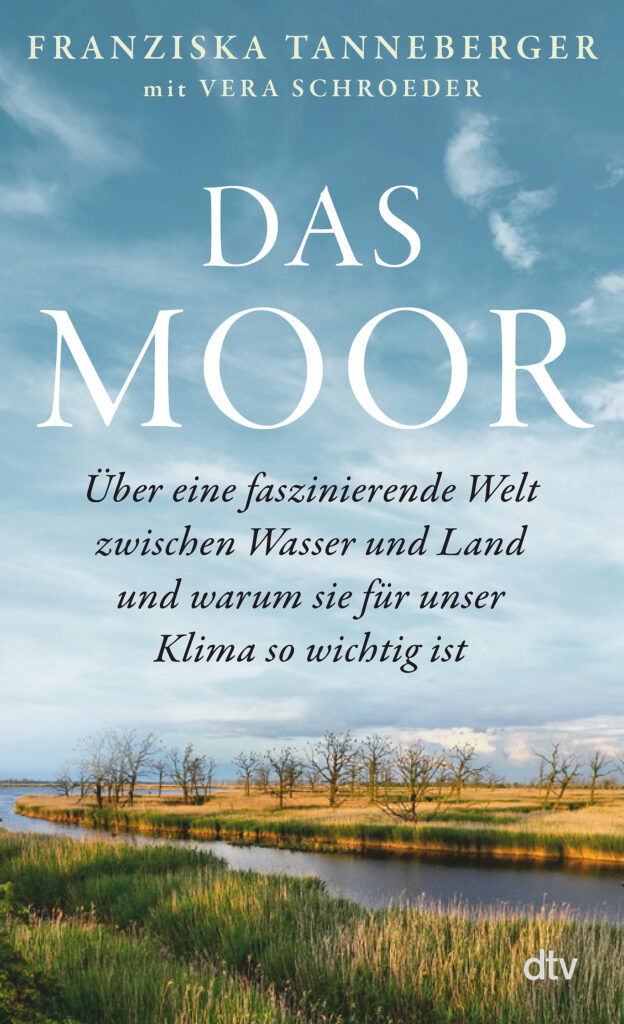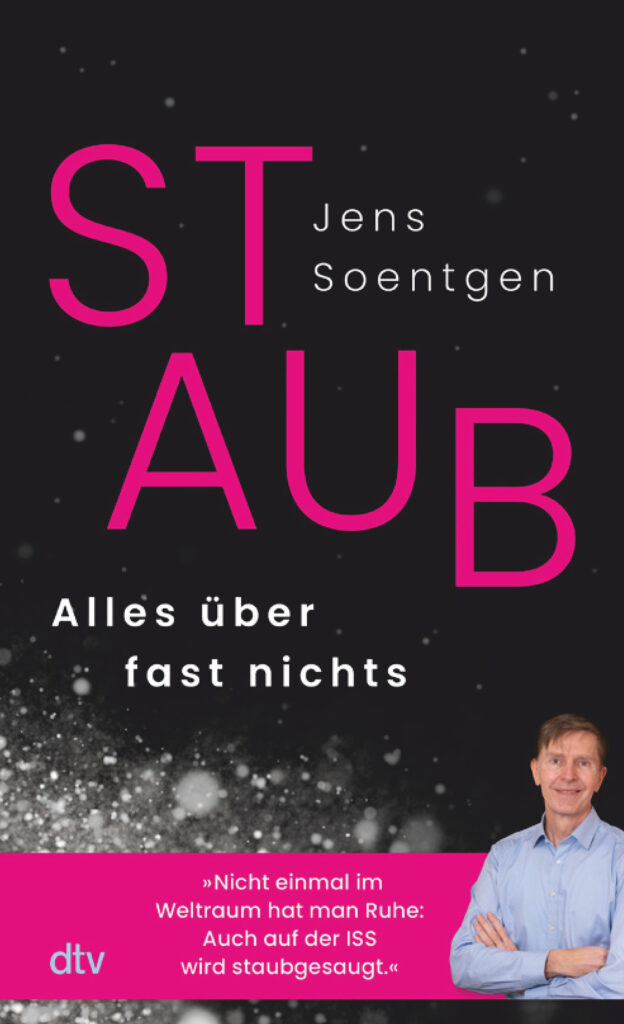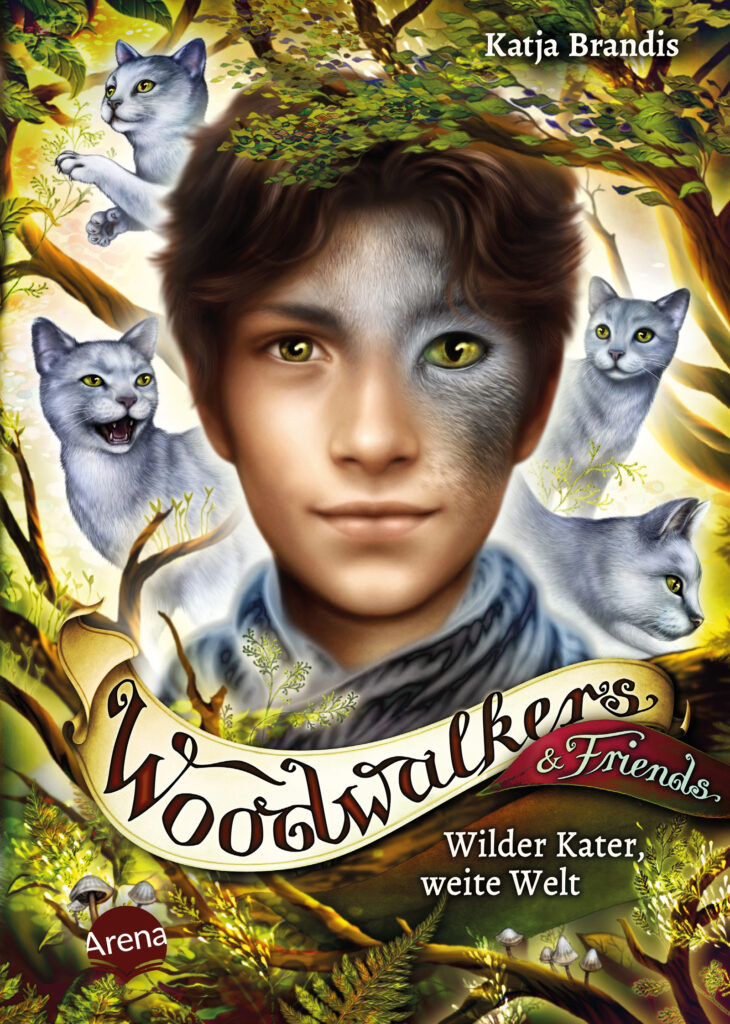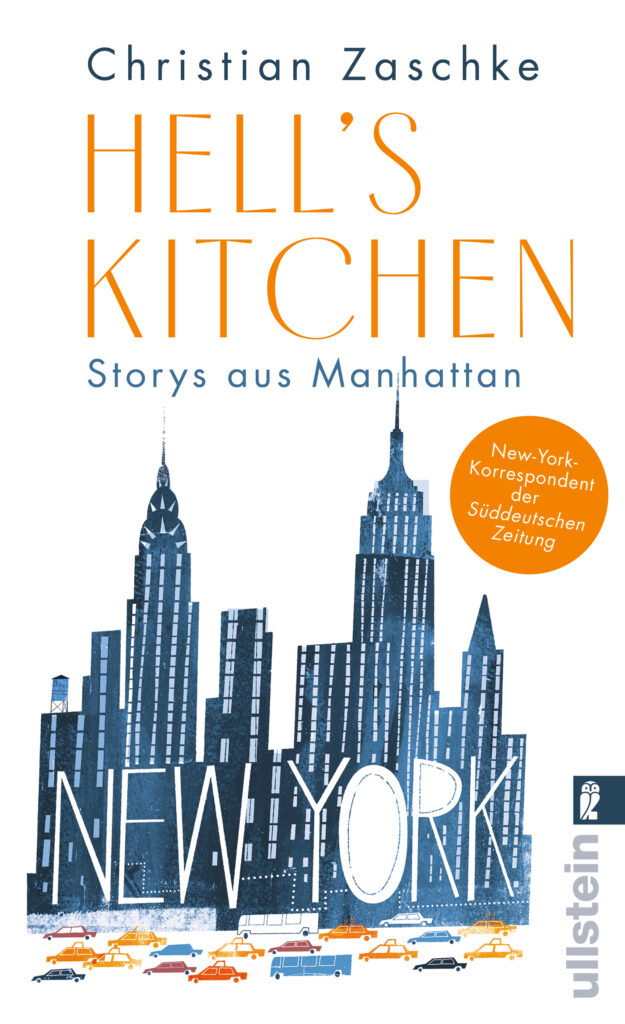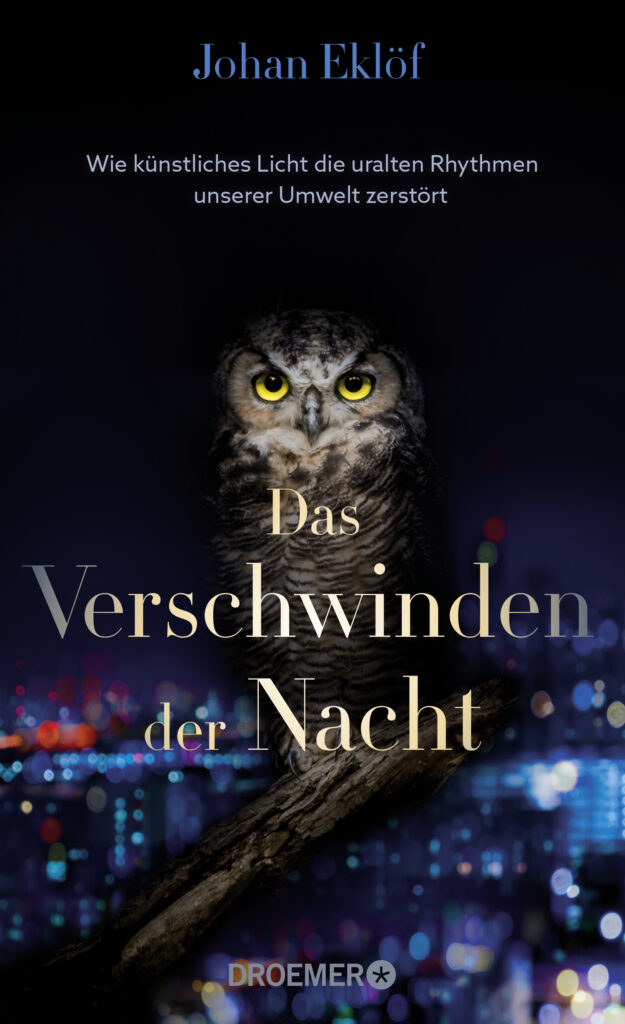Guido Knopp: Putins Helfer
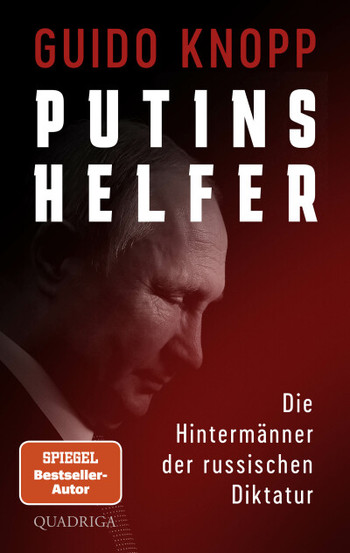
Inhalt:
Wer sind die mächtigen Strippenzieher hinter dem russischen Präsidenten?
Über zweieinhalb Jahrzehnte nach seinem Weltbestseller „Hitlers Helfer“ porträtiert Guido Knopp in seinem neuen Buch nun die Mächtigen eines Reiches, das den Frieden in Europa mehr denn je bedroht: Putins Helfer.
Sie halten ihren Herrscher an der Macht, um selbst Einfluss zu nehmen und sich zu bereichern.
Es sind Oligarchen wie Roman Abramowitsch, die von der Nähe zum Diktator profitieren; routinierte Apparatschiks wie Sergej Lawrow, die als Sprachrohr ihres Herrn zu dienen haben – oder Kyrill der Erste, der als Patriarch von Moskau seine Kirche zum Erfüllungsgehilfen einer Diktatur macht. Sie alle sind Träger einer Tyrannei, die sich längst nicht nur nach innen richtet, sondern mittlerweile auch nach außen. (Klappentext)
Rezension:
Paladine, Träger und Garanten einer Herrschaft sind sie Mächtige in einem Reich, welches nach 1945 den Frieden in Europa mehr denn je bedroht. Sie alle stützen ein System und dessen Mann an der Spitze und sind gleichsam von dessen Willen und Launen abhängig. Putins Helfer verdienen dabei gut, auf den verschlungenen Pfaden zwischen entfesselten Kapitalismus und Korruption haben sie ein Vermögen angehäuft als Akteure einer Kleptokratie, die die russische Gesellschaft zerfrisst. Sie scheinen abhängig vom ehemaligen KGB-Offizier an der Spitze des Landes, doch könnten sie eines Tages einen Machtwechsel herbeiführen oder sich selbst nach oben katapultieren. Ebenso auch fallen. Schon mancher ist aus den Fenster gestürzt oder vergiftet worden. Der Journalist und Historiker Guido Knopp folgt den Spuren derer erstaunlichsten Figuren.
Und legt damit ein Zustandsbericht der russischen Führungsriege offen, eines engen Geflechts aus Wirtschaft, Politik und Militär, welche durch Korruption und mafiöser Methoden zusammen- und am Leben gehalten wird. Den sicheren Raum verlassend, den die Betrachtung bereits gelebter Personenbiografien bietet, gleicht die Lektüre hier einen Krimi. Das Sachbuch wurde 2023 veröffentlicht, längst müsste man zu einigen der beleuchteten Lebenswege Anmerkungen und Zusätze anfügen. Die Geschichte Prigoschins etwa, ist da als Beispiel zu nennen.
Sieben Personen aus Putins Umfeld werden in gewohnt kurzweiliger Form beleuchtet. Teilweise taucht man in Szenarien ein, die einem zuweilen an eine innere Form von Krieg und Frieden erinnern und gerade im Kontext der aktuellen Geschehnisse mehr als nur interessant zu betrachten sind. Unweigerlich zieht man Parallelen zwischen den dargestellten Personen, ebenso nach den „Vorbildern“ vergangener Diktaturen. Die Titel-Parallelität ist dabei bewusst gewählt und trifft, wie die Faust aufs Auge.
Recherchearbeit ist hierbei jedoch nicht leicht gewesen. Russlands Mächtige bleiben im Dunkeln, haben im Laufe der Jahren nur wenig von sich selbst verraten, weshalb sie im Gegensatz zu manch anderen Weg-Begleitern noch am Leben und auf einflussreichen Posten sind. Trotz Sanktionen und Auswirkungen, die sie eines Tages eventuell durchaus dazu treiben können, auf Putin jemand anderes folgen zu lassen. Spannend wird es immer dann, wenn weniger hierzulande bekannte Gesichter beleuchtet werden. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche etwa, oder Russlands TV-Protagonist Nr. 1, Wladimir Solowjow, während man etwa von Lawrow ein Bild im Kopf haben dürfte.
Das Aufzeigen von Abhängigkeiten in einem kleptokratischen System ist Guido Knopp hier hervorragend gelungen, zudem er auch die Entwicklungen der jüngeren Zeitgeschichte Russlands nicht zu kurz kommen lässt. Zudem kann dieses Sachbuch als gelungenes Einführungswerk dienen, sich mit den darin beschriebenen Personen auseinanderzusetzen, um ein wenig den Kitt eines Systems zu begreifen, welches fernab aller Medienbilder agiert und mit Putin (über)lebt, zugleich aber auch dessen größte Gefahr sein könnte, wenn es denn wollte.
Autor:
Guido Knopp wurde 1948 geboren und ist ein deutscher Journalist, Historiker, Publizist und Moderator. Nach der Schule studierte er Geschichte, Politik und Publizistik und arbeitete zunächst als Redakteur verschiedener Zeitungen. So war er u.a. für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und der „Welt am Sonntag“ tätig. 1978 wechselte er zum ZDF und leidete ab 1984 die von ihm initiierte Redaktion „Zeitgeschichte“. Neben der Podiumsdiskussionsreihe „Aschaffenburger Gespräche“ verantwortete er zahlreiche Dokumentationsreihen zur deutschen Geschichte. Seit 2010 ist er Vorsitzender des Vereins „Unsere Geschichte. Das Gedächtnis der Nation.“ Guido Knopp erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. die „Goldene Kamera“ oder den „Emmy“. Er lebt mit seiner Familie in Mainz.
Guido Knopp: Putins Helfer Weiterlesen »