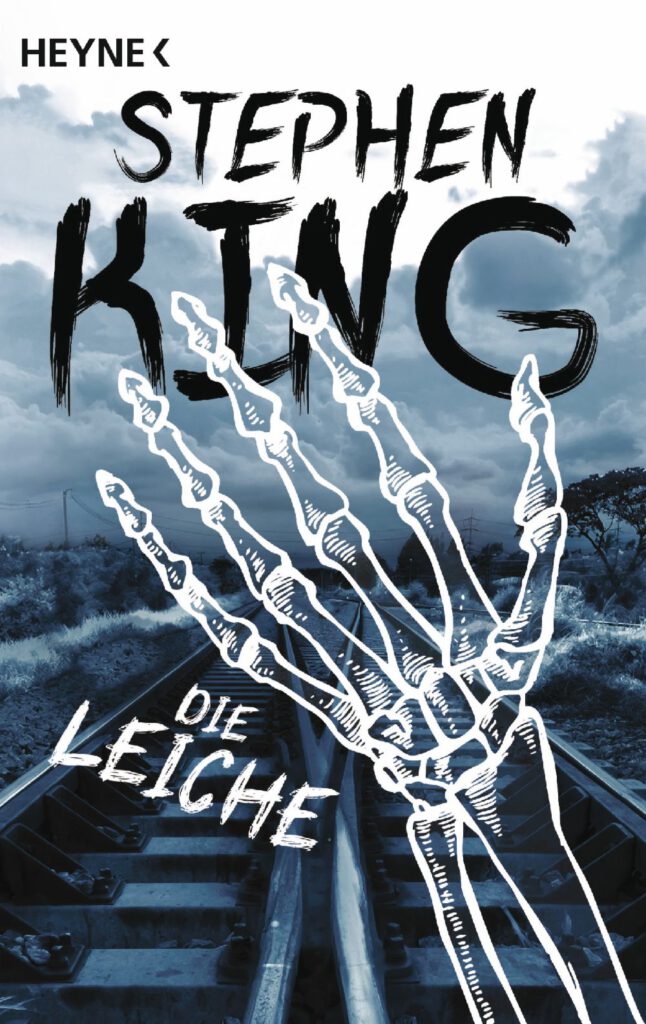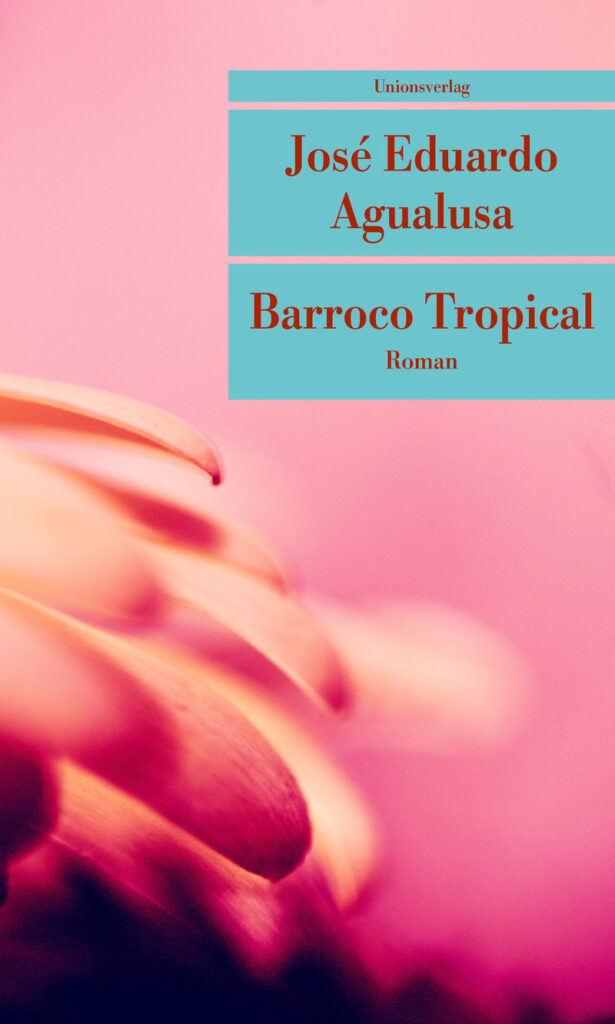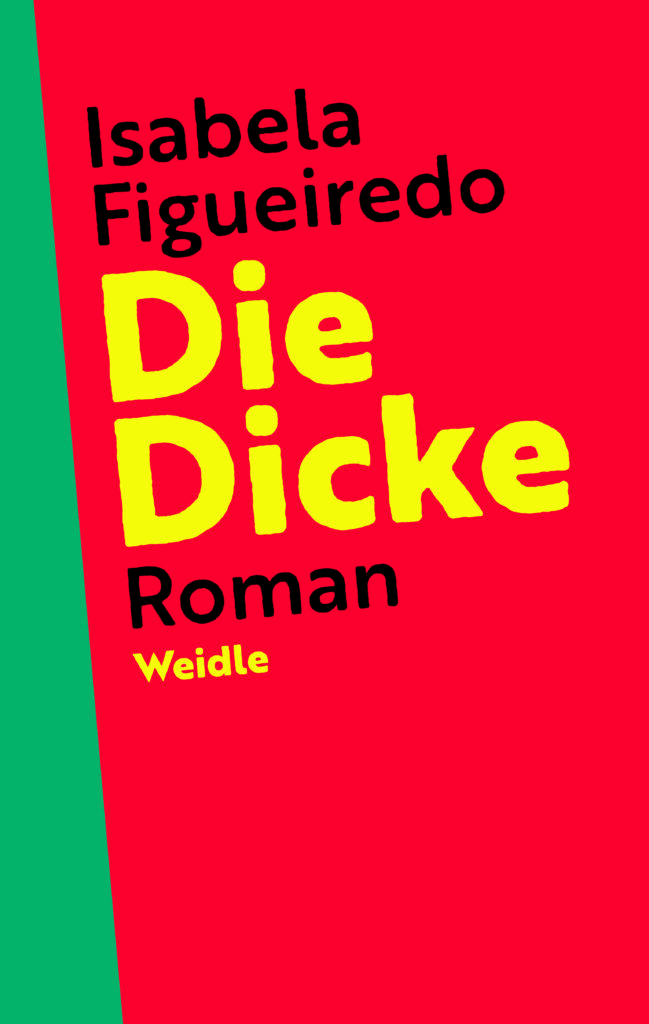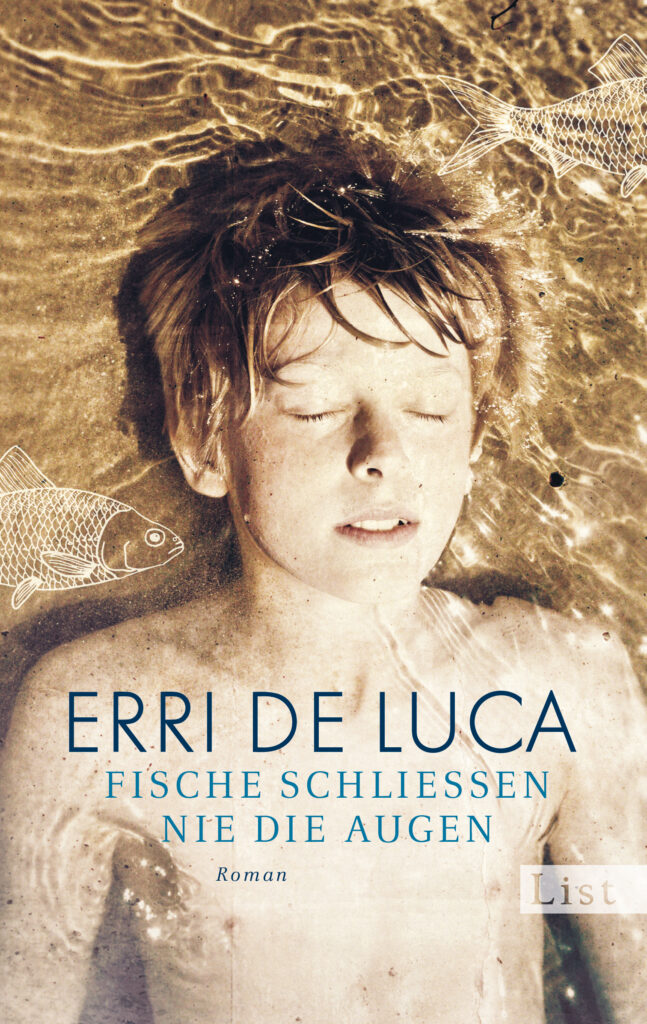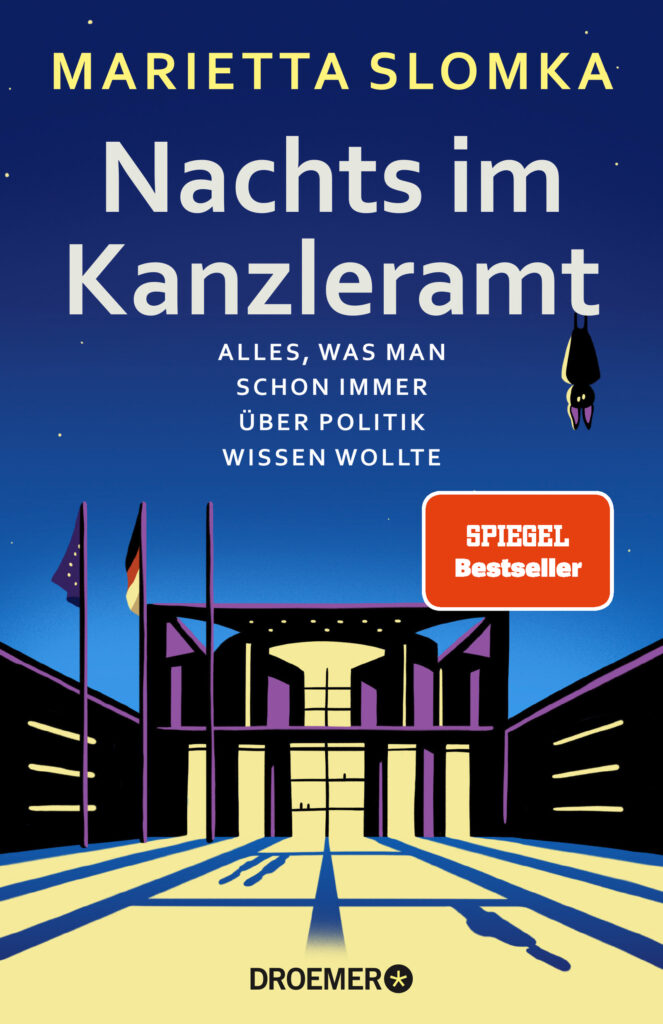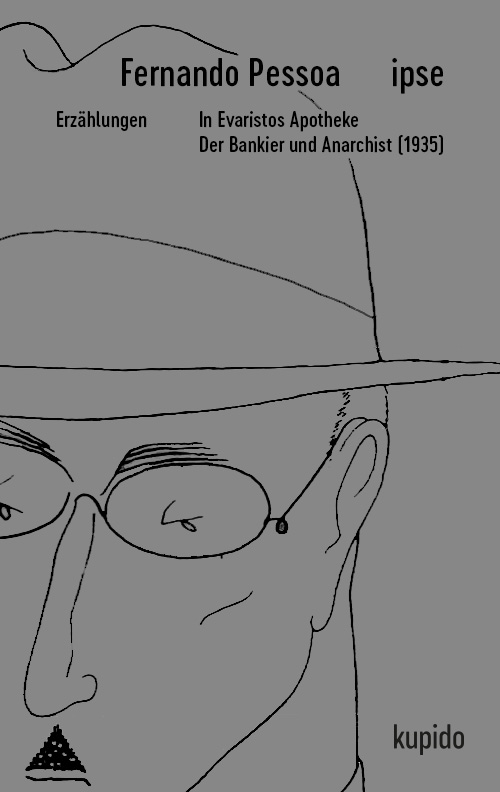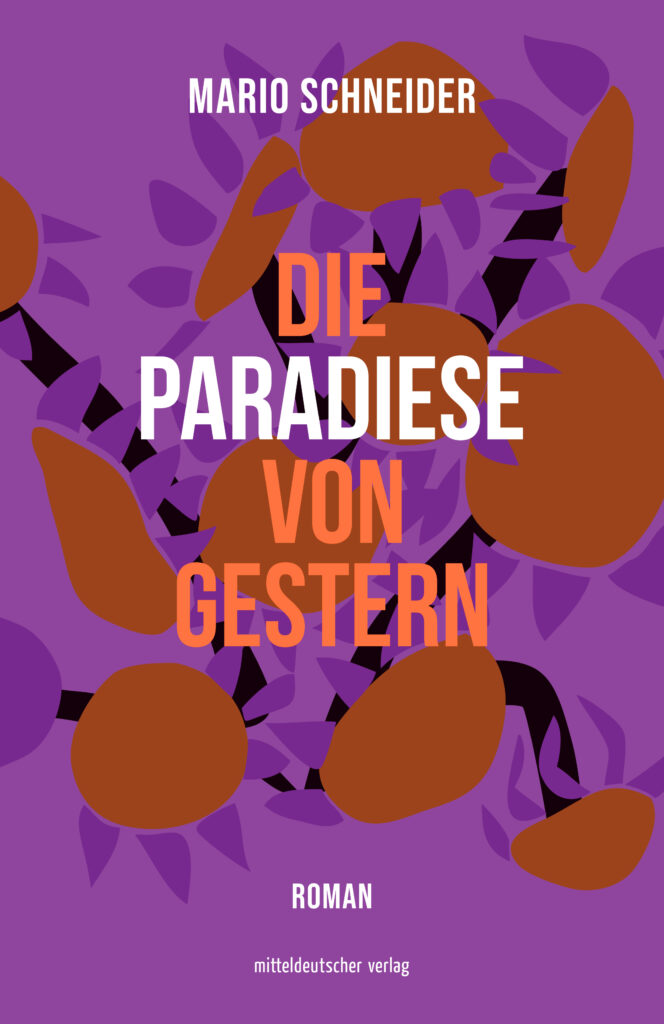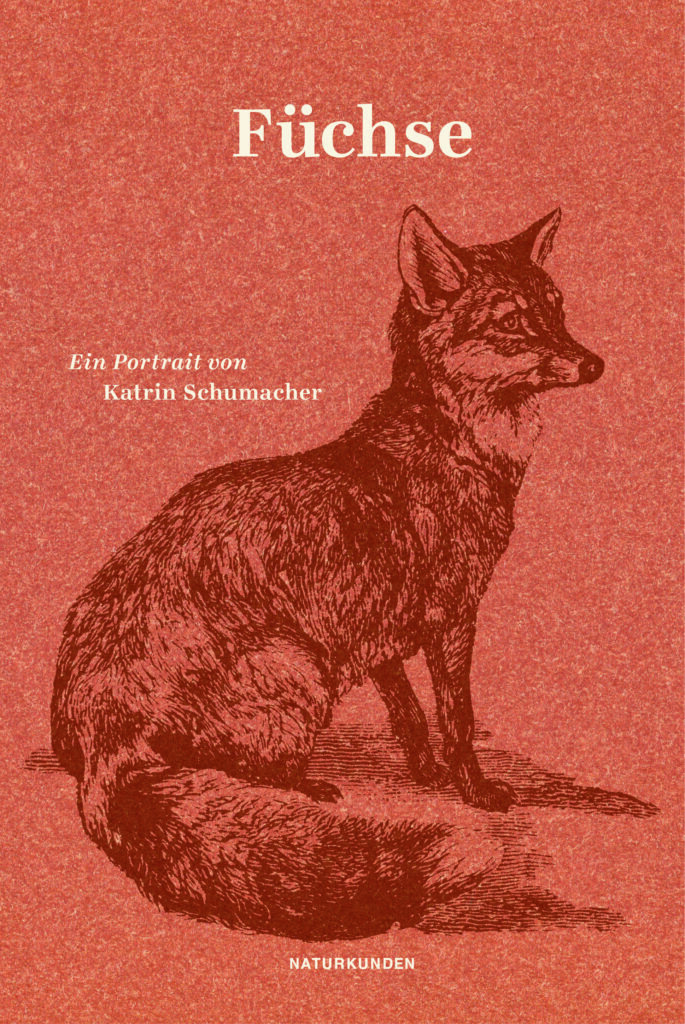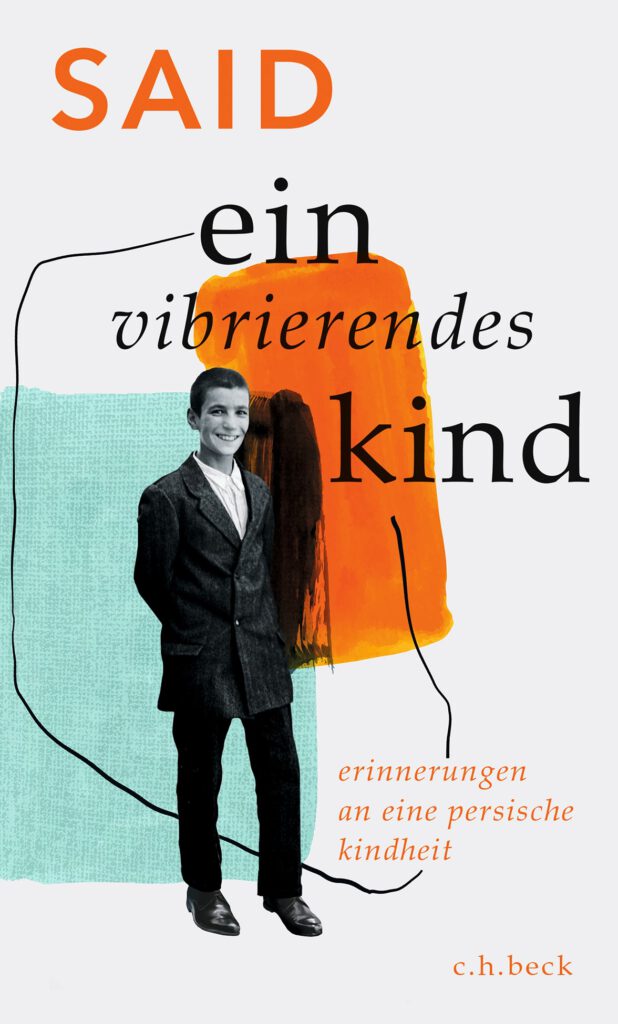Jules Valles: Jacques Vingtras 1 – Das Kind
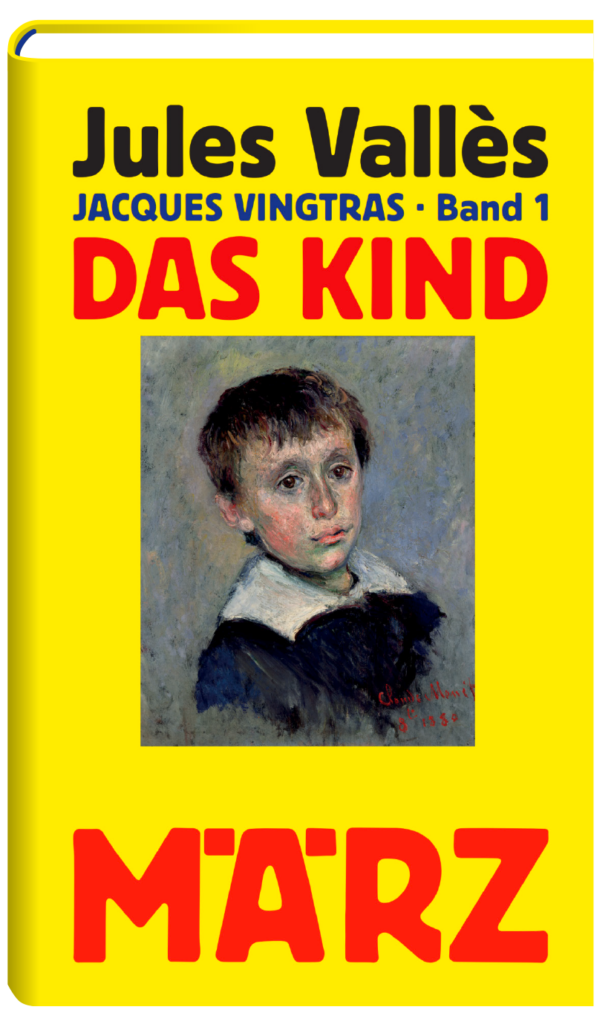
Inhalt:
In diesem großen Klassiker der französischen Literatur erzählt Jules valles die durchaus autofiktionale Geschichte eines kleinen Jungen, der von seiner Bauernmutter und seinem Lehrervater ständig zum Sündenbock gemacht und emotional und körperlich missbraucht wird. Sein größtes Anliegen ist es, den sozialen Status der Familie zu verbessern.
Allen geschilderten sozialen Abgründen und menschlichen Bösartigkeiten zum trotz ist Das Kind doch voller Ironie und Humor und gilt vielen gar als eines der witzigsten Bücher der französischen Literatur überhaupt. In Christa Hunschas leichtfüßiger Übersetzung erstrahlt der Roman so modern, als sei er aus dem Herzen der Gegenwart geschrieben. (Klappentext)
Jules Valles: Jacques Vingtras 1 – Das Kind
Jules Valles: Jacques Vingtras 2 – Die Bildung
Jules Valles: Jacques Vingtras 3 – Die Revolte
Rezension:
Einerseits historischer Roman aus heutiger Sicht, in jedem Fall gesellschaftliches Porträt, autobiografische Erzählung, entführt der Schriftsteller Jules Valles uns in ein Frankreich, welches es so nicht mehr gibt. Unter den Eindruck der Zeitenwende, das Experiment der Pariser Kommune sollte rst Jahre später scheitern, erzählt er von seiner Kindheit, die in Nuancen an die psychische Verlorenheit erinnert, die man später auf der anderen Seite des Kanals in der Figur des Oliver Twists wiederfinden wird.
Doch der Autor hatte Eltern, was es hier nicht besser macht. Deren einzige Erziehungsmaßnahmen schien darin zu bestehen, dem Kind seine Unvollkommenheit, das Kindsein selbst vorzuwerfen. Entlang der eigenen Biografie entwirft der Autor das Bild eines Aufwachsens unter Qualen, eines Kindes, welches um so ungezwungener ist, je weiter es der Recihweite der Eltern entkommt.
Wenn man so möchte, liegt mit „Das Kind“, hier in einer wunderbaren Übersetzung von Christa Hunscha, ein aus heutiger Sicht historischer Coming of Age Roman vor, der sich flüssig lesen lässt. Die Sprache ist klar und ohne Schmirkel. Wo französische Begriffe auftauchen, hilft ein nachgestelltes Glossar. Die Sympathien werden sofort verteilt, vereint der Erzähler doch alle auf sich.
Für die umgebenden Protagonisten ist die Figur des Jacques‘ oft mehr, mal weniger ein lästiges Übel. Frei fühlt sich der Junge. Die größte Freude der Mutter ist es, das Kind zu piesacken. Der Vater gibt Jacques die Schuld für den fehlenden Karriereaufstieg. Von beiden Seiten setzt es Schläge.
So zusammengefasst wirkt das deprimierend, doch Jules Valles bewahrt seinem Protagonisten Neugier und Beobachtungsgabe, Traum und Phantasie, vor allem Hoffnung. So überlebt der Junge den Tag, so alle Lesenden die Seiten, die sonst nur erdrückend wären. Um so bedeudungsvoller erscheinen kleinere Erfolge Jacques‘, die am Ende Früchte tragen, um so witziger wirken einzelne Szenen.
So liest sich schnell, was sonst nur schleppend zu ertragen wäre, auch wenn der Zeitraum eine ganze Kindheit und Jugend, die zu damaliger Zeit, 19. Jahrhundert, schneller zu Ende ging als heute, umfasst.
Das Unglück ist da!
Jules Valles: Jacques Vingtras 1 – Das Kind
Wer liest hangelt sich entlang der Schilderungen aus der Sicht des Protagonisten, Sinnbild für das Gute und Reine.
Die Eltern sind der klare Gegenpol, mit überkommenen und aus der Zeit gefallenen Vorstellungen, die den Betrachtungen des Jungen nicht Stand halten können. Jules Valles lässt Jacques die Stationen seiner Kindheit durchlaufen, erzählt schlüssig. Lücken und unlogische Brüche existieren in diesem Format nicht. Die Erzählung kommt kompakt daher. Ausschweifungen werden vergleichsweise sparsam eingesetzt, dann jedoch besonders betont. Einzelne Sätze stechen heraus.
Man fühlt die Verlorenheit, Hilflosigkeit, später die Entschlusskraft der Hauptfigur, dessen Geschichte so übersetzt, auch gut ins Heute zu übertragen wäre. Jede historische Staubschicht oder Melancholie wurde hier zu Gunsten der Erzählung entfernt.
Das funktioniert, hinterlässt Eindruck. Wer liest, der steht, sitzt neben Jacques, erleidet, erträgt Schläge und psychische Erniedrigung, den kram, den Hass der Eltern, die diesen über das eigene Kind ausschütten. Zart besaite müssen die Lektüre vielleicht das eine oder andere Mal unterbrechen. Lichtblicke für den Jungen gibt es dennoch zur Genüge.
Ein Coming of Age Roman aus einem wechselhaften Epoche in moderner Übersetzung, biografisch angehaucht und Missstände kritisierend, viel steckt in diesen doch überschaubaren Seiten. Doch Valles hat es hier geschafft, das unterzubringen, ohne sich zu vertun. Lesenswert allemal. Kleinere Schwächen ergeben sich aus der Distanz der heute Lesenden heraus.
Wie hätten Erwachsene, wie Kinder in vergleichbaren Situationen heute handeln können? Man ertappt sich dabei, den Protagonisten ein ums andere Mal schütteln zu wollen, als würde das Kind nicht genug körperlich gedemütigt werden, aus damaliger Perspektive ist das jedoch folgerichtig. Macht neugierig auf die weiteren Teile.
Autor:
Jules Valles wurde 1832 geboren und war ein französischer Journalist, Romaschriftsteller und Publizist, sowie Sozialkritiker. Unter den Eindrücken des Deutsch-Französischen Kriegs wurde er 1871 Mitglied der Pariser Kommune, des revolutionären Stadtrats, der gegen den Willen der Zentralregierung versuchte, Paris nach sozialistischen Vorstellungen zu verwalten.
Nach Niederschlagung dieser gelang es ihm nach London zu fliehen. 1880 kehrte er schließlich nach Frankreich zurück, um fortan von seiner publizisitischen Arbeit zu leben. Er starb 1885 in Paris.
Jules Valles: Jacques Vingtras 1 – Das Kind Weiterlesen »