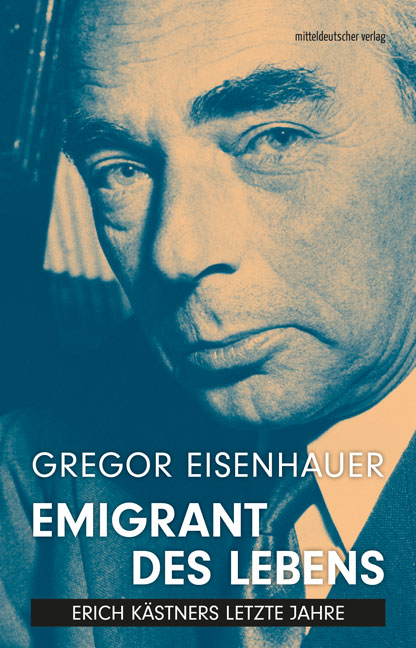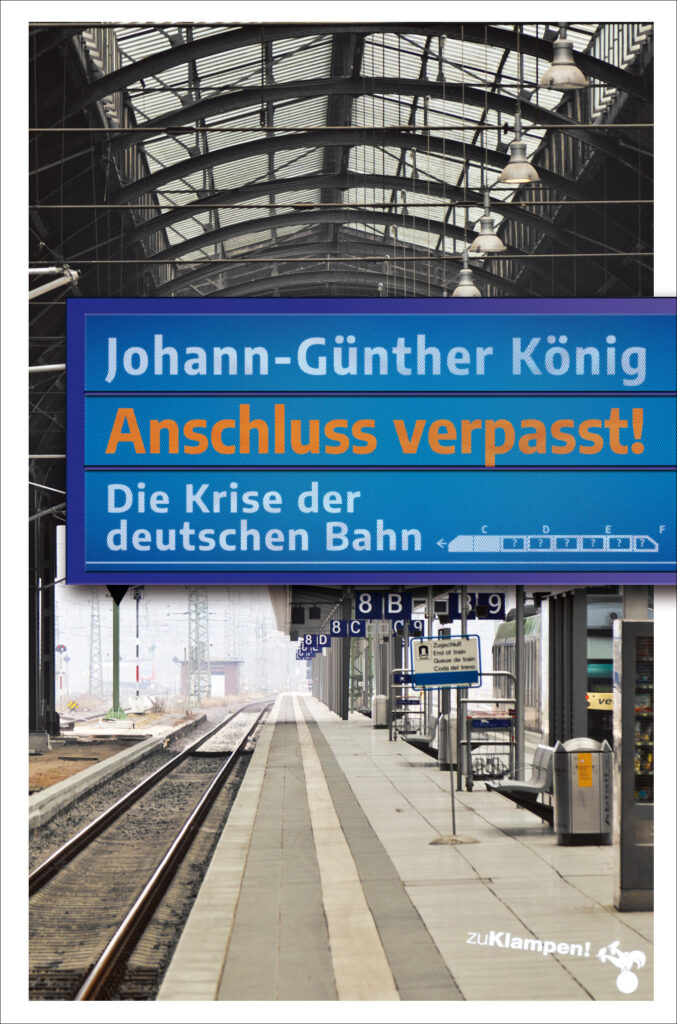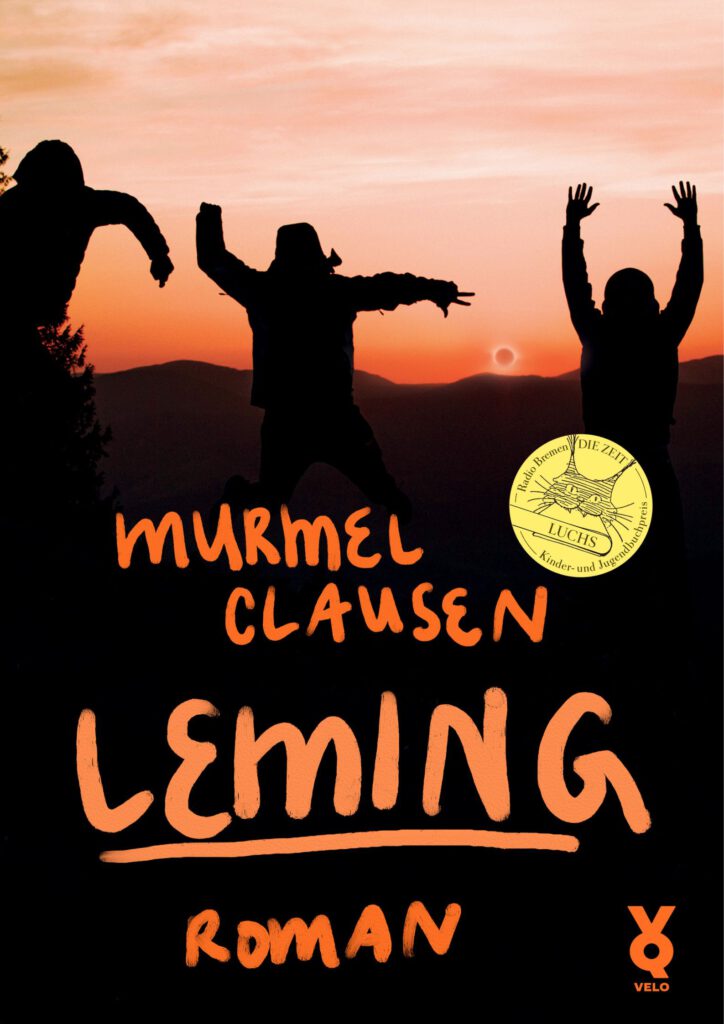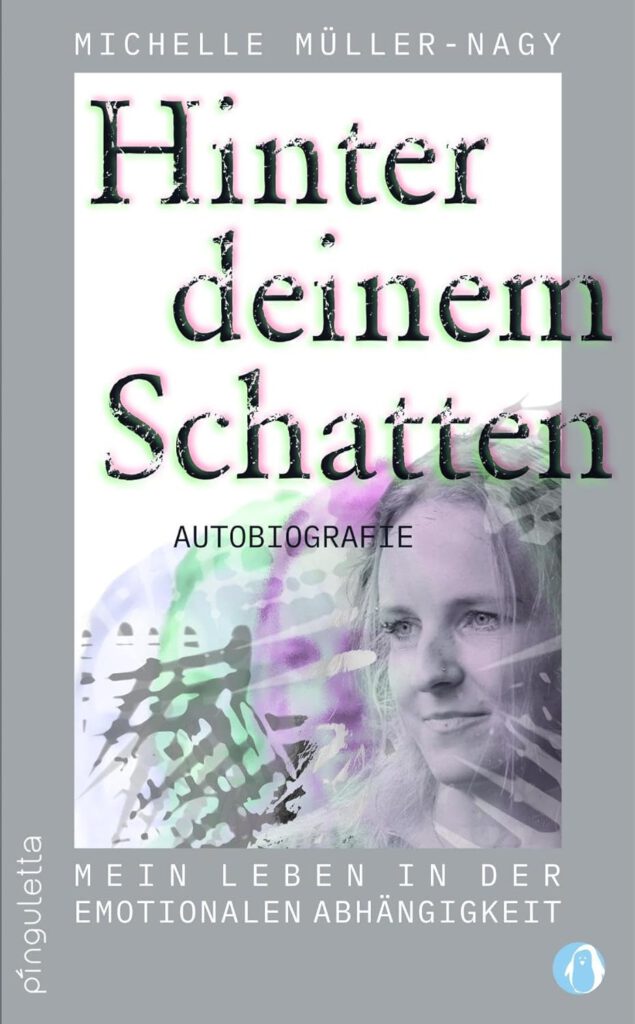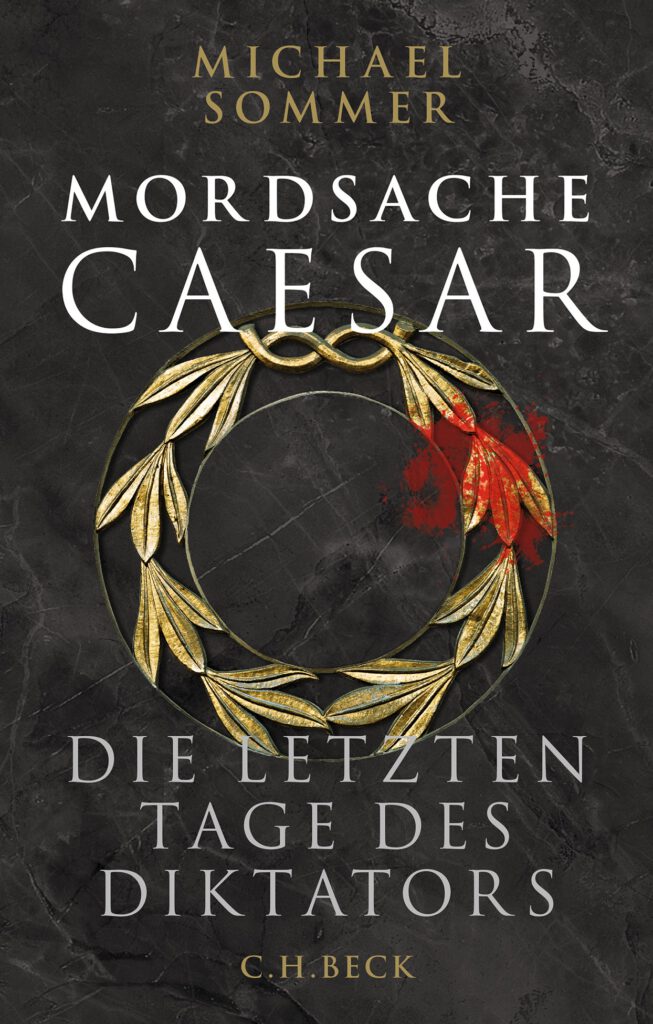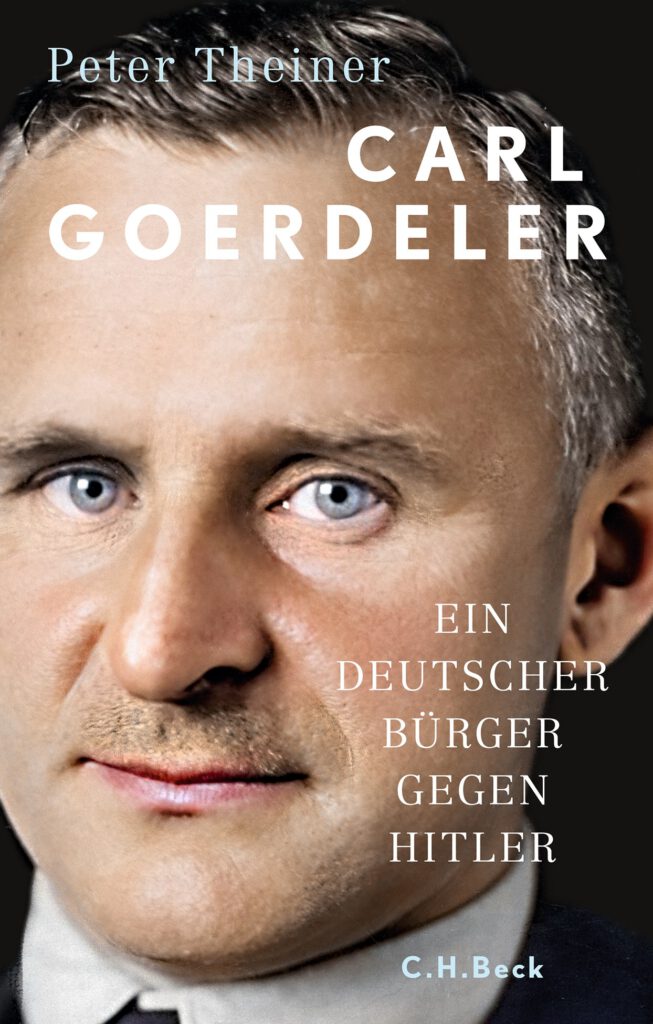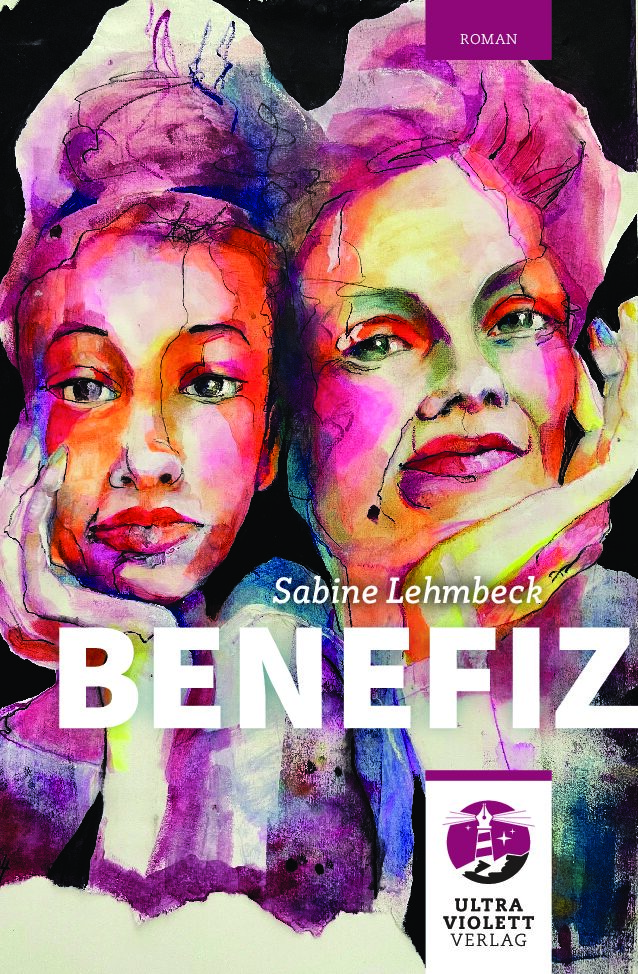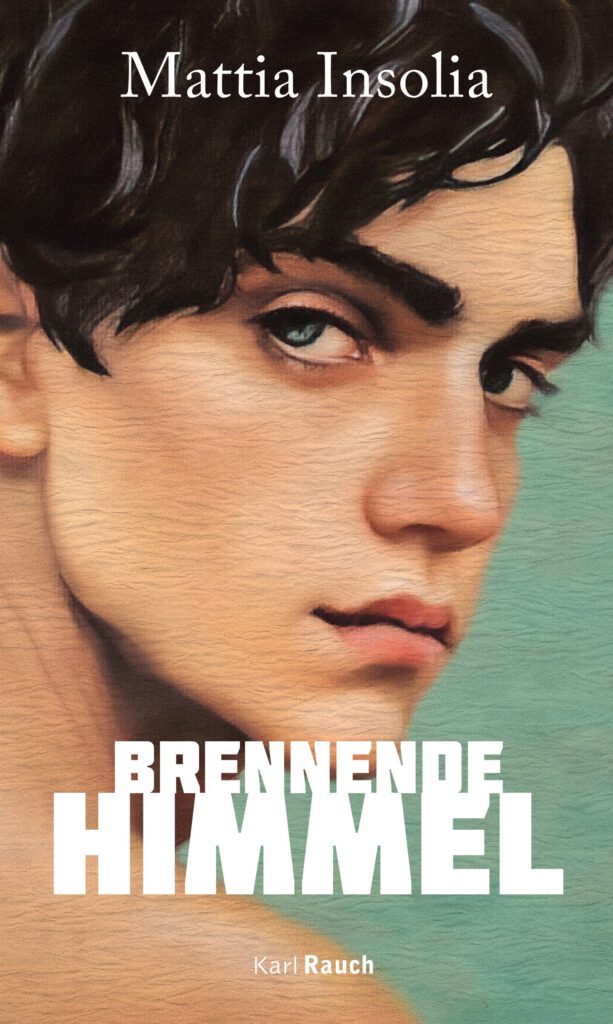Ghassan Kanafani: Das Land der traurigen Orangen
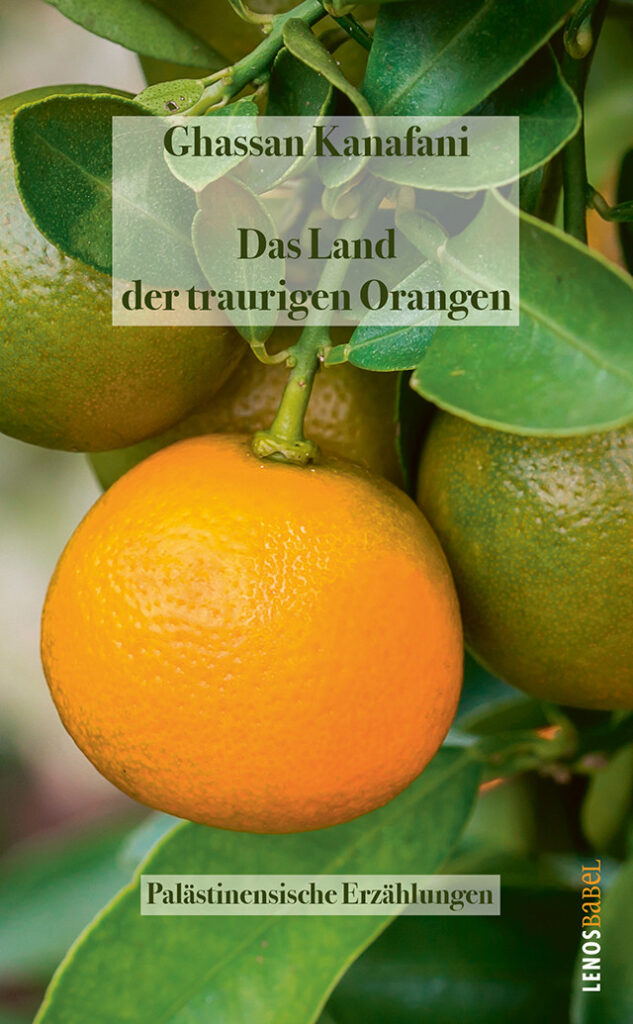
Inhalt:
Das Land der traurigen Orangen lässt Menschen zu Wort kommen, die die Folgen der Gründung des Staates Israel erlebten. Auch der Autor ist einer von ihnen. Ghassan Kanafani war zwölf Jahre alt, als die Familie 1948, während des ersten arabisch-israelischen Krieges, flüchtete und das palästinensiche Volk sich über verschiedene Länder zerstreute.
Mit seinem sensiblen Schreiben, seinem Intellekt und seiner besonderen Wortgewalt trat Kanafani für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser ein. Die thematischen Schwerpunkte der in diesem Band vereinigten Kurzgeschichten sind der Verlust des Landes, der vergebliche Widerstand dagegen, die Vertreibung, die Flucht und das Lagerleben im Exil. (Klappentext)
Rezension:
Gleichsam politische Widerstandsliteratur, dem Leid und der Ausweglosigkeit von Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, so wollte der palästinensiche Journalist und Schriftsteller Ghassan Kanafani seine Texte verstanden wissen. Einige besonders prägnante Schriften sind im vorliegenden Erzählband „Das Land der traurigen Orangen“ versammelt, die das ganze schriftstellerische Können, sowie die politische Wirkmächtigkeit des Autoren aufzeigen.
Um sich den Texten anzunähern, derer dreizehn an der Zahl hier die Lesenden in ihren Bann ziehen werden, benötigt man zunächst kein biografisches Wissen. Der Autor tritt hinter seinen Texten zurück. Es geht um Flucht und Vertreibung, Armut, eine Region im ständigen Ausnahmezustand, schon damals als diese Erzählungen zu Papier gebracht wurden, ein schier unlösbares Knäul an sich potenzierenden Konfliktlinien. Es sind universelle Themen, auf ein Gebiet gemünzt und die Waffe Kanafanis sind seine Worte, die zuweilen wie Peitschenhiebe knallen. Gekonnt setzt er sie ein, jeder Text kompakt. Kein Wort zu viel. Es braucht wenig, die Figuren auszugestalten, die vor den geschilderten Hintergründen lebendig werden. Der Autor weiß Landschaften, wie Personen lebendig werden zu lassen.
Die Nacht ist etwas Furchtbares … Die Finsternis, die sich nach und nach auf uns herabsenkte, erfüllte mein Herz mit Schrecken … […] Doch niemand war da, mich zu trösten, zu niemandem konnte ich mich flüchten, und der stumme Blick meines Vaters flösste mir noch mehr Furcht ein.
Ghassan Kanafani: Das Land der traurigen Orangen
Die Protagonisten sind Figuren des Alltags. Nachvollziehbar sind der Lehrer, der schuhputzende Junge, der eine Maske den Tag über trägt, um durchhalten zu können und für seine Familie zu sorgen, die Bäuerin, der der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Zusammen ergibt sich ein buntes Tableau der Protagonisten. Beinahe jede Geschichte könnte sich so oder ähnlich tatsächlich abgespielt haben. Der Journalist, der hier zum Schriftsteller wird, beobachtet, begleitet.
Doch kommt man auch lesend nicht umhin, in den Konflikt Stellung zu beziehen. Ghassan Kanafani schrieb aus dem eigenen Erleben heraus, kennt beispielsweise die Strapazen eines Flüchtlingdaseins, trat jedoch auch politisch als Sprecher der Terrororganisation Volksfront zur Befreiung Palästinas auf und wurde 1972 dafür durch eine Autobombe getötet, die man dem israelischen Geheimdienst Mossad zuschreibt. Schwankend zwischen Novelle und Fabel bestimmen Symbole wie die Orange, deren Bild immer wieder auftaucht, seine Erzählungen.
Wie wirken mit dem Wissen dann die Texte eines Mannes auf einem, dessen stärkste Waffe die Worte waren, die man schließlich für so gefährlich hielt? Wie wirken die Erzählungen mit der Spanne der vergangenen Zeit, in dessen Gegenwart eine Lösung des Konflikts mehr denn je unerreichbar scheint? Was ist noch übrig von der Mächtigkeit der Erzählungen aus dem Land der traurigen Orangen? Was bleibt, wenn nur noch Texte bleiben? Das Glück mit Kanafani ist, dass seine Schriften fast vollständig in deutscher Übersetzung vorliegen, so dass sich davon ein jeder selbst ein Bild machen kann.
Autor:
Ghassan Kanafani wurde 1936 in Akka, Britisch-Palästina geboren und starb 1972 in Beirut, Libanon. Er war ein palästinensicher Schriftsteller und Jornalist. Seine Familie floh 1948 über den Libanon nach Syrien, wo er in einem Flüchtlingslager lebte und in Damaskus seine Schulbildung beendete. Von 1953 bis 1956 arbeitete er als Lehrer, anschließend als Sport- und Kunstlehrer in Kuwait. In dieser Zeit schloss er sich einer kommunistischen Untergrundgruppe an. 1960 kehrte er in den Libanon zurpck, arbeitete dort als Redakteur für verschiedene nasseristische Zeitungen, 1969 als Chefredakteur der Parteizeitung der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Zudem fungierte er als deren politischer Sprecher 1972 wurde er durch eine Autobombe ermordet.
Folgt mir auf folgenden Plattformen:
Ghassan Kanafani: Das Land der traurigen Orangen Weiterlesen »