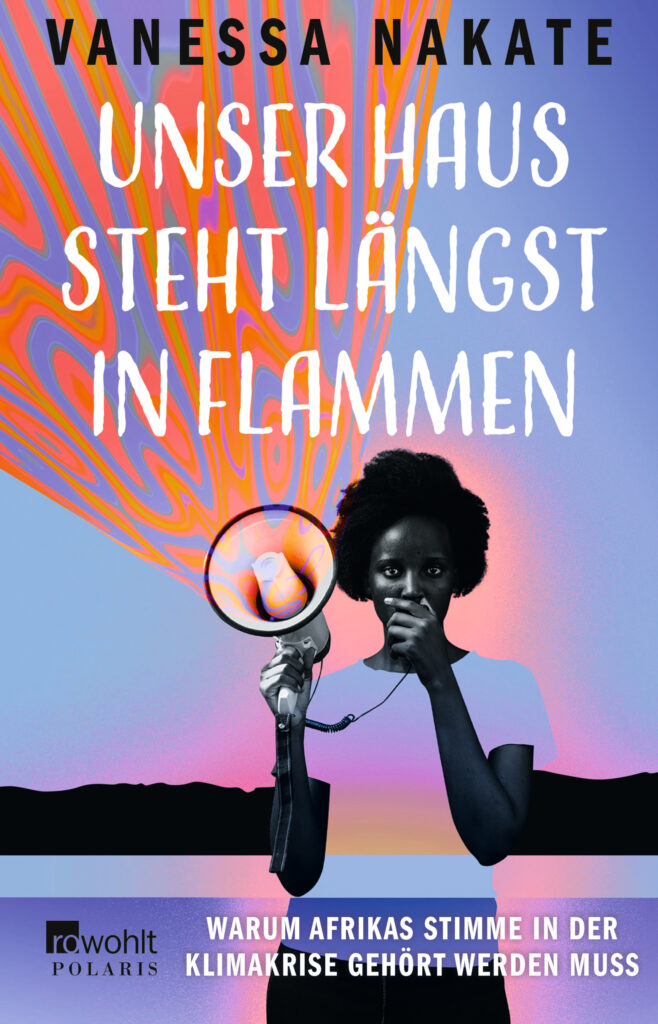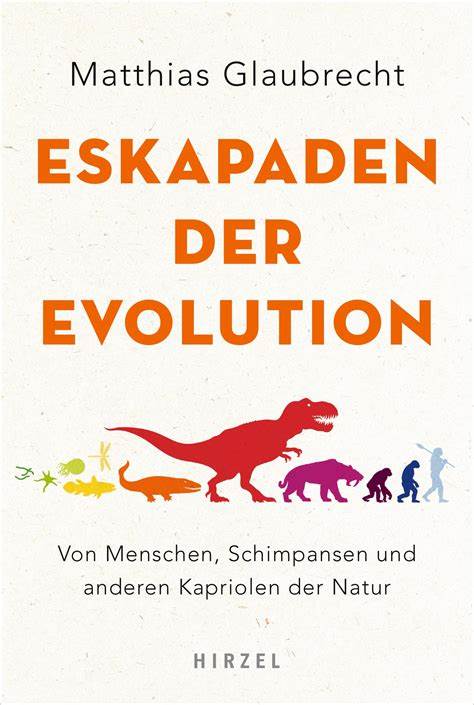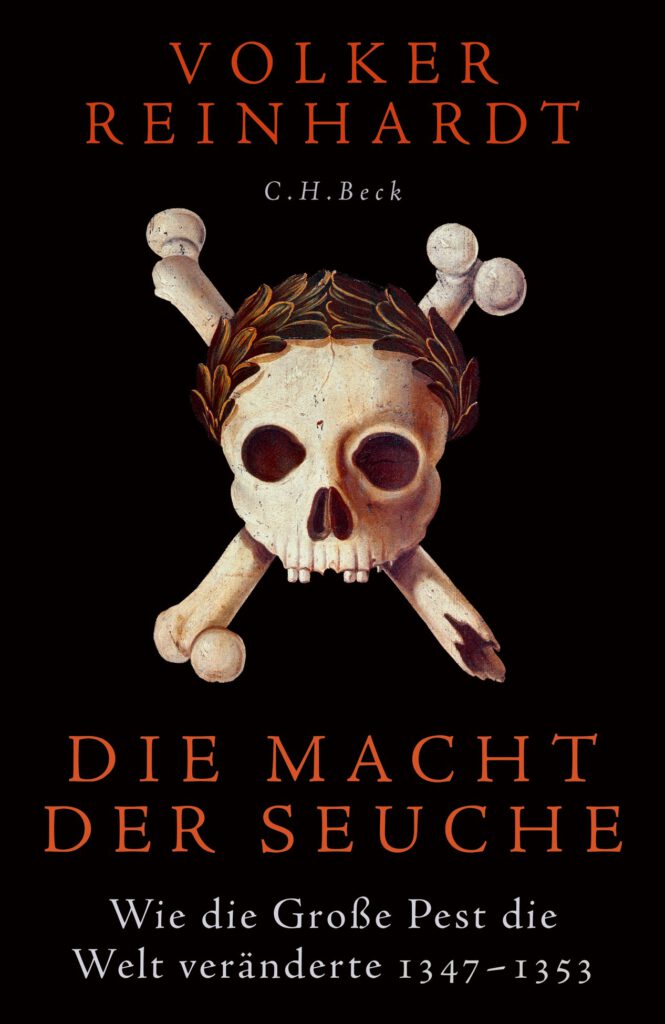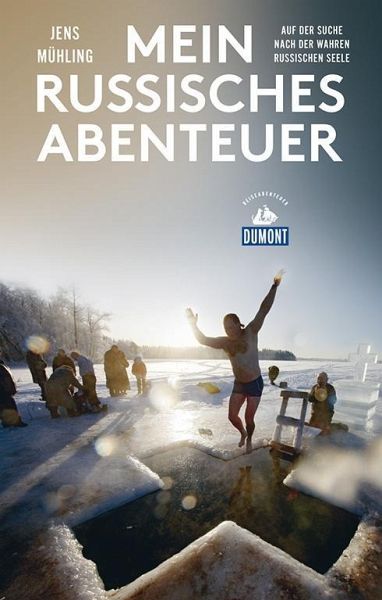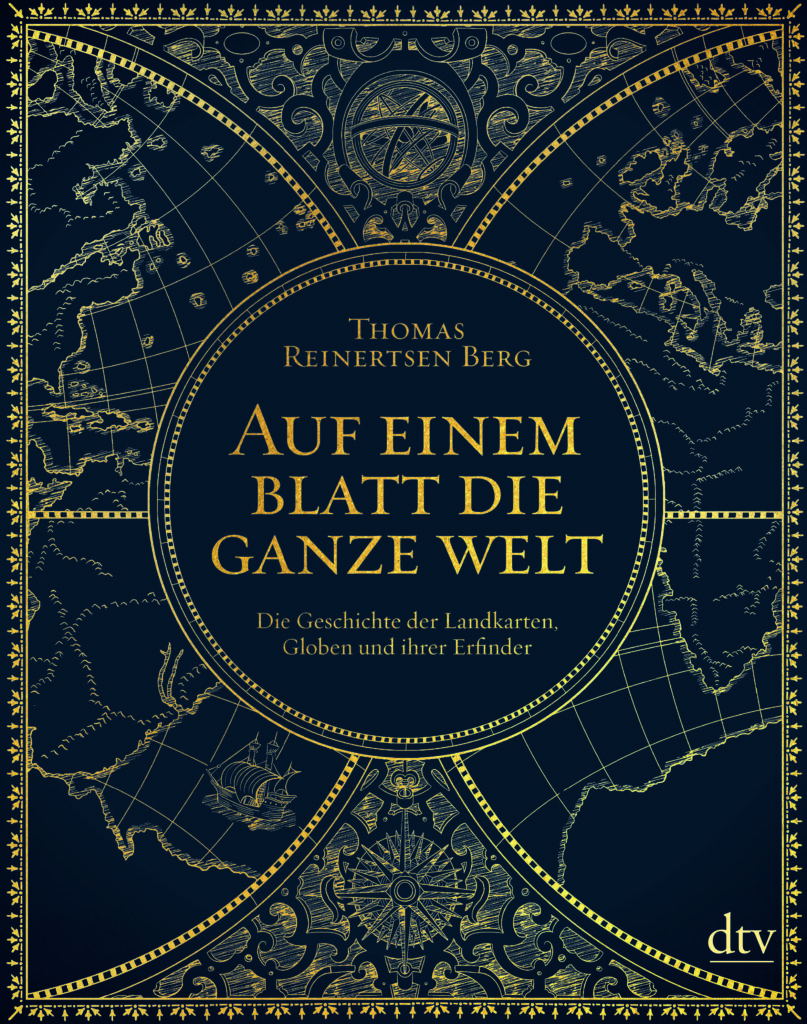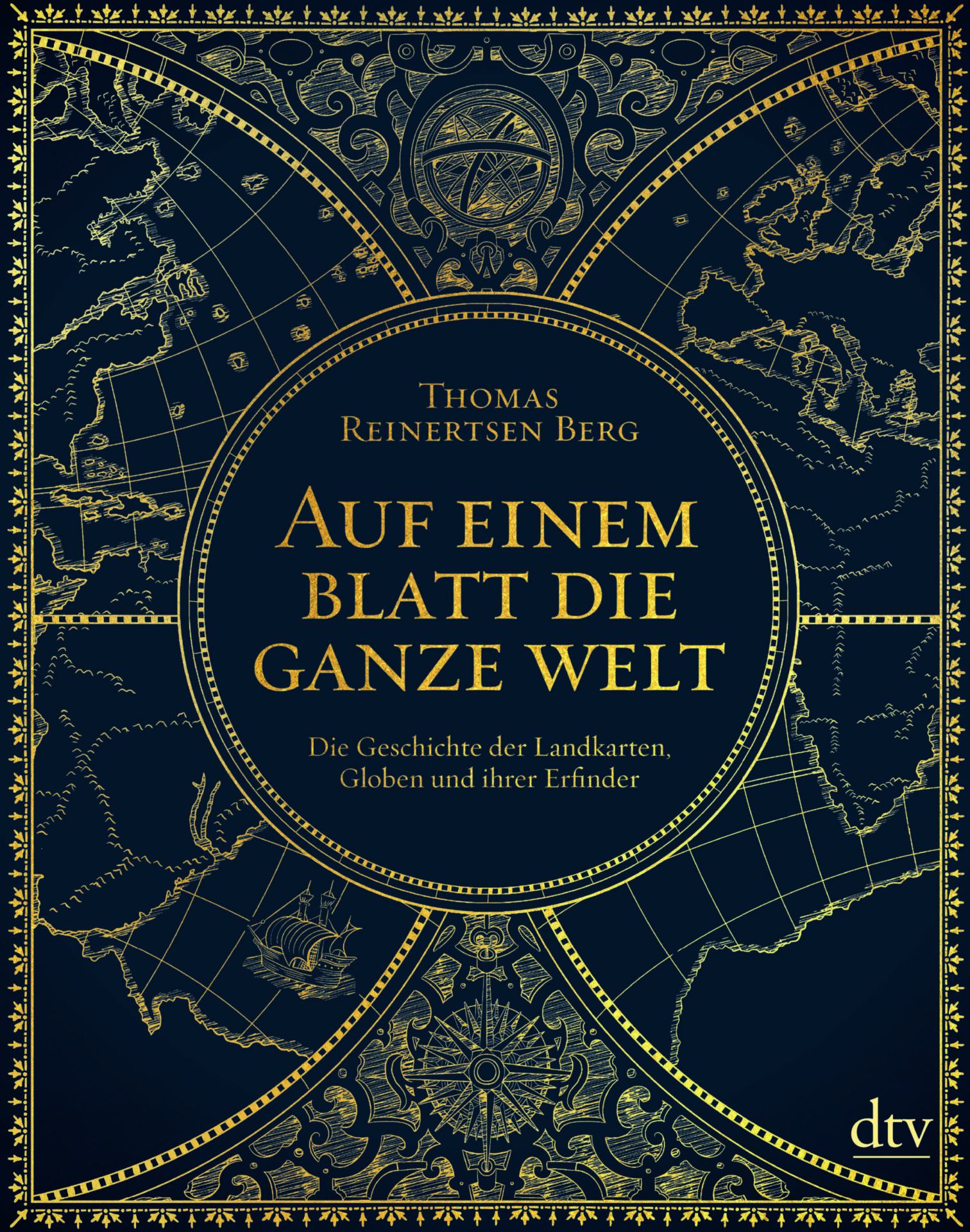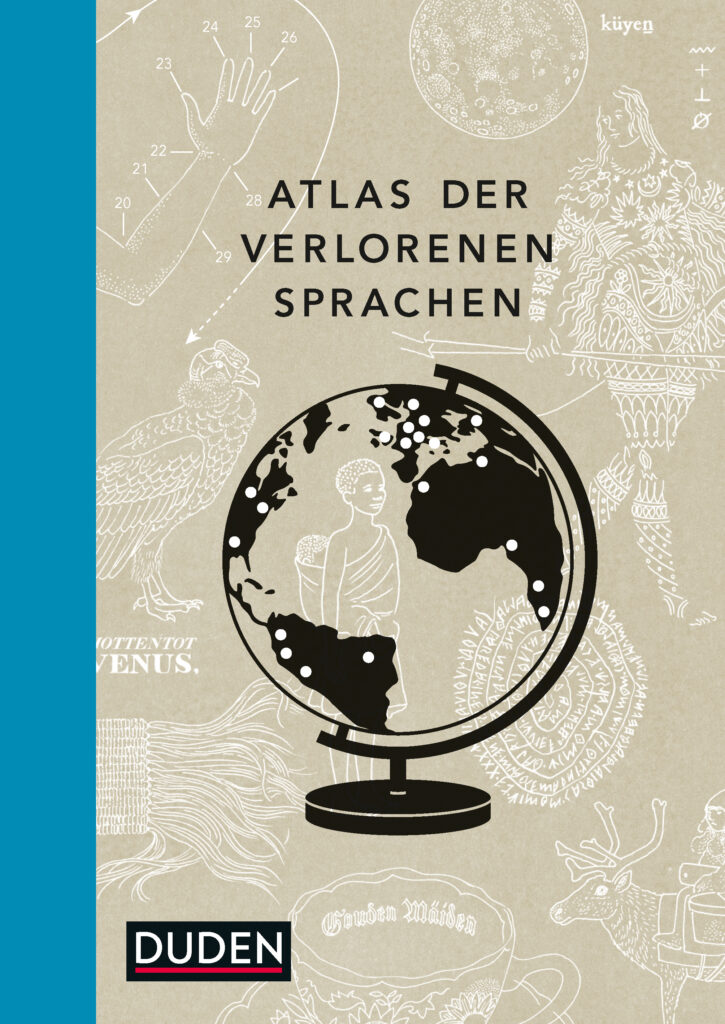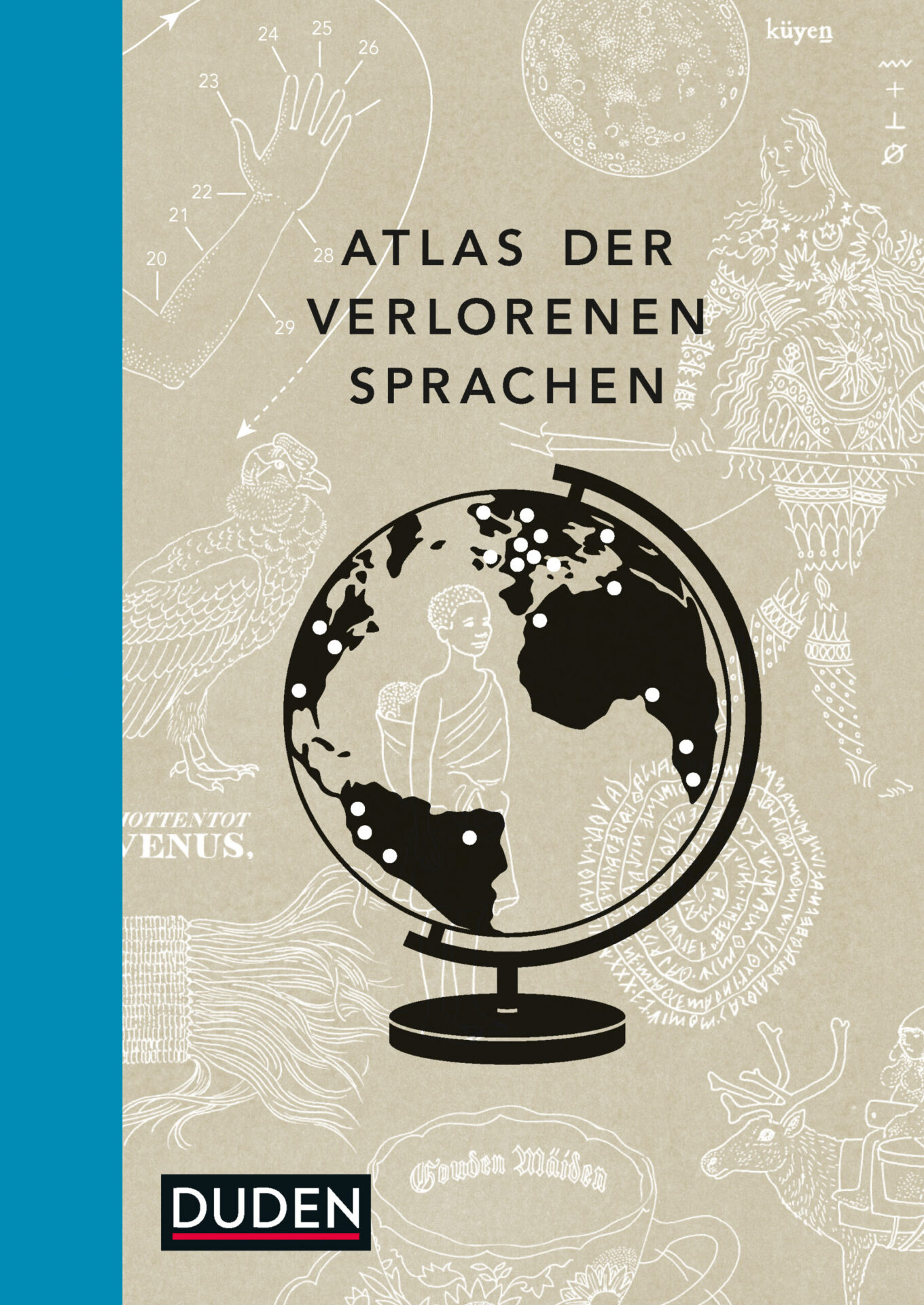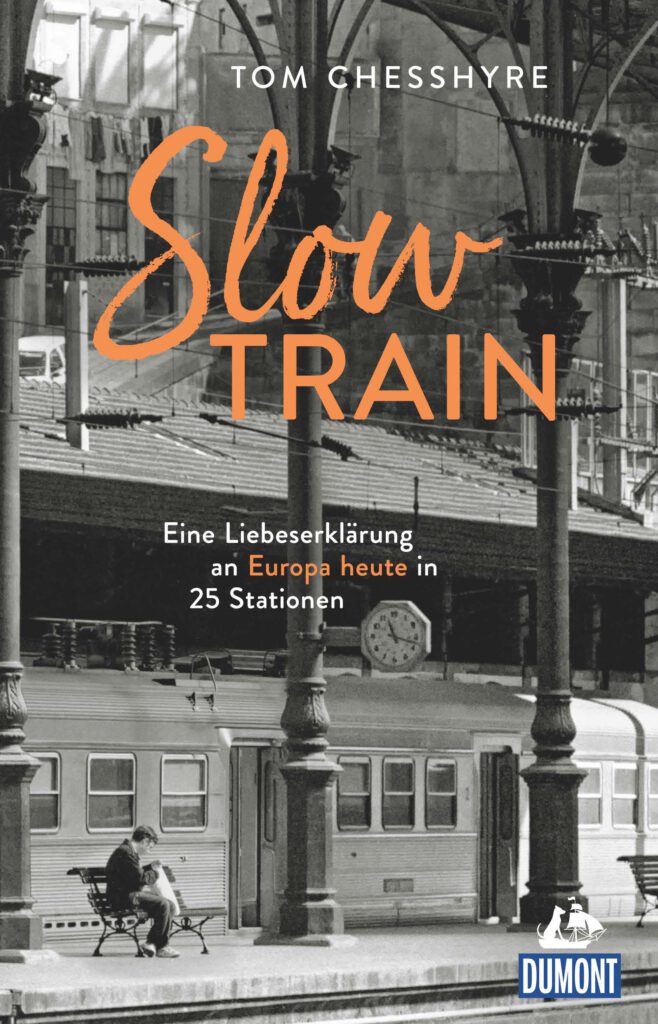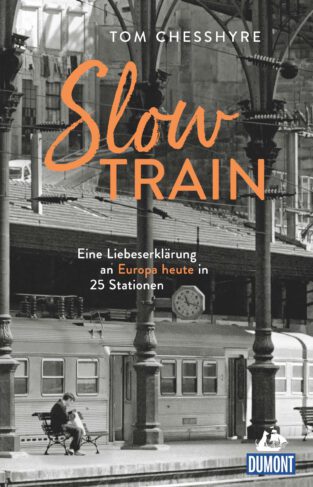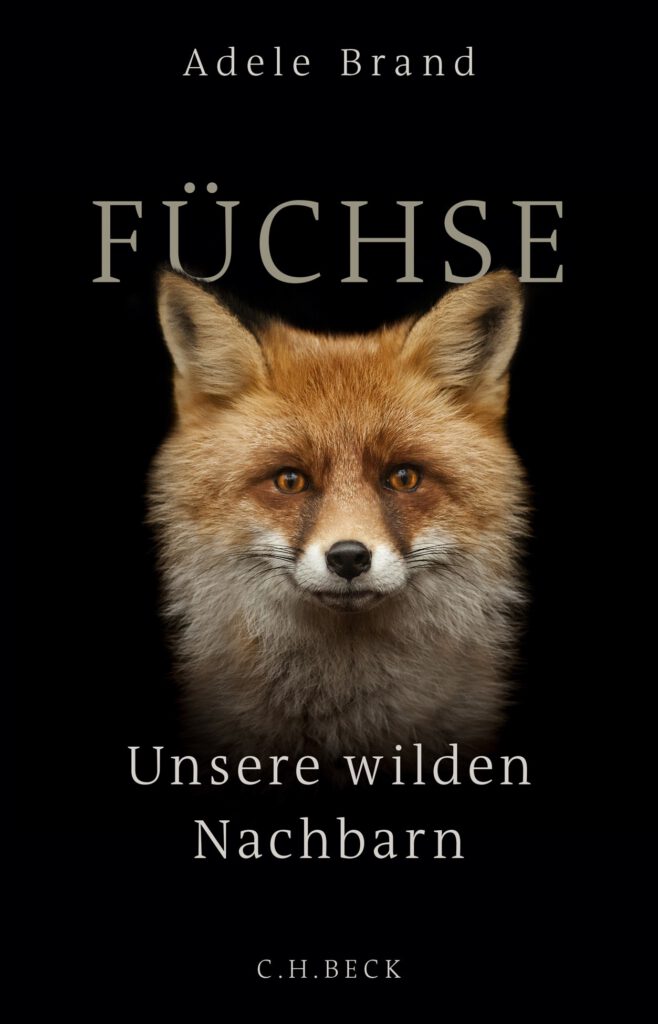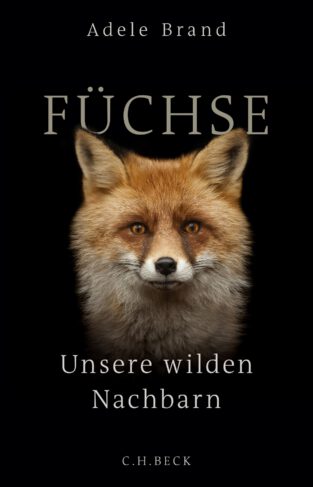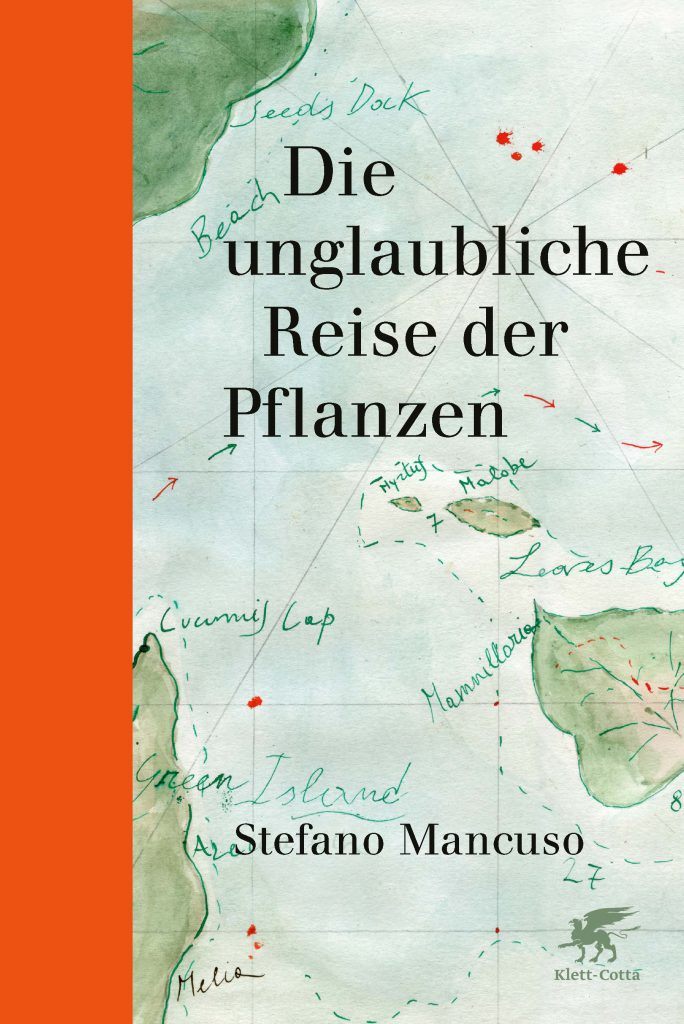Bernd-Stefan Grewe: Gold – Eine Weltgeschichte
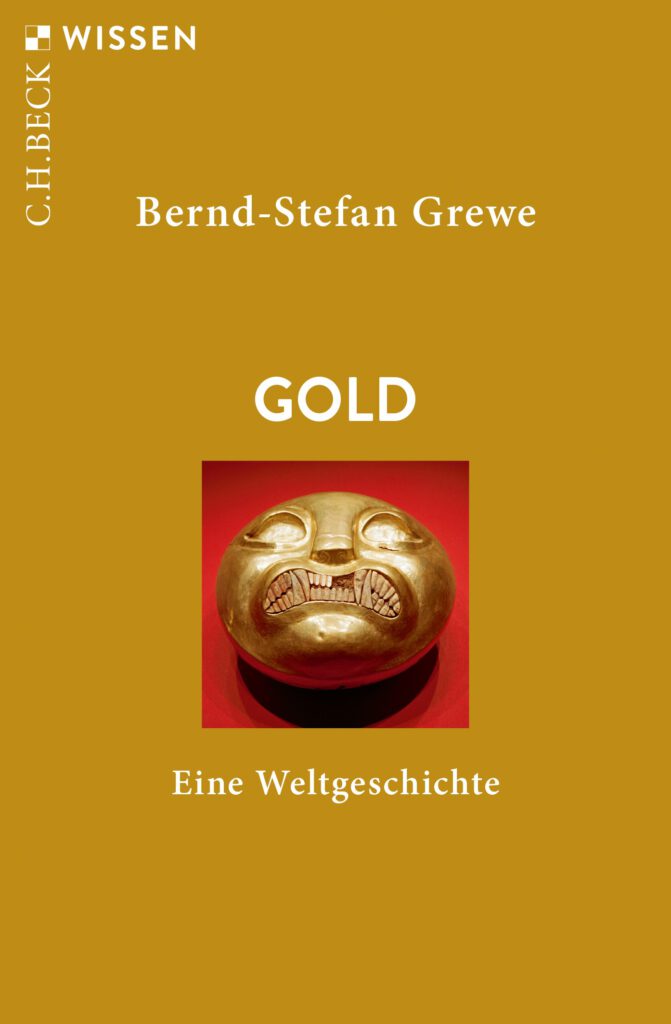
Inhalt:
Die ältesten Goldfunde stammen aus Gräbern des 5. Jahrtausends v. Chr. – das edelste Metall als letzte Gabe für die wichtigsten Persönlichkeiten einer Gesellschaft. Seit der Zeit der frühen Hochkulturen hat Gold nichts an Faszinationskraft eingebüßt. Es begegnet uns bis heute als Schmuck, liturgisches Gerät und auch als Zahlungsmittel. Bis vor kurzem diente es sogar als Garant ganzer Währungssysteme. Aber am Gold klebt immer auch Blut – was für die Tage des Goldrauschs galt, gilt auch noch für die Goldförderung der Gegenwart. (Klappentext)
Rezension:
Dagobert Duck machte als Goldsucher am Klondike ein Vermögen und wurde so zur reichsten Ente der Welt. Die vom Zeichner Carl Barks erfundene Comicfigur steht sinnbildlich für die zahlreichen Abenteurer, die ihr Glück zu Zeiten des großen Goldrauschs in Nordamerika versuchten. Nur wenige waren damit wirklich erfolgreich, der Erzähler Jack London erst mit seinen Geschichten, in denen er auch seine eigenen Erlebnisse zu Teilen mit verarbeitete und für die Nachwelt lebendig erhielt. Noch früher erstickte die Gier nach dem Edelmetall ganze Völker, Kriege wurden geführt.
Das glänzende Metall war seit grauer Vorzeit schon begehrt und konfliktumwoben. Heute noch walten darum herum zahlreiche Konflikte, nicht zuletzt die bleibende Zerstörung der Natur, die mit den Abbau des Gold einher geht. Der Historiker Bernd-Stefan Grewe begab sich auf Spurensuche durch die Geschichte, von den Zeiten erster glänzender Grabbeigaben, über die Rolle des Metalls in Währungssystemen bis hinein, in die heutige Zeit.
Wer sich schnell Überblickswissen verschaffen möchte, eine solide und gut recherchierte Grundlage, ist mit den Büchern der Riehe C. H. Beck Wissen gut bedient. Ohne sich in allzu viele Details zu verlieren, schauen die Autoren und Autorinnen hier durchaus über den tellerrand und so liefert auch Bernd-Stefan Grewe eine informative Übersicht zur Thematik, die man fortan, vielleicht nicht mit anderen Augen, so doch solide unterfüttert betrachten kann.
Dabei hat er die Geschichte des Edelmetalls spannend zu Papier gebracht und so aufgebaut, dass dieser Band nicht so schnell von den Veränderungen unserer Zeit überholen wird. Jedes Kapitel ist unterteilt in kleinere Abschnitte, aufgelockert mit mehreren Grafiken, die zur Veranschaulichung dienen. Zahlreiche Quellen- und Querverweise runden die Lektüre ab. Man kann dies auch auf die anderen Bände der Reihe übertragen, der Autor schafft hier das Format nicht trocken daherkommen und einen Blick über den Tellerrand hinaus gewähren zu lassen.
Autor:
Bernd-Stefan Grew ist Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Tübingen. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bevor er 1990 Geschichte, Französisch und spanisch in Trier und Paris studierte. Im Jahr 2000 promovierte er in Geschichte. Nach zahlreichen Stationen folgte 2016 der Ruf an die Universität Tübingen. Er ist Autor und Verfasser zahlreicher Publikationen.
Bernd-Stefan Grewe: Gold – Eine Weltgeschichte Weiterlesen »