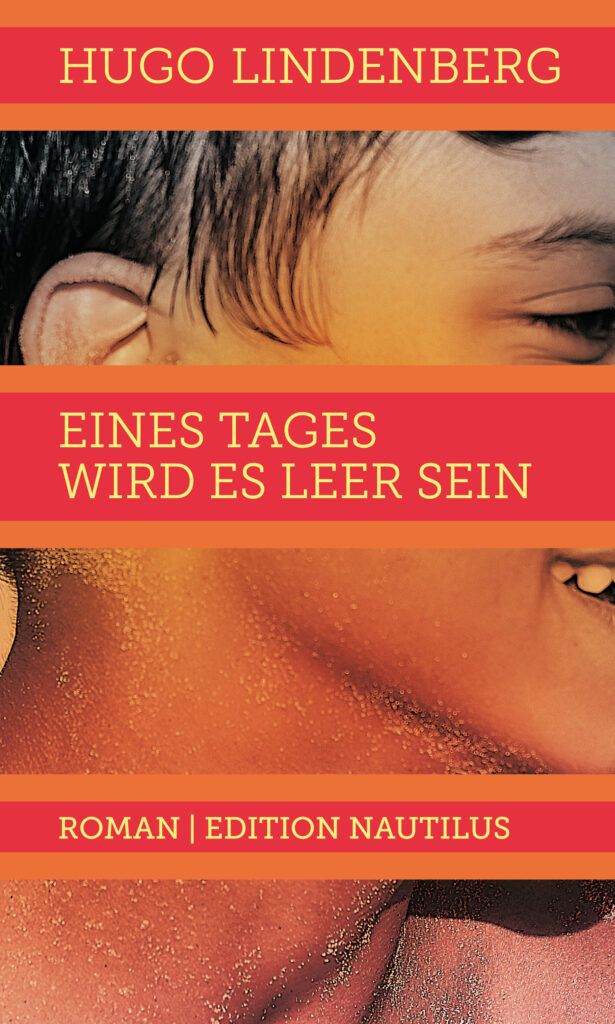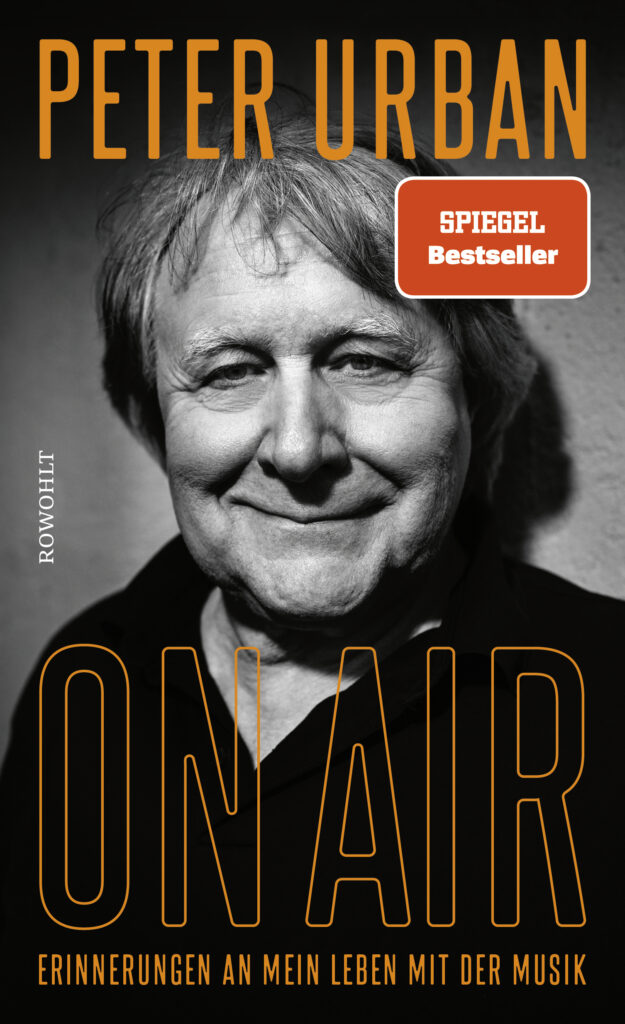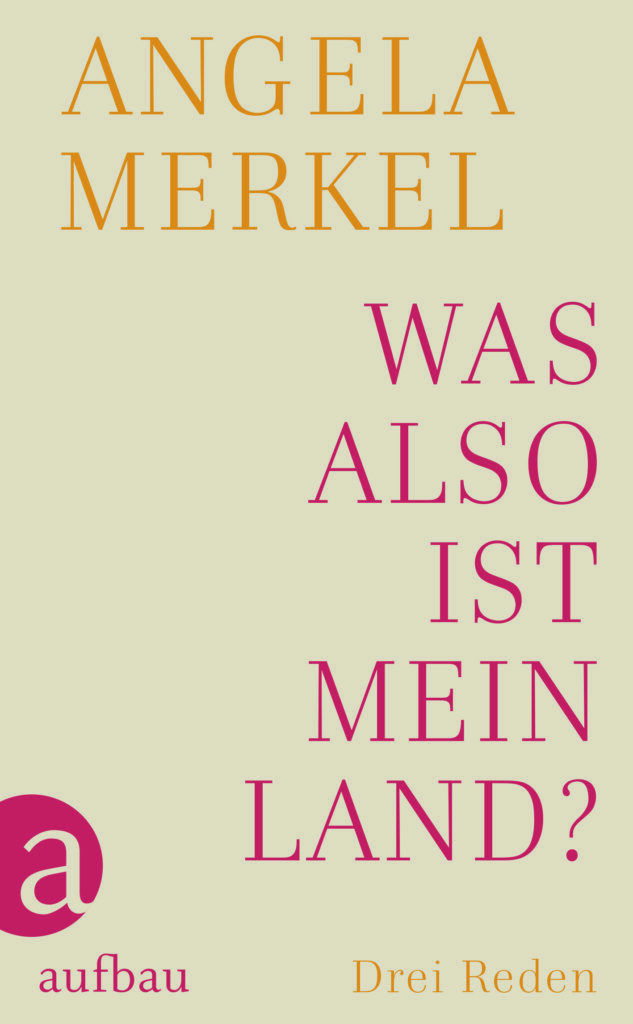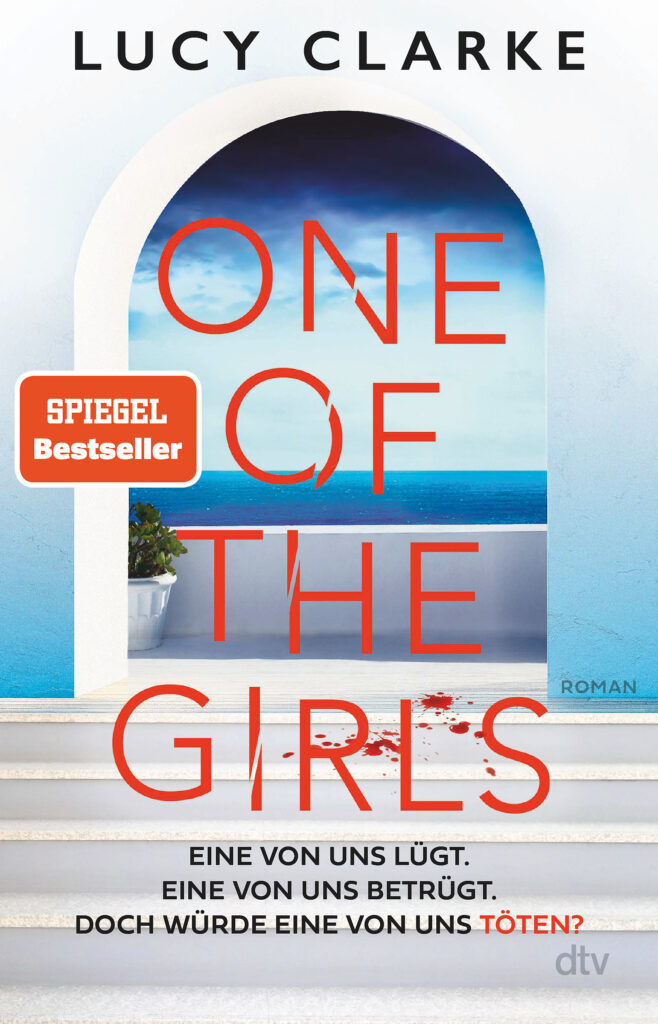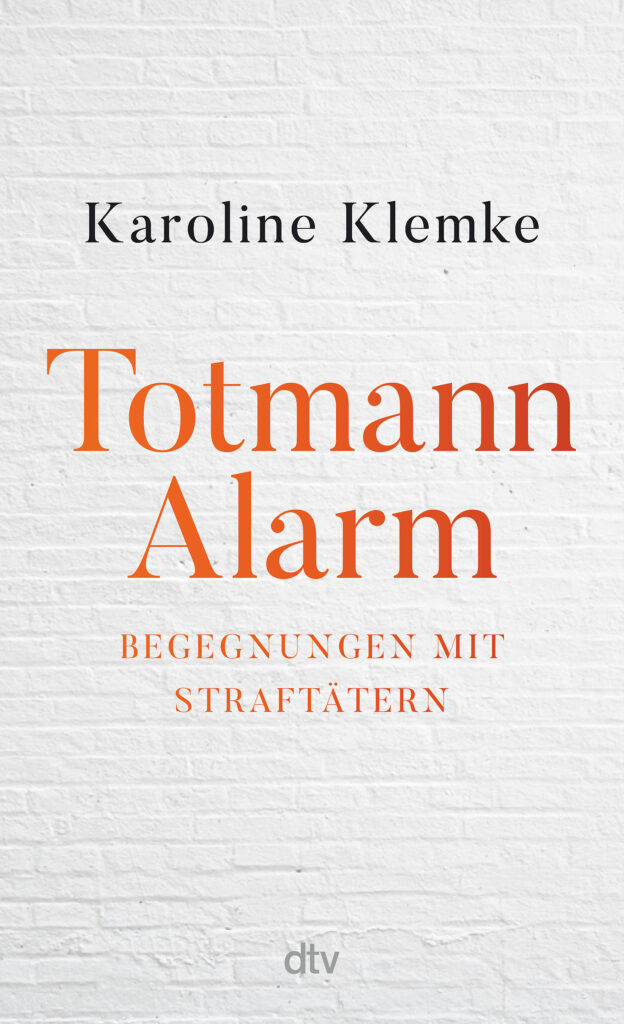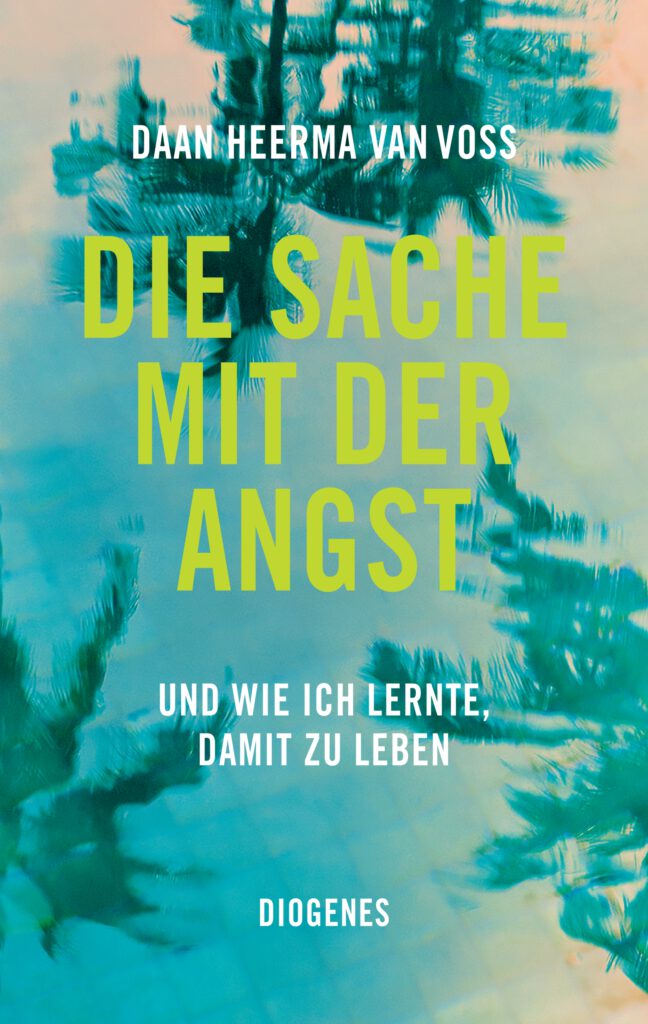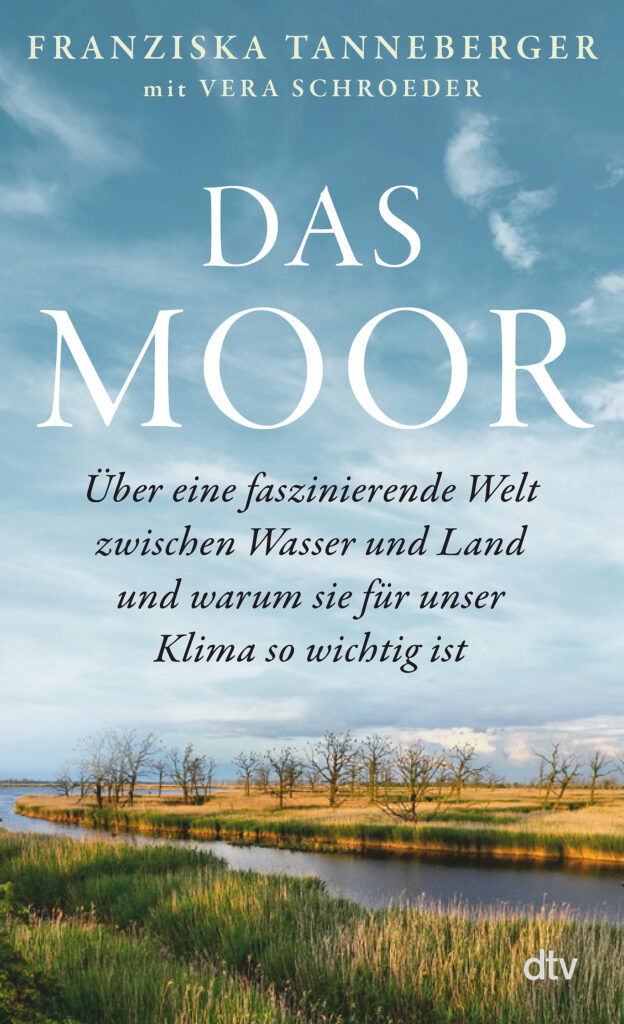Tatsuo Hori: Der Wind erhebt sich
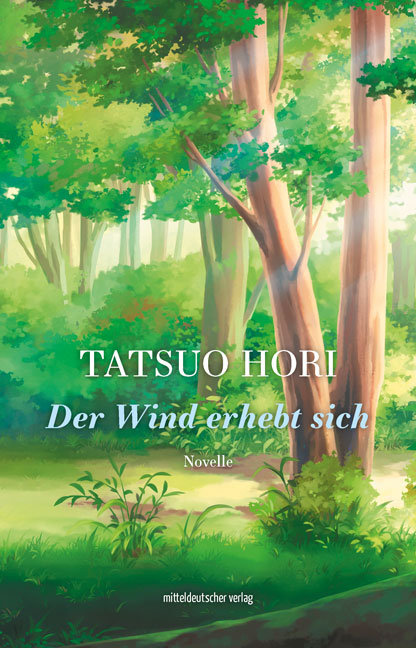
Inhalt:
Die zwischen 1936 und 1938 entstandene Novelle „Der Wind erhebt sich“, betitelt nach einem Gedicht von Paul Valery, beschreibt die platonische Liebe des Ich-Erzählers zu seiner an Tuberkulose erkrankten Verlobten Setsuko. Ihre vom Tod überschattete, kurze Liason verleben sie größtenteils fernab der Gesellschaft in einem Lungensenatorium in den Bergen. Beruhend auf den persönlichen Erfahrungen schildert Tsatsuo Hori mit feinem Gespür die Psyche der beiden Protagonisten und ihre ambivalente Beziehung, was in der lyrischen Darstellung der Umgebung im Wandel der vier Jahreszeiten eine äußere Entsprechung findet.
Mit der Novelle „Der Wind erhebt sich“ kann das Lesepublikum hierzulande eine der wichtigsten japanischen Kostbarkeiten des 20. Jahrhunderts nun erstmals auf Deutsch für sich erlesen und eine Tür in eine fremde und doch seltsam nahe Gedankenwelt öffnen. (Klappentext)
Rezension:
Im Vergleich zu anderen Region begegnet uns Japan zumindest literarisch noch sehr dosiert. Um so interessanter sind Erst- und Neuübersetzungen, die jetzt nach und nach auch hier eine Leserschaft gewinnen. Darunter nun eine kleine zarte Novelle, die mit wenig Worten auskommt, jedoch eine sehr besondere Wirkung entfaltet. Die Rede ist von „Der Wind erhebt sich“, aus der Feder des japanischen Schriftstellers Tatsuo Hori, der sich auf sehr einfühlsame Art und Weise mit dem Loslassen und dem Tod beschäftigt.
Die kleine Novelle beginnt inmitten der Natur die Lesenden auf eine Reise durch das Jahr mitzunehmen. Zwei Menschen treffen aufeinander, vom Erzähler selbst erfährt man wenig, überhaupt werden Informationen sehr dosiert und gezielt eingestreut, dennoch hat man sofort ein klares Bild vor Augen. Das Glück der beiden Protagonisten scheint oberflächlich nur von kurzer Dauer, doch im Angesicht des Fortschreitens der Krankheit gewinnt der Zusammenhalt und das Beisammensein Konturen, die die kompakte Erzählung tragen.
Betont zurückhaltend baut Hori die Welt einer Beziehung auf, die, wären die Protagonisten gesund, nur ein Aufeinanderzustreben kennen würde, doch fühlt der Erzählende seine Liebe im Verlauf immer mehr entfliehen. Im Wissen um das baldige Ende versucht der Protagonist die gemeinsame Zeit festzuhalten und kann doch dem Schicksal nicht entkommen.
Sehr poetisch wirkt das zu weilen. Zeile für Zeile verrinnt zwischen den Fingern. Schnell ist man inmitten der Geschichte, fühlt sich als danebenstehender Beobachtende. Der erzählte Zeitraum umfasst dabei nur wenige Monate. Der Autor hat hier einen Spagat zwischen gemächlich wirkender Sprache und doch schnellem Erzähltempo geschaffen. Der Titel alleine lässt bereits zu Beginn den Ausgang erahnen.
Neben der Ausarbeitung der Protgaonisten, von denen man nur das Notwendige erfährt, liegt die Stärke der Novelle vor allem in Orts- und Landschaftsbeschreibungen, die sofort Bilder im Kopf entstehen lassen. Auch ein Fenster in die Gefühlswelt der sonst so zurückhalenden Japaner wird geöffnet, das bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, was an sich schon hervorzuheben ist. Zudem bringt der Autor ein Teil seiner eigenen Biografie mit ein, nimmt seinen Weg vorweg.
Der Fokus liegt auf die zwei Hauptfiguren, die klar gezeichnet werden. Andere werden kaum erwähnt. Sie spielen schlicht und einfach fast keine Rolle im Zusammenspiel der Protagonisten, bleiben daher bewusst blass. Beschrieben werden eine Liebe ohne Zukunft, formvollendete Hingabe, Loslassen und Verarbeitung. Ziemlich viel für wenig Seiten, was leicht hätte misslingen können. Alleine, hier funktioniert es. Kein Wort ist zu viel, Auslassungen wurden bewusst gesetzt. Die behutsame Übertragung von Sabine Mangold ins Deutsche hat das Übrige dazu beigetragen, damit die Novelle auch bei uns ihre Wirkung entfalten kann.
Die erzählende Figur weiß von Beginn an um den Ausgang, während das Gegenüber gleichsam zum Symbol, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte wird, die einfach nur berührt. Die Erzählung in Form einer Art Tagebuch gehalten, wird dadurch aufgelockert und gewinnt zugleich an Bedeutung. Absätze zwingen einem, dies vergleichsweise langsam zu lesen, ab und an innezuhalten.
Der Aufbau einer persönlichen Katastrophe, die Beschreibung der Unausweichlichkeit ist das, was diese Novelle ausmacht, zudem die Zustandsbeschreibung der Abgeschiedenheit in Angesicht des Todes. Das kann nur berühren, zudem wenn man um die Geschichte des Autoren weiß, der selbst an Tuberkulose litt, jedoch aus der Position der Angehörigen heraus schrieb. Beinahe so, als wollte Hori etwas Tröstendes hinterlassen.
Sehr poetisch werden Bilder aufgebaut, die einem so schnell nicht mehr loslassen. Diesen Stil muss man mögen, eröffnet jedoch einen Blick in diese damals doch sehr geschlossen wirkende Gesellschaft Japans. Die beschriebene Zurückhaltung funktioniert in diesem Setting sehr gut, wäre verbunden mit anderen Ortsbeschreibungen nicht ganz so glaubwürdig. Die charakterliche Stärke beider Protagonisten tut ihr übriges dazu bei.
Nur ein paar kleine Szenen brechen den Lesefluss und wirken so, als hätte der Autor zwischendrin noch das Gefühl gehabt, noch ein paar Zeilen mehr füllen zu müssen. Das ist jedoch Jammern auf hohem Niveau. Nichts destotrotz kann ich jedem empfehlen, ein paar Stunden mit dieser schönen Novelle, die wohl auch als Anime verfilmt wurde, zu verbringen.
Autor:
Tatsuo Hori wurde 1904 in Tokio geboren und war ein japanischer Übersetzer und Schriftsteller. Zunächst studierte er Japanische Literatur, verfasste während seines Studiums Übersetzungen französischer Dichten und schrieb für die Literaturzeitschrift Roba. 1930 erhielt Hori Anerkennung für seine Kurzgeschichte Sei kazoku (wörtlich „Die heilige Familie“) und ließ eine Riehe von Novellen und Gedichten folgen, die sich oft mit dem Tod beschäftigten. Später erkrankte er an Tuberkulose. Diese Erfahrung verarbeitete er in einer weiteren Geschichte. Er starb 1953 in Tokio.
Tatsuo Hori: Der Wind erhebt sich Weiterlesen »