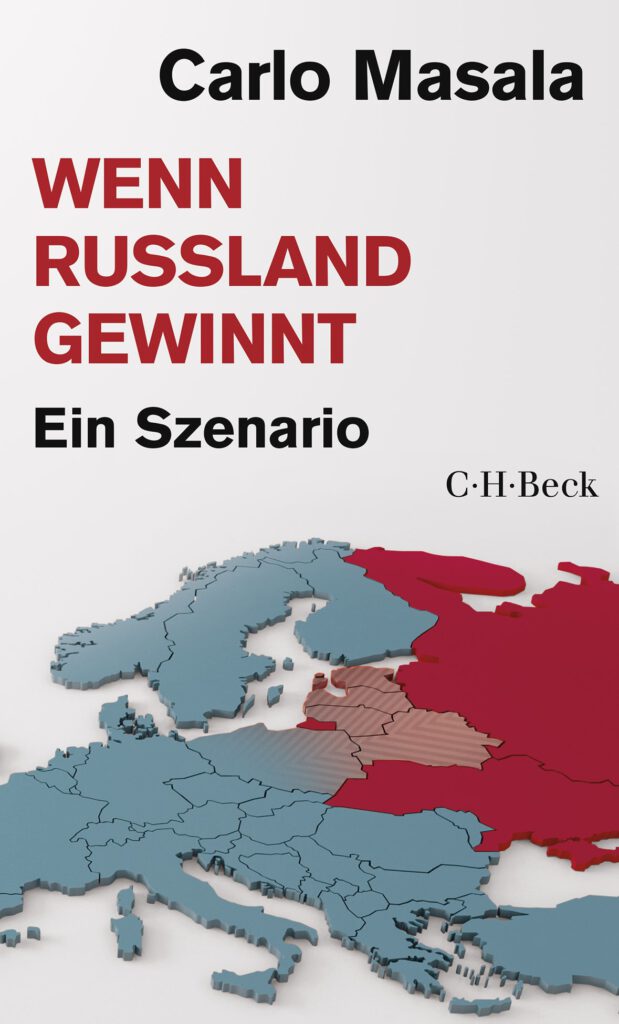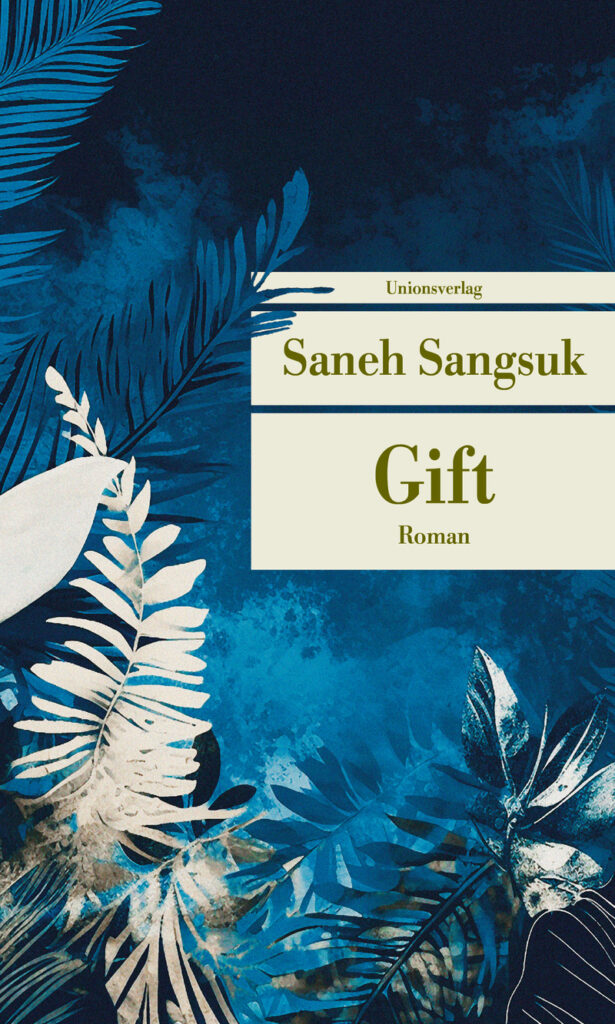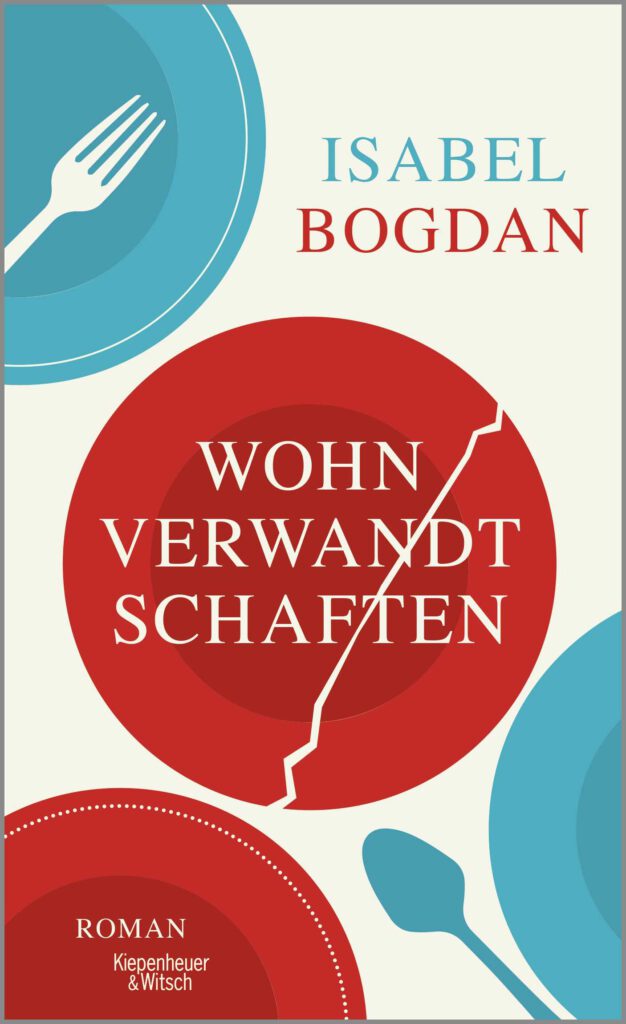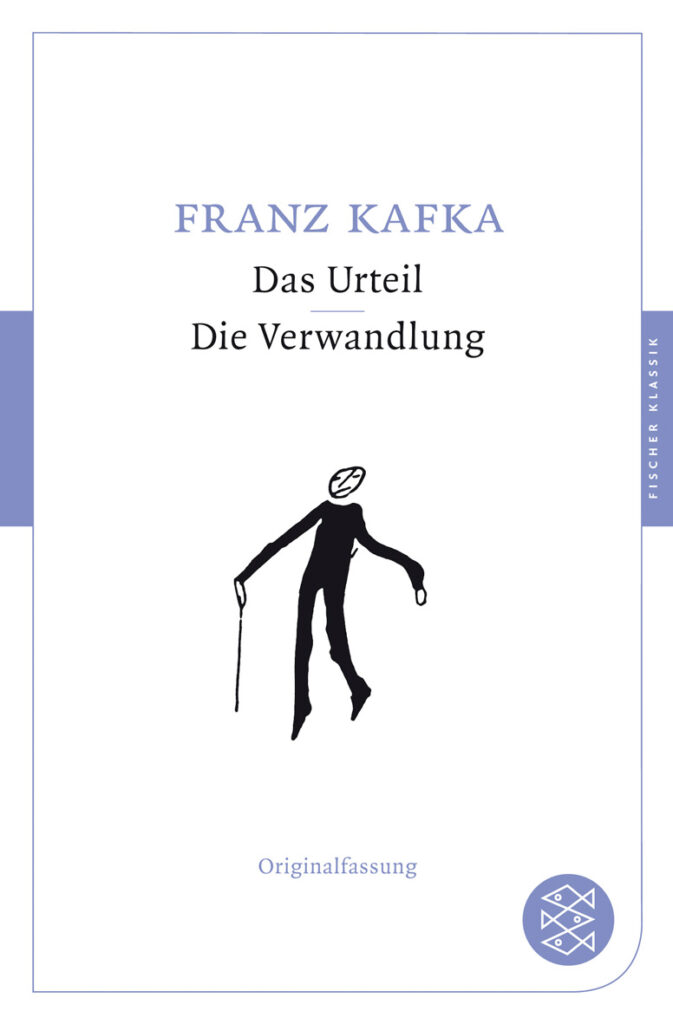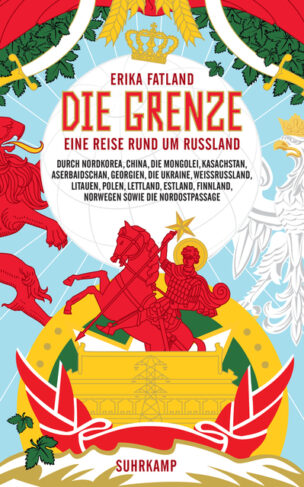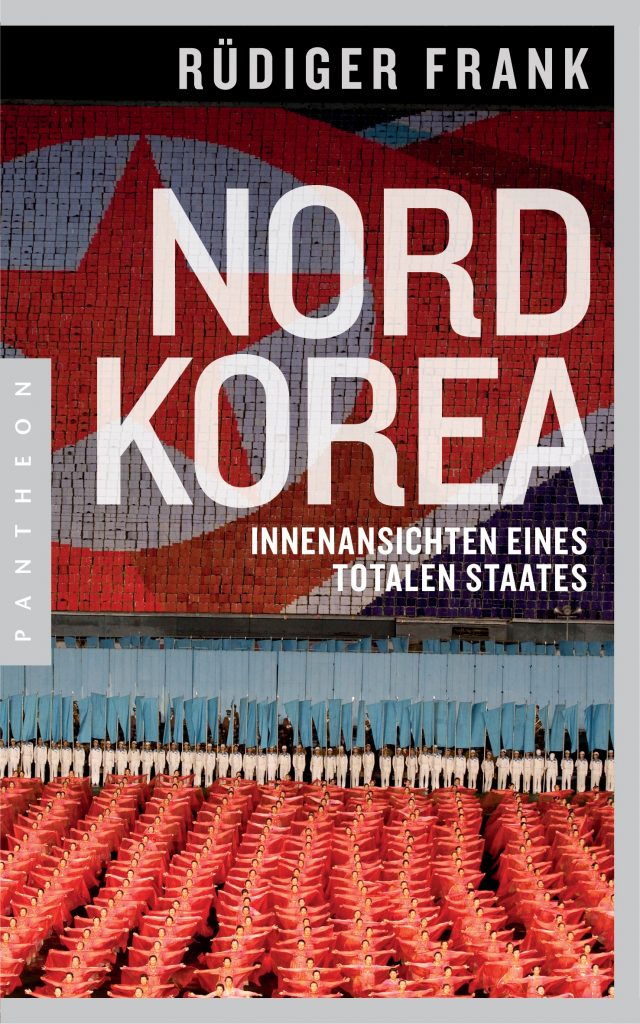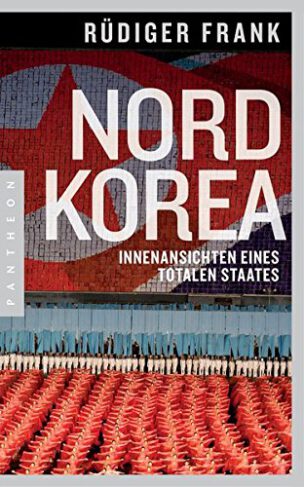Serhij Zhadan: Keiner wird um etwas bitten

Inhalt:
Erstmals seit Beginn des großen Krieges erzählt Serhij Zhadan vom Alltag seiner Leute in Charkiw, die sich in einer radikal neuen Realität zurechtfinden müssen. Lakonische, wortkarge Geschichten von untröstlicher Liebe, von Freundschaft und Tapferkeit, komisch, absurd und herzzerreißend. Eine unvergessliche Lektüre. (Klappentext)
Rezension:
Der Lehrer, der als Übriggebliebener regelmäßig im durch den Krieg beschädigten Schulgebäude nach dem rechten sieht, Schüler kommen längst keine mehr, eine Frau die aus einem Wohngebiet evakuiert werden muss, der Tanzpartner des Abiballs, der im Krankenhaus liegt … Sie alle sind Opfer, leben in der von der zerstörerischen Gewalt des Gegners gezeichneten Stadt, kämpfen mit Verletzungen, Depressionen und den Bombardierungen, die gewaltige Krater geschaffen haben.
Charkiw ist keine Stadt wie jede andere. Hier sind die Folgen des Angriffkrieges sichtbar und zu spüren. Wer noch nicht aus dem geflohen ist, was von der Stadt übrig ist, lebt mit den Folgen. Vom unwirklichen „Alltag“ der Bewohner seiner Heimat schreibt Serhij Zhadan. Kurzgeschichten, von denen jede einzelne unter die Haut geht.
Zwölf Geschichten, deren Protagonisten so unterschiedlich sind, wie die Stadt vielfältig selbst jetzt noch ist, die dem Ausmaß physischer und psychischer Gewalt trotzen, die sich kreuzen, begegnen, miteinander und doch mit sich selbst kämpfen müssen. Was macht das mit einem, wenn alles, was einst galt, in Trümmern liegt. Schon an der Oberfläche kratzen, erschüttert. Zhadans Schreibstil ist beinahe nüchtern. Er beobachtet. Manches Stück liest sich so, als müsse der Autor sich selbst vor dem Geschilderten schützen, zwingen, dies aufzuschreiben. Hinter all den Fiktionalen stecken, so ahnt man, echte Schicksale. Menschen.
In diesen kleinen Stücken, die Serhij Zhadan „Arabesken“ nennt, sind sie die Helden, alleine dadurch, dass es sie gibt, dass sie leben. In Charkiw. Ihnen, die sonst keine Beachtung finden, Nachrichtenbilder verflüchtigen sich schnell, setzt der Autor hier ein Denkmal. In knapp formulierten Schilderungen. Für einen kurzen Augenblick legt der Autor den Fokus auf eine bestimmte Szene, um dann zu der nächsten überzugehen. Ein Bürogebäude ist hier die Kulisse, im nächsten Kapitel wohnen wir einer Unterhaltung zweier im Auto bei. Der Krieg schwingt immer mit, offensichtlich, dann wieder nur als Hintergrundrauschen.
Serhij Zhadan ist selbst derzeit als Soldat in seiner Heimat tätig. Schon das ist bewundernswert. Die Geschichten dazwischen praktisch aufs Papier gebracht zu haben, die jede für sich stehen und doch unverkennbar zusammen gehören, ist mit diesem Hintergrund noch erstaunlicher. Und sicher auch ein Akt der Verarbeitung. Im Krieg ist jeder für sich allein, und doch hält man zusammen. Eine Wahl hat man nicht.
Die Protagonisten selbst sind vor ihren Hintergründen verschieden, gegensätzlich. Mit wenigen Worten gelingt es dem Autoren, Sympathien zu schaffen, sie nachvollziehbar zu machen. Mehr als die wenigen Sätze, jede Kurzgeschichte findet nur einige Seiten Platz, braucht es nicht. Die innerhalb der kleinen Versatzstücke verstreuten Skizzen, verdeutlichen das Grauen, den Schrecken, die Melancholie. Zhadan verliert sich nicht in Details, beschränkt sich auf das Wesentliche. Jeder einzelne Text scheint einem förmlich anzuspringen. Seht her, so ist es gerade für uns. So, nicht anders. Es braucht halt nicht viel, um diesen Zugang zu schaffen.
Man kann sich das alles gut vorstellen. Manches fast zu gut. Abstand halten möchte man, doch kommt man sich lesend zuweilen vor, wie ein Voyeur, ein Gaffer. Der Autor legt den Finger in die Wunde, die nicht verheilen kann. Der Krieg ist in jeder Szene allgegenwärtig. Schauplätze wie Protagonisten werden mit wenigen Worten sehr plastisch beschrieben. Manchmal muss man innehalten. Ein seltenes Schmunzeln, Lächeln bleibt sofort im Halse stecken, wenn es denn mal vorkommt.
Es mögen einige durch die Fernsehbilder abgestumpft sein, solche kleinen Alltagsbeschreibungen aber betrüben zu tiefst und lassen nicht los. Für Zhadan und all jene, die sich in den von Krieg gezeichneten Regionen und Städten aufhalten, gar an der Front kämpfen, wie muss es erst für die sein, fragt man sich während des Lesens und ahnt, dass noch viel mehr unerzählbar bleibt, da es dafür keine Worte gibt. Die wenigen, die wie diese hier gesehen werden können, sind es wert und wichtig.
Autor:
Serhij Zhadan wurde 1974 geboren und ist ein ukrainischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer. Nach der Schule studierte er zunächst Literaturwissenschaften, Ukrainistik und Germanistik. Er organisiert Literatur- und Musikfestivals und verfasst Rocksong-Texte. 2007 erschien sein erster Roman. 2006 wurde er mit dem Hubert Burda Preis für junge Lyrik ausgezeichnet, Zhadan war zudem Aktivist der Orangenen Revolution.
2014 schilderte er in der FASZ seine Erfahrungen der Erstürmung der Gebietsverwaltung von Charkiw, wurde dafür von prorussischen Kräften krankenhausreif geschlagen. Seine Werke wurden mehrfach ins Deutsche übersetzt, und zahlreich ausgezeichnet. 2022 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Er lebt in Charkiw und ist seit 2024 Soldat.
Serhij Zhadan: Keiner wird um etwas bitten Weiterlesen »