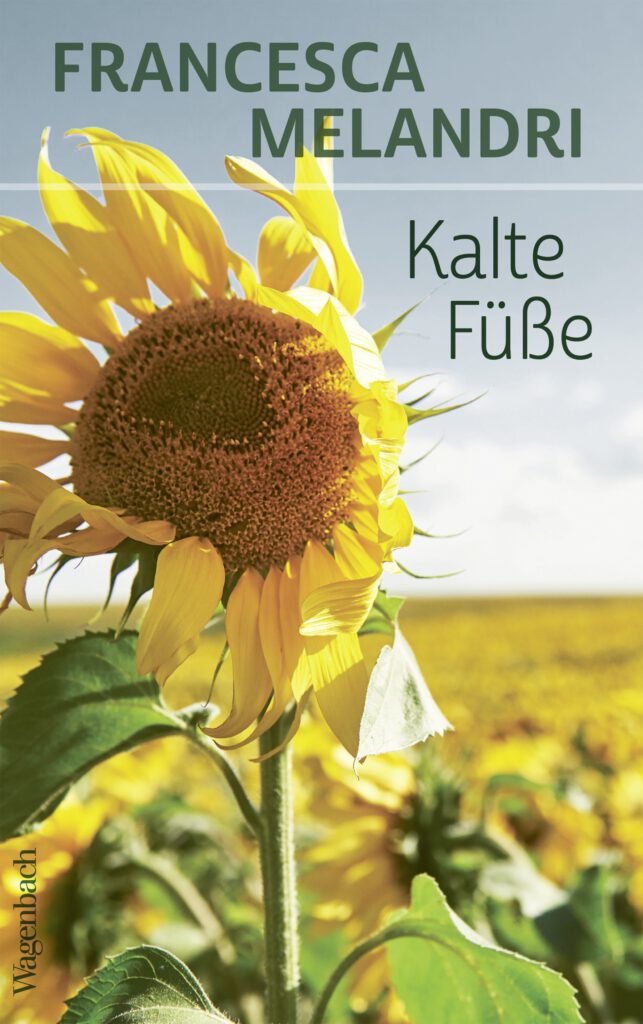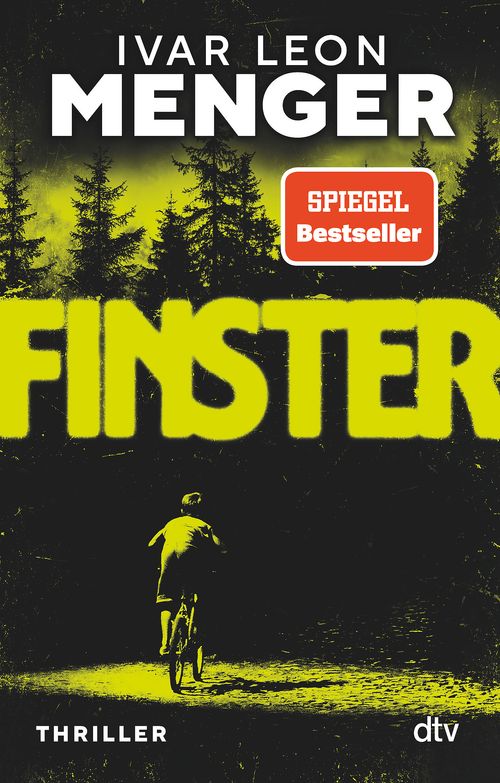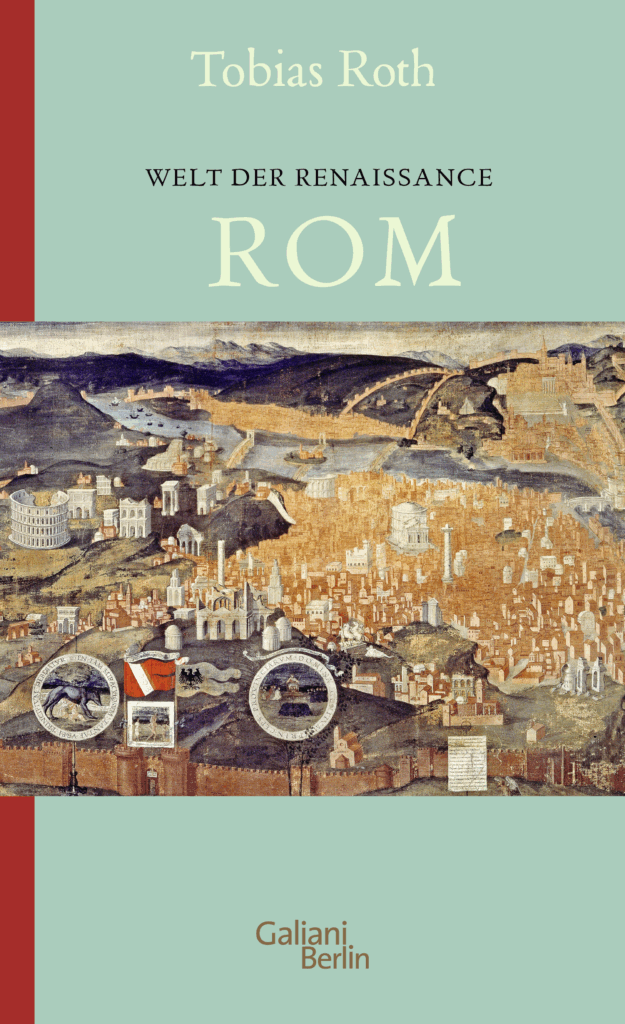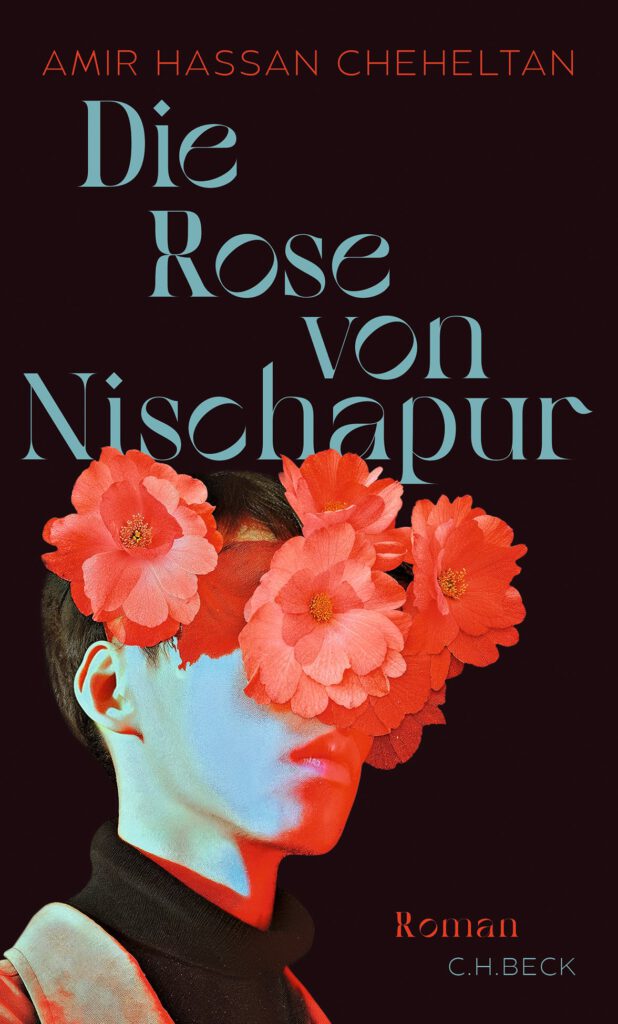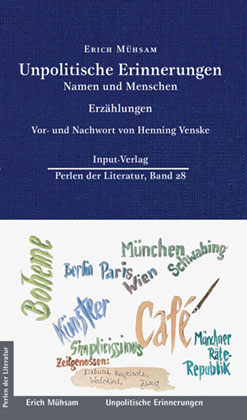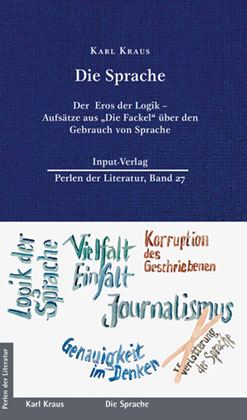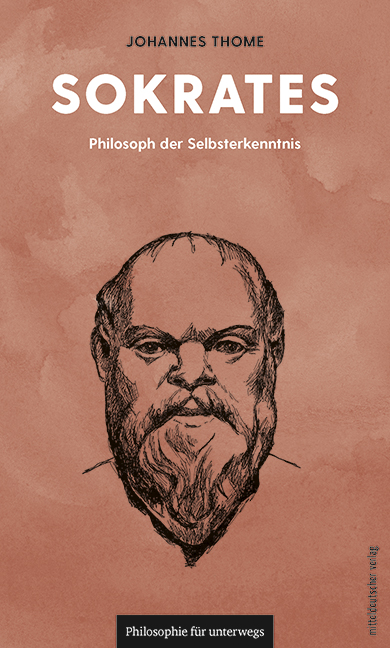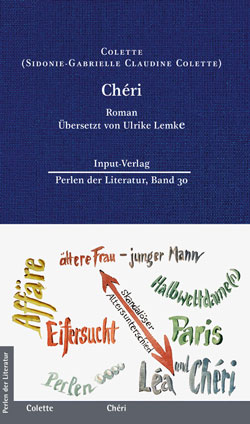Matias Riikonen: Matara
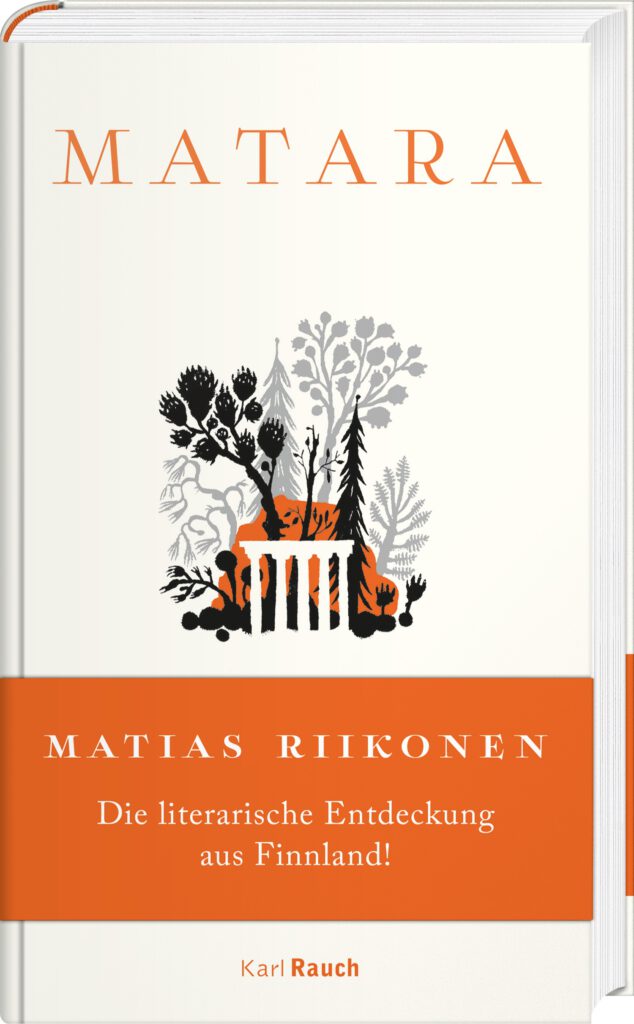
Inhalt:
Ein Buch, das uns Lesende in die Kindheit zurückführt und nachempfinden lässt, wie groß und unendlich wichtig alles war. Denn Matara ist ein Staat – geboren aus kindlicher Imagination. Es ist die Geschichte von Jungen, die im finnischen Wald einen Staat mit Grenzen, Gesetzen und einer Armee entstehen lassen. Sie patrouillieren, tragen Schwerter, führen Krieg und haben Gesetze. Das Wichtigste besagt: Es ist verboten, von dem zu sprechen, was außerhalb von Matara passiert. (Klappentext)
Rezension:
Wenn man den „Krieg der Knöpfe“ mit „Herr der Fliegen“ vermengt und eine Prise „Peter Pan“ hinzufügt, erhält man im Finnischen „Matara“. Dies ist ein Land, geboren aus der kindlichen Phantasie einer Herrscharr von Jungen, die in den nordischen Wäldern ihre Sommerferien verbringen. Beaufsichtigt von den Erwachsenen werden sie nur in der eigentlichen Einrichtung, doch bleibt diese außen vor, sobald die Kinder und Jugendlichen ihre Fahrräder abstellen und das Tor hinter sich schließen. Der Autor Matias Riikonen erzählt in seinem Übersetzungsdebüt von Kämpfen und Ränkespielen, Ritualen in Matara, in dem Phantasie und Wirklichkeit miteinander verschwimmen.
Diese Erzählung schwebt geradezu förmlich zwischen Jugendroman und Erwachsenenliteratur. In ausschweifenden Naturbeschreibungen eingebettet, begleiten wir die Protagonisten im Alter zwischen neun und fünfzehn Jahren, die in ihrer Gedankenwelt einen Staat nach altem römischen Vorbild haben entstehen lassen, dessen Geschehnisse für wenige Wochen alles überlagert. Langsam werden wir in diese Szenarie eingeführt, in der wir jeden Windhauch spüren werden, jeden Ast unter unseren Füßen. Das Erzähltempo steigert sich dabei allmählich von Kapitel zu Kapitel. Atemlos steuert man in „Matara“ auf ein großes Finale zu, welches alles verändern wird.
Vor allem die Sicht zweier Brüder, die anders als die anderen Figuren unbenannt bleiben, ist es, durch die wir die Geschehnisse verfolgen. Ihnen folgen wir durch das Gestrüpp und machen uns von ihrer Umgebung ein Bild. Anfangs ist nicht klar, was genau Phantasie ist und wo die Wirklichkeit beginnt. Doch die zwei Hauptprotagonisten nehmen schnell Formen an. Auch ihre Sicht auf die Dinge wird schnell nachvollziehbar. Zeile für Zeile wird das Gefüge klarer, auch die Feindbilder der Jungen, andere „Stämme“. Ob aus der gleichen Einrichtung stammend, bleibt im Unklaren. Nicht alles wird hier erläutert. So scheint es sich mit „Matara“ um ein reines Jungen-Camp zu handeln. Mädchen existieren in dieser Welt nur im übertragenen Sinne.
Feindbilder indes sind schnell klar, sowie auch die Charaktere, denen sich die Jungen zu eigen machen. Dieses komplexe Gebilde trägt die Geschichte, in der stets eine unterschwellige Spannung mitschwingt. Diese Gegensätze entfachen eine gute Dynamik, derer man gerne folgt. Auch gibt es keine Lücken oder Wendungen, die Unklarheiten offen lassen. Die Brutalität eines „Herr der Fliegen“ wird dadurch abgemildert, dass die Kinder auch beim brutalen Spiel mit den Holzschwertern am Ende noch zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden können. Wer besiegt ist, nimmt sich aus dem selbigen. Wie, ist faszinierend nachzuspüren.
Der Autor weiß an den richtigen Stellen Akzente zu setzen, ausführliche Beschreibungen wechseln mit Zeilen ab, in denen man lesend sich seinen eigenen Gedanken überlassen wird. Auch das zunächst unmerklich, dann immer schneller steigenede Erzähltempo tut dazu sein Übriges. Förmlich wird man in diese Welt eingesogen, kann sich das allesamt vorstellen. Auch jeden Mückenstich.
Wer die Mitte sucht zwischen „Herr der Fliegen“ und „Krieg der Köpfe“ wird sie in „Matara“ finden, nach meinem Empfinden insgesamt aber flüssiger lesbar. Die darin beschriebene Welt zeigt all das, was mit Verwachsen der kindlichen Phantasie verloren geht. Große Abenteuer, aber auch die Brutalität des Erwachsenwerdens. Versammelt auf so wenigen Seiten, ist Matias Riikonen hiermit ein Meisterstück gelungen.
Autor:
Matias Riikonen wurde 1989 geboren und ist ein finnischer Schriftsteller. Er hat in Helsinki Literatur studiert und wurde für sein Debütroman 2012 mit den Helsingin-Sanomat-Literaturpreis ausgezeichnet. „Matara“ ist sein erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde.
Folge mir auf folgenden Plattformen:
Matias Riikonen: Matara Weiterlesen »