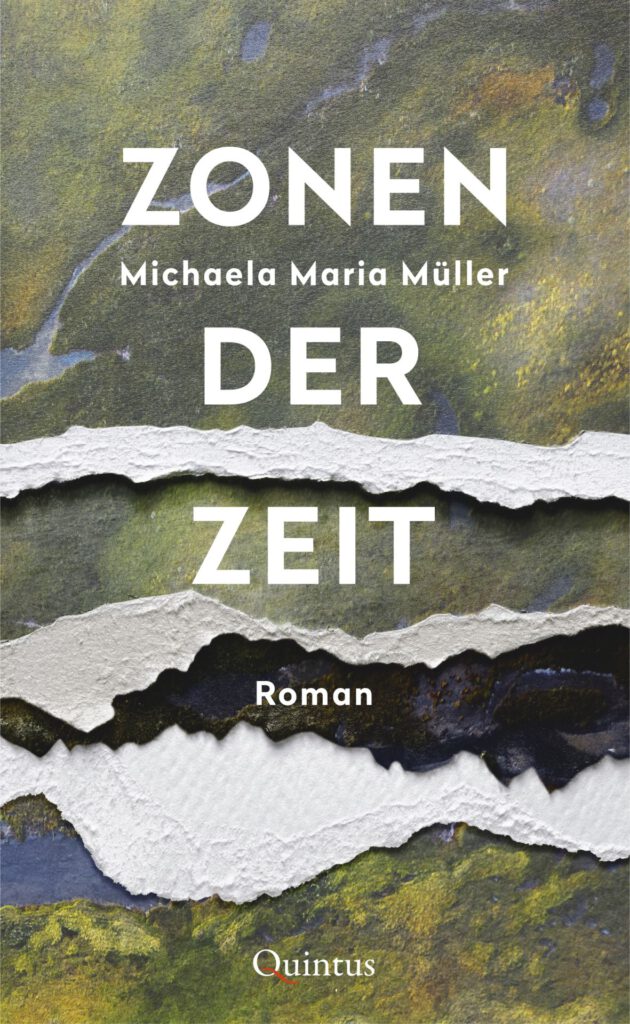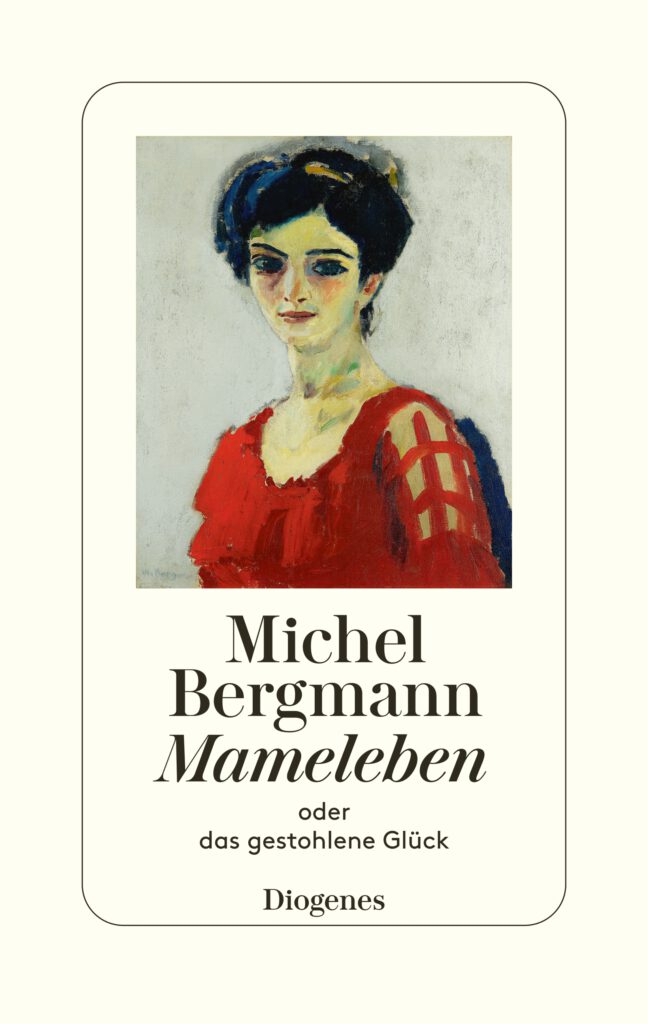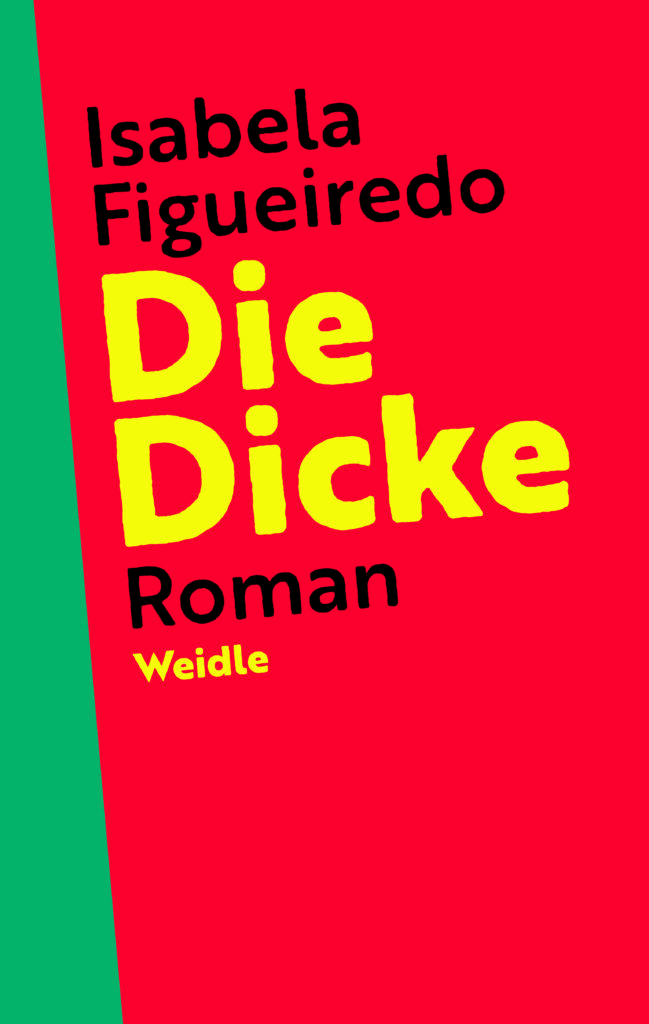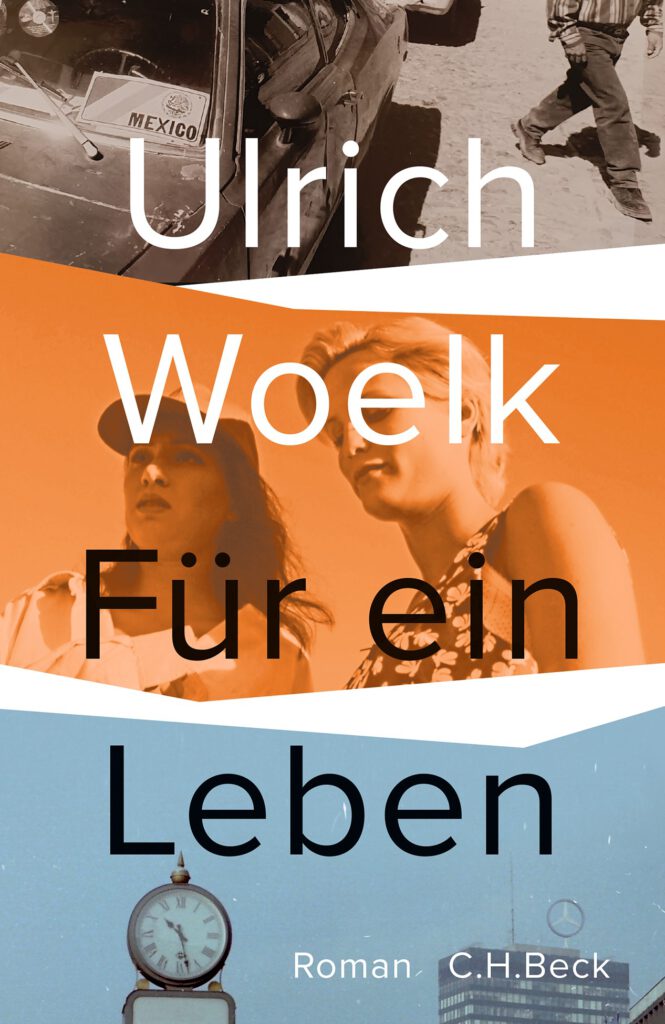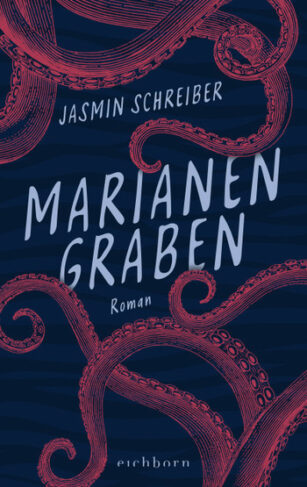Joachim B. Schmidt: Moosflüstern
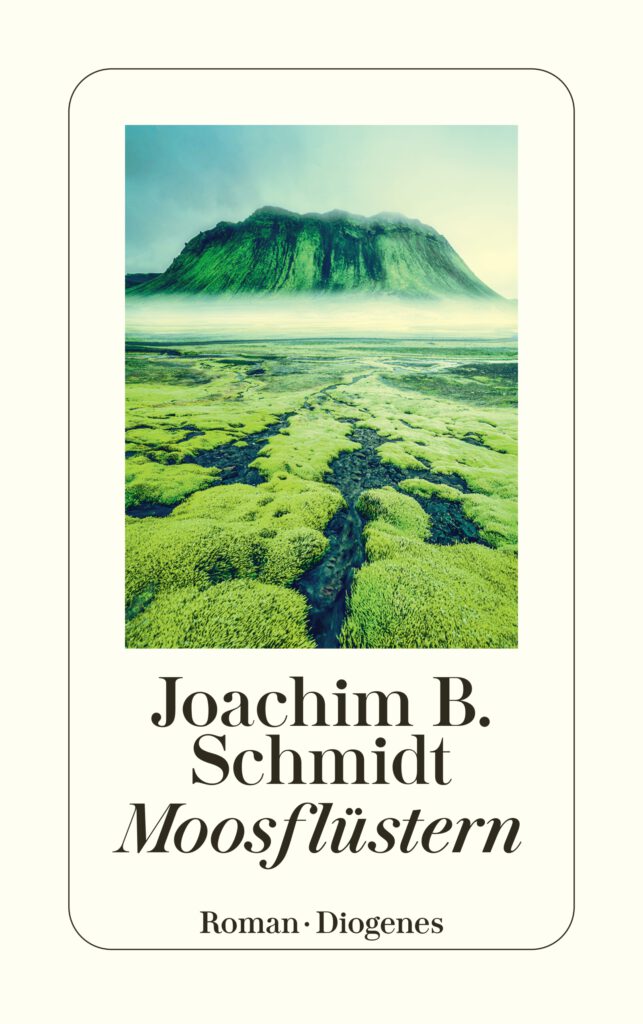
Inhalt:
Im Juni 1949 brachte der Dampfer „Esja“ rund 200 Frauen aus Deutschland nach Island, wo sie sich als Dienstmädchen auf Bauernhöfen verdingten. Darunter auch Heinrich Liebers Mutter, von der er immer geglaubt hatte, sie sei nach seiner Geburt gestorben. 40 Jahre später ist Heinrich Bauingenieur, verheiratet, doch sein Leben gerät auf einmal ins Wanken. Der sonst so korrekte Mann fasst einen überstürzten Entschluss und reist nach Island, wo er sich auf die Suche nach seiner Herkunft macht. (Klappentext)
Rezension:
Ein Einsturz verändert alles. Doch auch so, ohne den Zusammenbruch der Lagerhalle, den Heinrich über seine Bauzeichnungen brütend, sich zunächst nicht erklären kann, gerät sein Leben aus den Fugen, als seine Adoptiveltern ihn vom erst kürzlichen Tod der schon länger verstorben geglaubten Mutter erzählen. Zwei Tropfen, die das Fass zum Überlaufen, das Gedankenkarussel in Bewegung setzen und in Joachim B. Schmidts Roman „Moosflüstern“ vom beschaulichen Zürich in die raue Landschaft Islands führen.
In seiner Erzählung folgen wir zwei Handlungssträngen auf unterschiedlichen Zeitebenen. In der Gegenwart folgen wir den von Selbstzweifeln und Unsicherheiten befangenen Hauptprotagonisten auf Spurensuche nach seiner Vergangenheit, sowie im Wechsel der jungen Anna, die sich kurz nach Kriegsende aus dem gebeutelten Europa auf dem Weg nach Island macht. Nach und nach führen beide Handlungen zueinander, wenn auch der Rahmen unterschiedlicher gefasst nicht sein könnte. Joachim B. Schmidt erzählt von Polartagen, die sich wie Wochen anfüllen und von Jahren, die verstreichen.
Dabei liest sich „Moosflüstern“ gleichermaßen melancholisch wie leichtgängig, was sowohl an den wenigen Hauptfiguren liegt, mit deren Ecken und Kanten man sich schnell identifizieren mag, als auch an kunstvollen Orts- und Landschaftsbeschreibungen, die einem ganz für das Geschehen einnehmen vermögen. Das vollkommene Ausbleiben eines kompletten Antagonisten tut sein Übriges. Nein, beide Hauptfiguren stehen sich selbst im Weg und finden doch immer wieder auf die Spur zurück. Ähnlichkeiten zueinander sind hier unverkennbar, wunderbar ausgestaltet durch den Autoren. Das macht es leicht, sich in die Protagonisten beider Handlungsstränge hineinzuversetzen.
Mit seiner Erzählung bringt Joachim B. Schmidt ein hierzulande kleines, jedoch fast vergessenes Kapitel Geschichte zum Vorschein und lässt sie einfühlsam lebendig werden. Die eine Protagonistin ist ihr ausgesetzt, der andere macht sich nach und nach ein Bild. In der rauen Landschaft setzt sich ein Puzzle zusammen, was Heinrich auch mit der eigenen Verantwortung für sein Tun konfrontieren wird. Hier eröffnen sich feine Unterschiede, Risse, die Seite für Seite feinsinnig herausgearbeitet werden.
Daraus ist ein in sich abgeschlossener Roman entstanden, der ohne großspurige Wendungen auskommt, jedoch auch keine Lücken aufweist und trotzdem streckenweise spannend zu lesen ist. Genau im richtigen Maße, ohne alles in Eiskristalle gehüllte Melancholie ersticken zu lassen, lässt der Autor Perspektiven und Beschreibungen wechseln. Zeile für Zeile durchzieht den Text eine fast filmische Sprache, die beide Handlungsstränge sehr plastisch wirken lassen. Ein wenig Kitsch wird sich hier und da dennoch erlaubt.
Weder zu heiter noch düster ist die Erzählung, deren Hintergründe man gerne nachspüren möchte. Das liegt nicht zuletzt an Joachim B. Schmidts der seine Gespräche mit Menschen hat einfließen lassen, die die hier am Anfang stehende Überfahrt nach Island tatsächlich gemacht haben. Der Sprung ins kalte Fjordwasser ist hier gelungen.
Wer andere Werke des Autoren kennt, wie etwa „Kalmann“ oder „Tell“ wird hier erneut überrascht werden, von seiner Vielseitigkeit des Erzählens. Wieder liest es sich anders als das aus seiner Feder bekannte, wobei, dies sei auch erwähnt, der Eindruck leider nicht ganz so nachhaltig wirkt. Das jedoch ist Meckern auf hohem Niveau, ergibt allerhöchstens Abzüge in der B-Note. Joachim B. Schmidts Figuren folgt man dann doch zu gerne.
Autor:
Joachim B. Schmidt ist ein Schweizer Journalist und Schriftsteller, der zunächst eine Ausbildung zum diplomierten Hochbauzeichner absolvierte. Mit einer Kurzgeschichte gewann er einen Schreibwettbewerb und veröffentlichte erstmals 2013 seinen ersten Roman. Als Journalist und Touristenquide arbeitet er in Reykjavik, Island, wohin er 2007 ausgewandert ist. Sein Roman „Kalmann“, dem weitere folgten, erschien 2020 bei Diogenes. Er ist ausgezeichnet mit dem Crime Cologne Award und dem Glauser Preis.
Joachim B. Schmidt: Moosflüstern Weiterlesen »