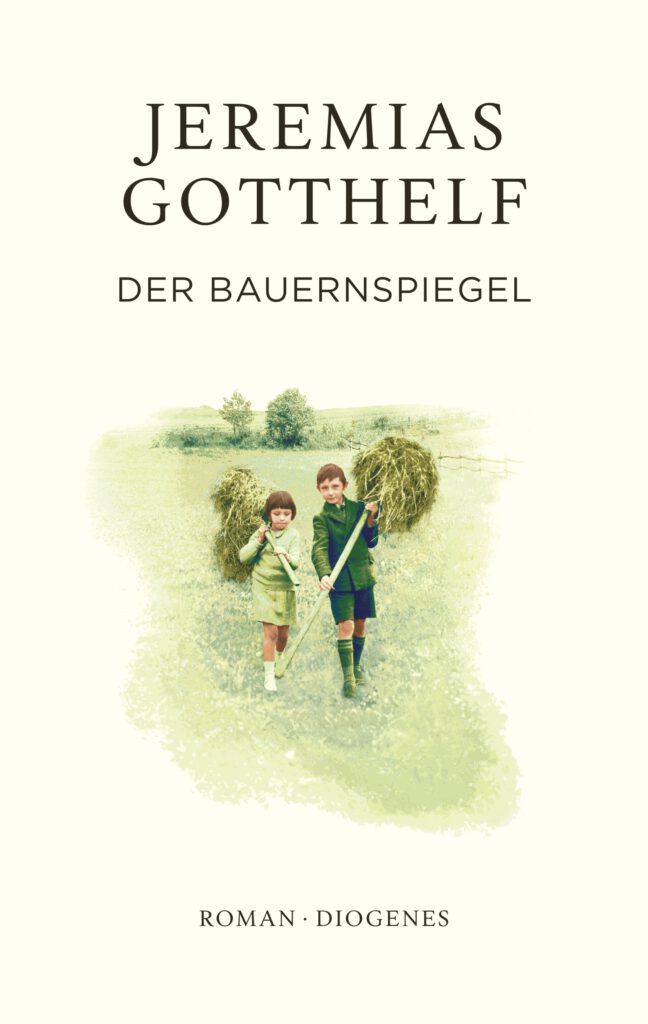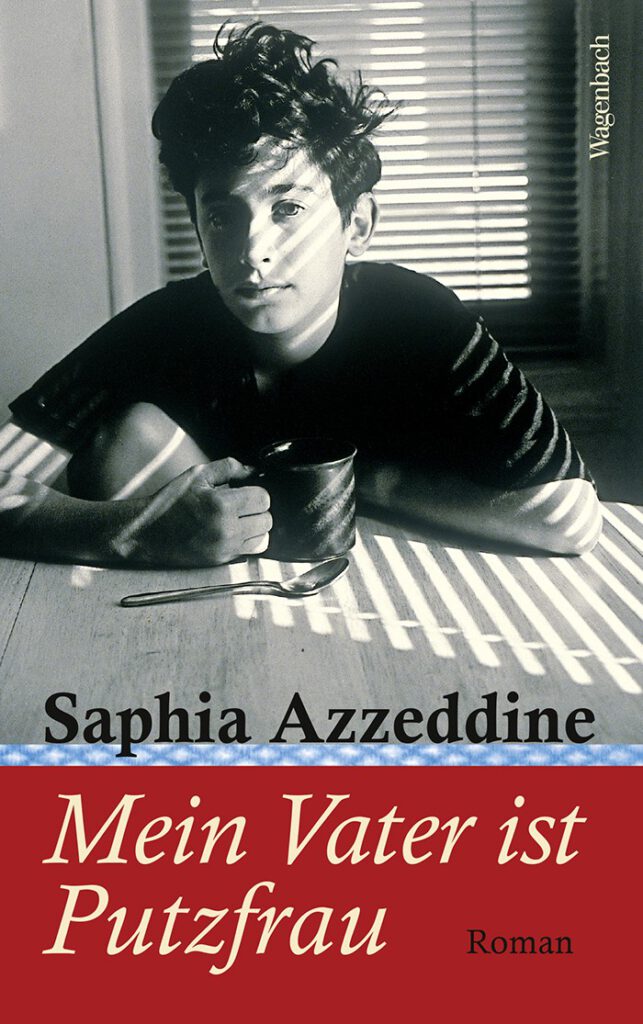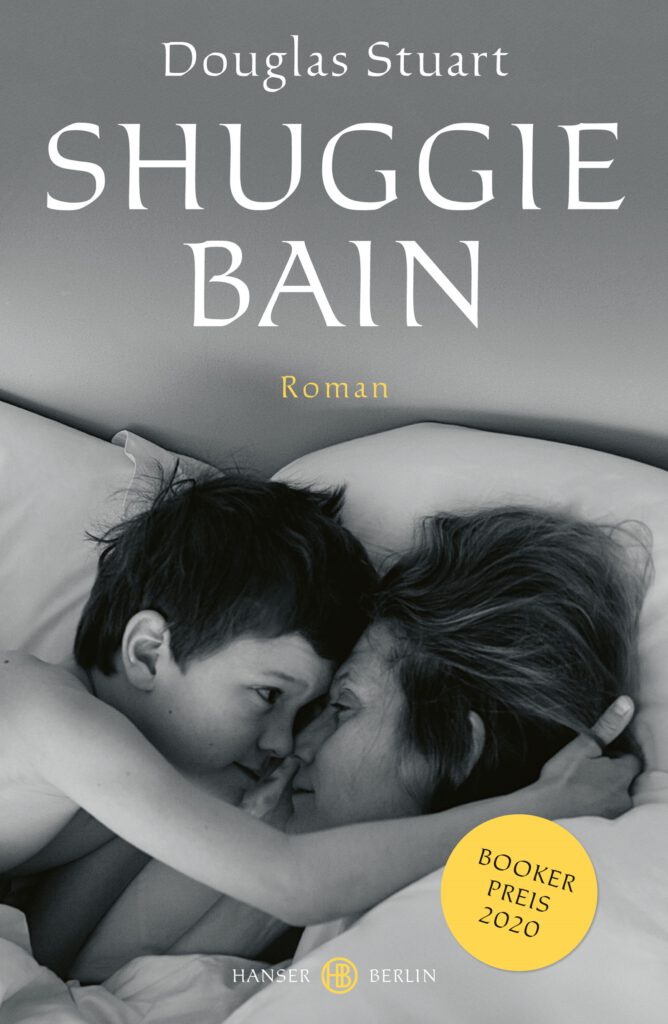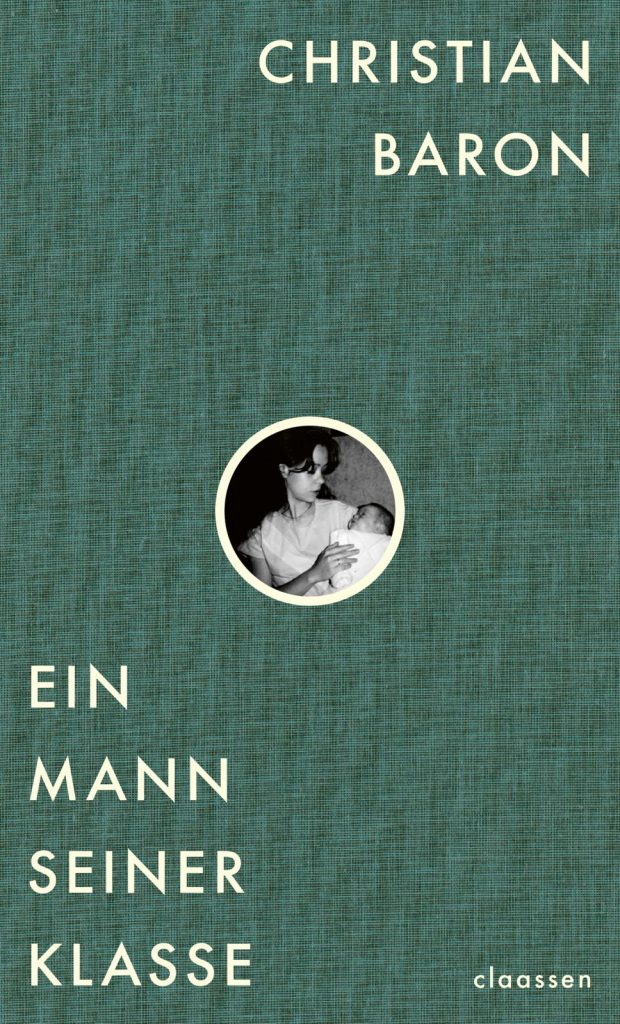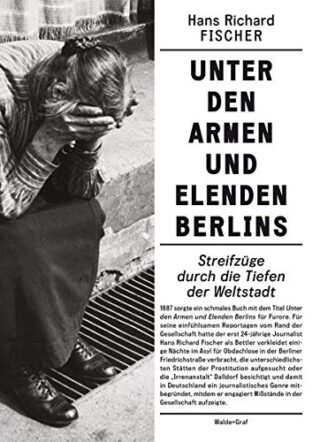Florian L. Arnold: Das flüchtige Licht
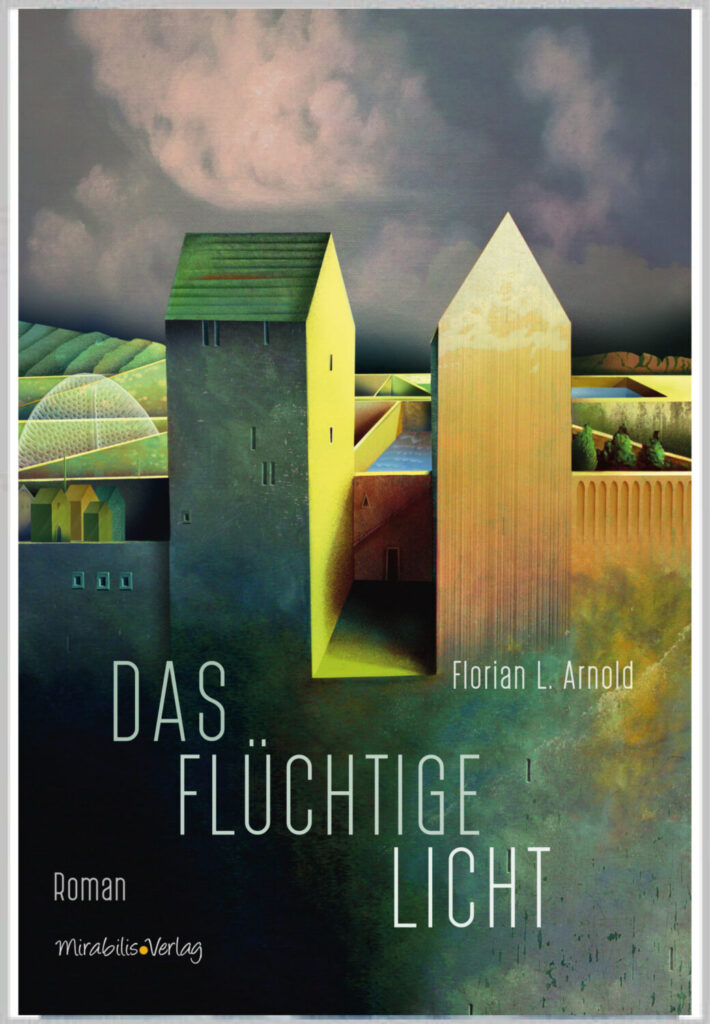
Inhalt:
Für den Monsignore, einen großen Filmemacher, ist das ganze Leben ein Schauspiel. Doch für den routinierten Regisseur ändert sich alles, als er das Straßenkind Enzo vor die Kamera holt. „Das flüchtige Licht“ erzählt die Geschichte von vier Menschen, deren leben durch das Kino und die Leidenschaft eines exzentrischen Geschichtensammlers bestimmt wird. (Klappentext)
Rezension:
Es ist eine Illusion, die nach dem Willen eines einzelnen Mannes entsteht, doch sobald die Linse ihren Auftrag erfüllt hat, verschwindet diese von Kameras eingefangene Welt. Der trockene Staub legt sich in den überhitzten Gassen, wenn die Schauspielenden und ihr Filmemacher verschwinden und den schönen Schein in Kisten verpacken. Fortan geht ein jeder wieder seine Wege. Bis zum nächsten Mal. Für Enzo, der einst eher zufällig in die Aufnahmen des Monsignore hineinplatzt, ist diese sehr flüchtige Welt real oder zumindest viel zugetaner als die Wirklichkeit, die es schon in seiner Kindheit nicht gut mit ihm meint.
Ausgeschlossen ist er dort gewesen, immer am Rande einer Gruppe von Jungen, die ihm den Zugang zu der kleinen und verschworenen Gemeinschaft verwehren, bis diese sich auflöst, als sie alle nach und nach aus ihrem Heimatdort ausbrechen. Doch auch danach lässt sie der rothaarige Schatten ihrer Kindheit nicht los. Die Welt der Illusionen hat Enzo da schon verschlungen.
Florian L. Arnolds Roman „Das flüchtige Licht“ ist eine Hommage an eben diese, der Hochzeiten des italienischen Kinos und dem Mann, der sie erheblich mitgeprägt hat. Fellini ist das Vorbild des Monsignore, der Figur, der Enzo Halt zu geben vermag, so lange dieser bereit ist, seine Geschichten zu erzählen, für die er dann ein Leben in der Welt der Cinecitta bekommt, die ihm jedoch immer wieder durch die Hände rinnt.
Langsam und behutsam nähern wir uns den Protagonisten an, deren Verhältnisse zueinander sich im Verlauf der Erzählung umkehren werden und doch nicht aus ihrer Haut heraus können. Dieses Spannungsverhältnis bestimmt den Roman, der selbst wie einer dieser italienischen Streifen wirkt. Man kann sie förmlich vor sich sehen, die Gassen, die Suche von Enzo nach sich selbst, der sich in die Abhängigkeit eines einzelnen Mannes begibt, der doch selbst von ihm, einmal in den Bann gezogen, nicht von ihm los kommt.
Die ruhig gehaltene Erzählung wirkt durch ihre Figuren, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Die verschworene Gemeinschaft, die sich einst schwor, immer zusammen zu bleiben, Kontakt zu halten, um sich dann letztendlich doch zu verlieren auf der einen Seite. Enzo auf der anderen, der da nie hinein finden wird und auch in der Welt des Monsignore die Rolle des Außenseiters übernehmen muss, um auf irgendeine Art und Weise doch dazu zugehören. Ist der Film im Kasten endet oft auch das, bis zum nächsten Mal.
Figuren entstehen zu lassen, die nicht mit-, aber eben auch nicht ohne einander können, schafft Arnold mit prägnanten Sätzen, auf den Punkt ausformuliert, ohne dass ein Wort zu viel wäre. Nur manchmal scheint diese beschriebene flüchtige Welt beim Lesen durch die Finger zu rinnen, wie es eben dem Medium eigen ist, welches Hauptgegenstand der Erzählung ist. Viel näher würde man gerne an den einzelnen Protagonisten dran sein. Es hätte nicht geschadet, hier und dort etwas länger zu verweilen.
Orte, die zu einander gegensätzlich sind, sind es auch, die diesen Roman ausfüllen. Der Kinosaal etwa, in dem man sich der Illusion für ein paar Stunden hingeben kann, im Kontrast zu den Gassen, die nach dem Dreh wieder einsam und verlassen sind. Auch das verschafft der Erzählung starke Momente.
Dieses Zusammenspiel verschafft mitsamt der Perspektivwechsel innerhalb der Kapitel einen Lesefluss, innerhalb dessen man die eine oder andere Figur für einen Moment verliert, um im nächsten einen einzelnen Satz zu lesen, der präzise formuliert die Geschichte vorantreibt. Wenn die Protagonisten dann zurückblicken, holt sie die Wirklichkeit mit ihrer ganzen Wucht schnell wieder ein, insbesondere Enzo, dessen Leben gleichsam der Filme, derer Bestandteil er ist, plötzlich leer scheint, als die letzte Szene gedreht, die letzte Geschichte erzählt ist.
Der Roman, der selbst wie ein Film wirkt, schafft es trotz seiner ruhigen Art und Weise, einem in den Bann zu ziehen. Auf jeder Seite ist das Herzblut des Autoren zu spüren, der an der Erzählung jahrelang gearbeitet hat, verpackt in wunderschöner Sprache, die ihr Ziel erreicht. Einzelne Momente hätte ich mir noch etwas mehr ausformuliert gewünscht, auch, dass einige der Charaktere einem nicht so schnell durch die Finger rinnen. Auch eine Bitte hätte ich, könnte sich jemand um die filmische Umsetzung kümmern?
Es wäre genial.
Autor:
Florian L. Arnold wurde 1977 in Ulm geboren und ist ein deutscher Schriftsteller und Illustrator. Er studierte in Augsburg Kunstwissenschaftler und war danach freiberuflich als Grafiker und Schriftsteller tätig und gab u. a. das Kunst- und Kulturmagazin ES heraus. Arnold ist Initiator und Programmleiter des Literaturfestivals Literaturwoche Donau in Ulm/Neu-Ulm und stellt dort seit 2013 die Arbeit unabhängiger Verlage vor. Auchin Neu-Ulm initiierte er das Begegnungsformat Literatur unter Bäumen, zudem kuratiert und moderiert er zahlreiche Veranstaltungen der Aegis-Buchhandlung in Ulm. Er veröffentlichte mehrere Romane, Erzählungen und ein satirisches Wörterbuch.
Florian L. Arnold: Das flüchtige Licht Weiterlesen »