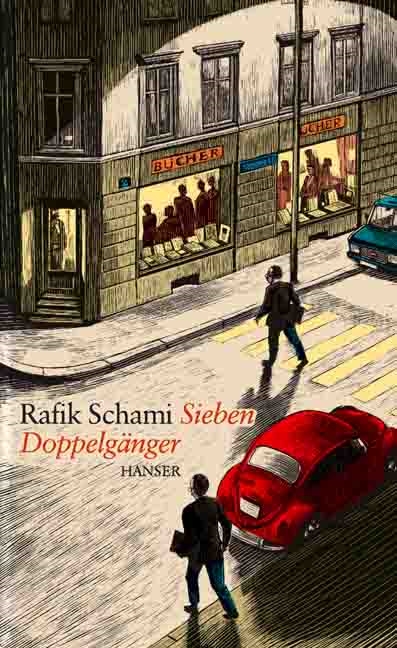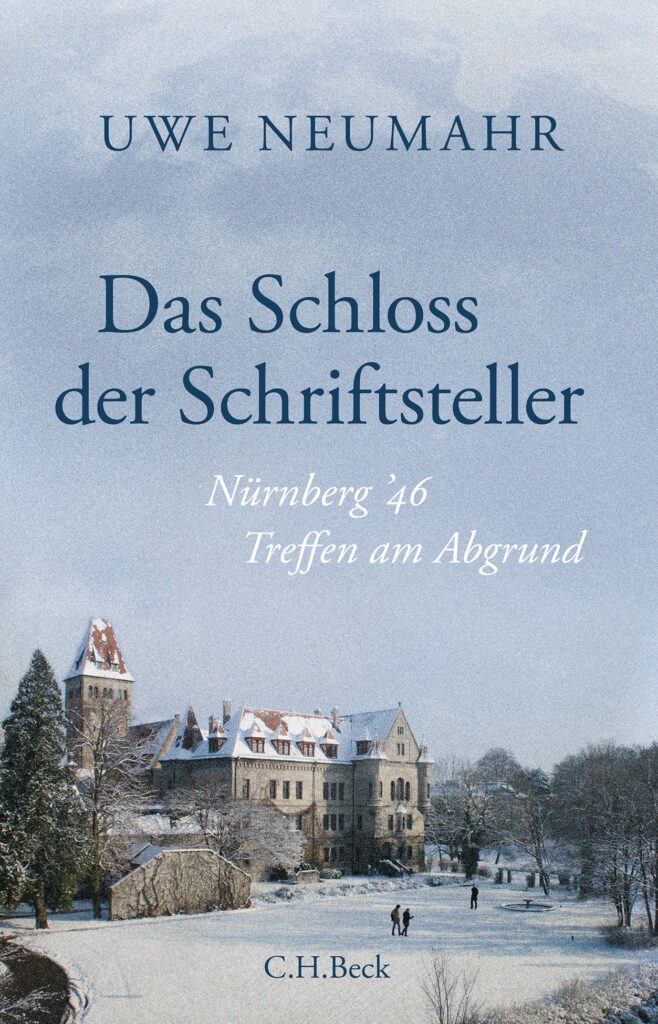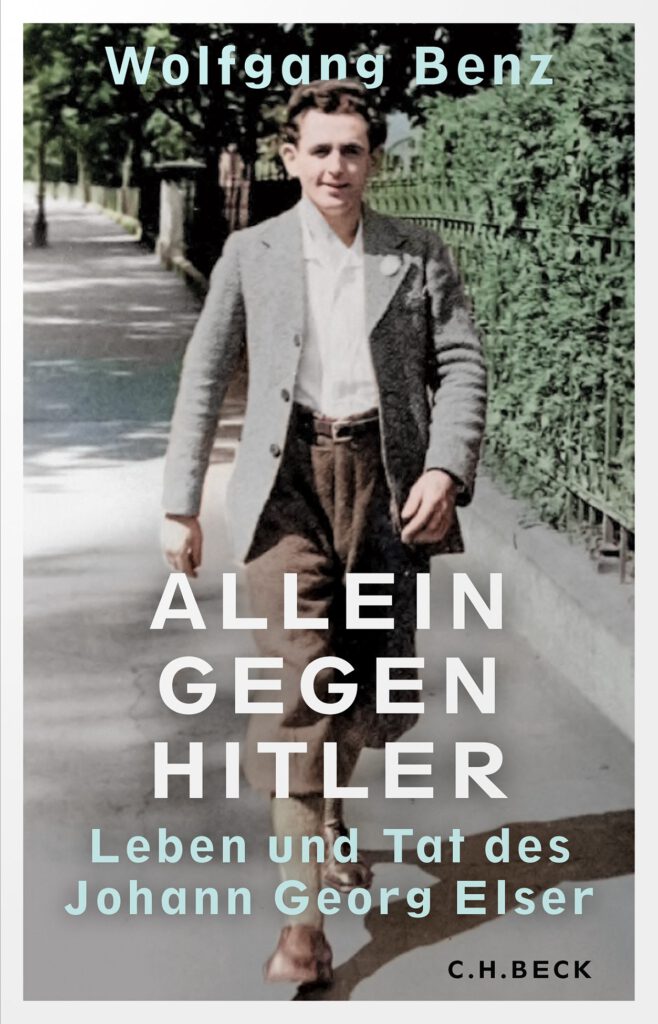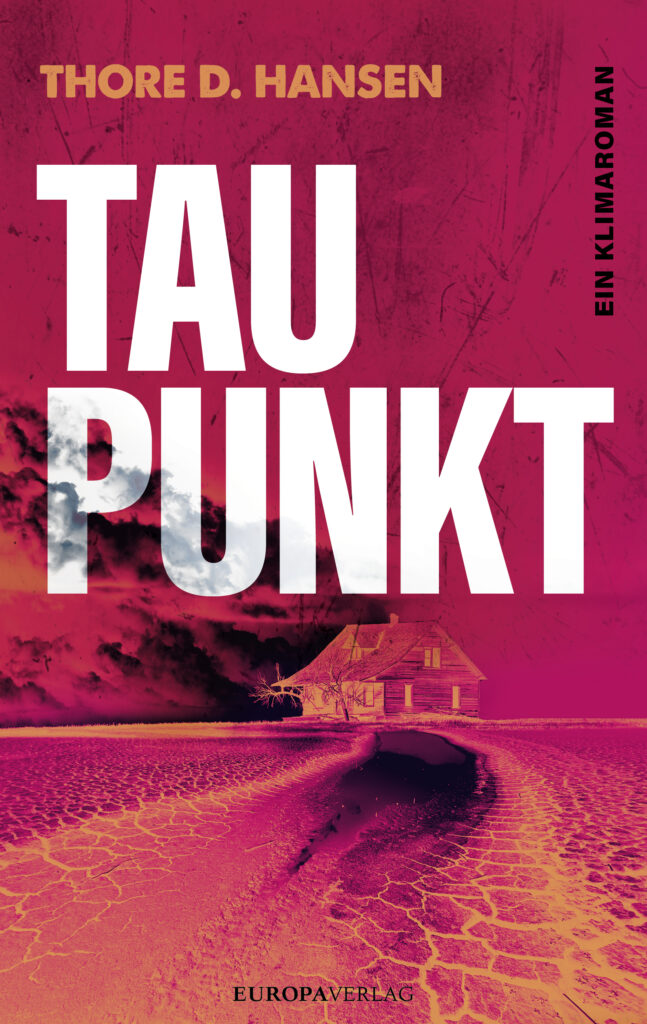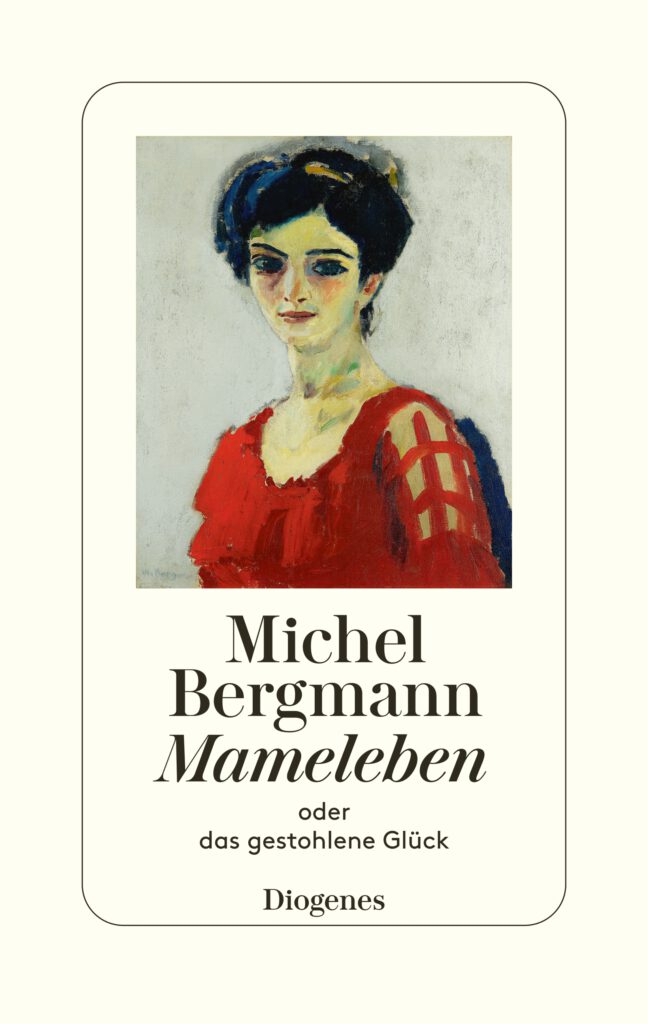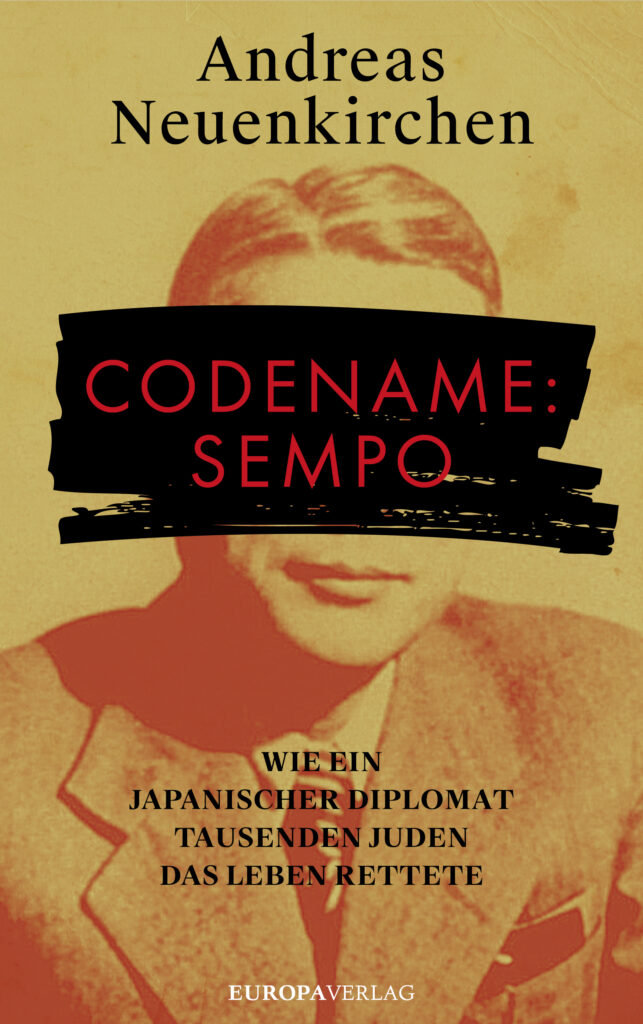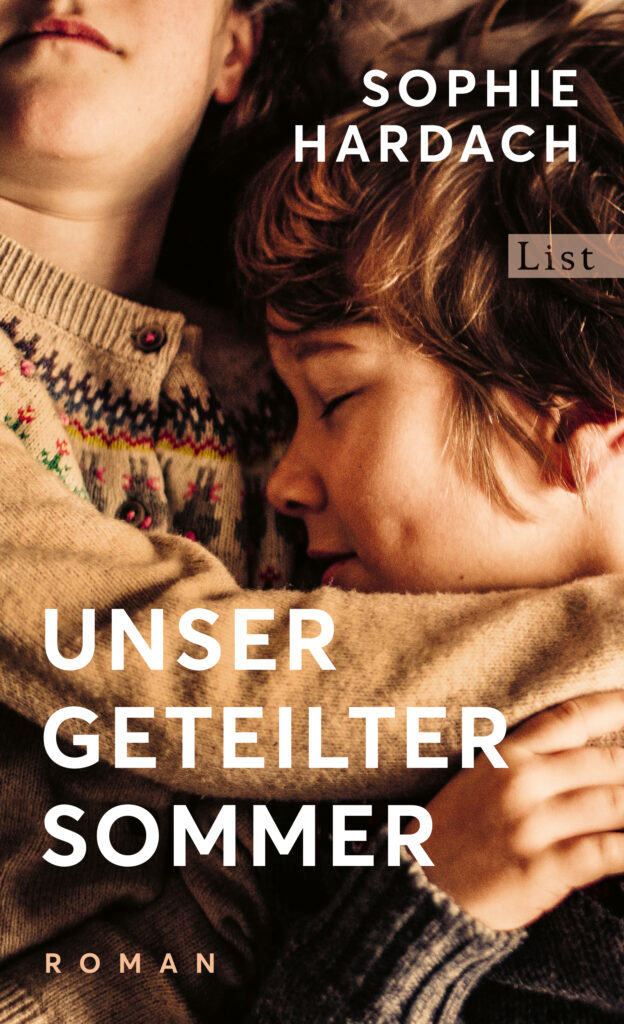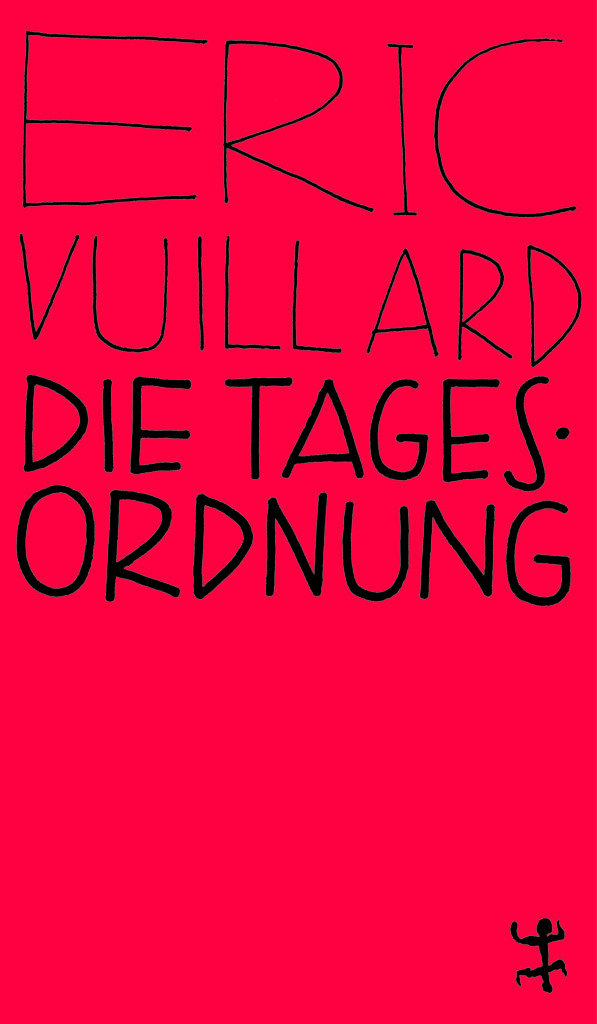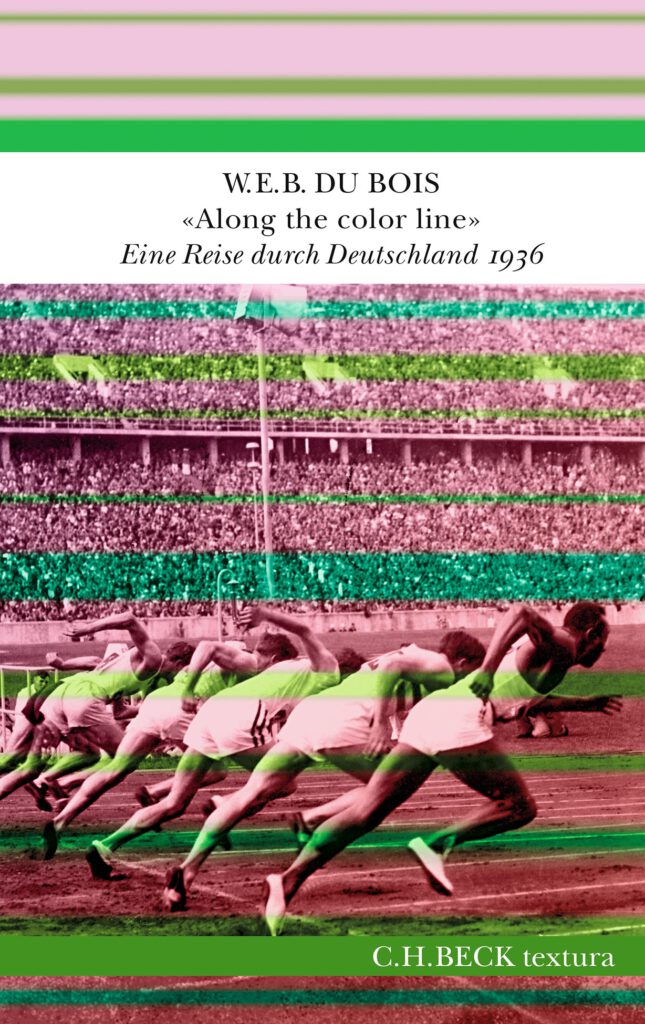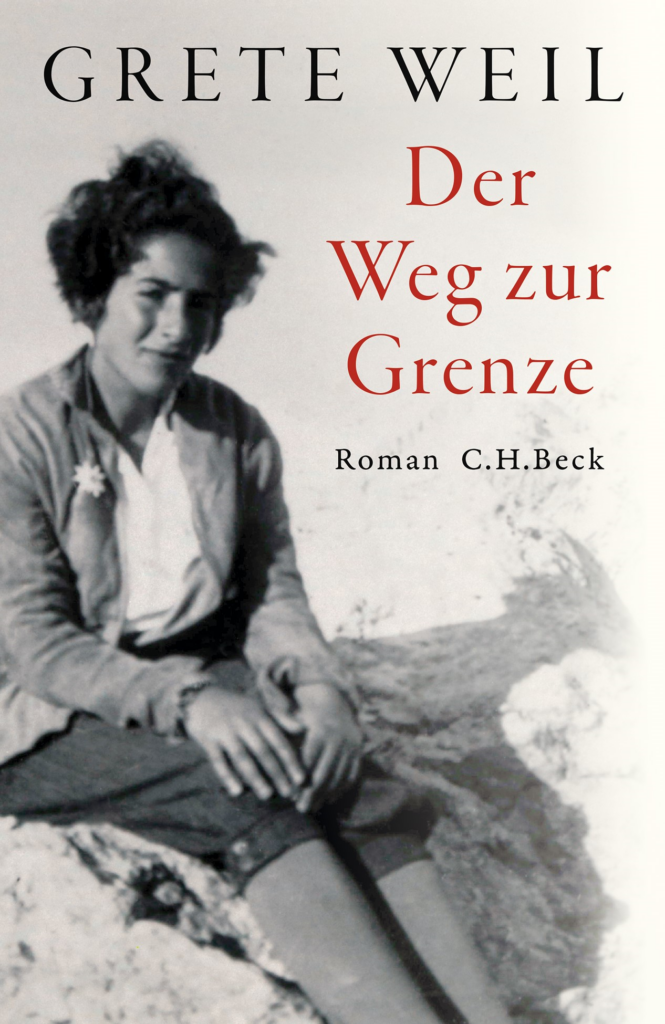Inhalt:
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat Wissenschaftler Tom Beyer das auch im Weltklimarat umstrittene Phönix-Programm entwickelt, das schwerste Eingriffe in das gewohnte Leben der Menschen nach sich ziehen würde. Kein Wunder, dass die Regierungen der Welt nichts davon wissen wollen.
Frustriert zieht sich Tom nach Deutschland zurück, wo er mit seinem Forderungskatalog an die Öffentlichkeit tritt. Damit löst er eine mediale Hetzjagd aus, die sogar sein Leben bedroht. Auch der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt mit Toms Bruder Robert spitzt sich zu. Robert ist Großlandwirt in Norddeutschland, sein Land leidet unter der Dürre, er sieht seine wirtschaftliche Existenz bedroht und verliert sich in Verschwörungstheorien.
Doch dann verändert eine nie da gewesene Hitzewelle den lauf der Geschichte. Alleingelassen auf Roberts Hof, kämpft Familie Beyer ums physische Überleben und muss sich ihren Dämonen stellen. Die Trümmer vor Augen, wissen alle, dass etwas geschehen muss … (Klappentext)
Rezension:
Unser Klima verändert sich in einem atemraubenden tempo. Irgendwann wird diese Geschwindigkeit so sehr überhand nehmen, dass wir laufen müssen, um nicht zurückzubleiben. Das erfordert schon heute Maßnahmen im Kleinen wie Großen.
Die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, zumindest in den Industrienationen auch das dafür notwendige Know How und Geld. Nur, die politischen Entscheidungsträger agieren zu zögerlich, entweder da sie um die nächste Wiederwahl fürchten oder von Wirtschaft und Lobbyismus getrieben, praktisch wissend der Katastrophe entgegengehen. Nur, wozu führt das?
Der vorliegende Roman aus der Feder des Politikwissenschaftlers und Soziologen setzt einige Jahre danach an, nicht mehr weit, fürchtet man berechtigterweise beim Lesen und führt uns vor Augen, was es bedeutet, wenn alle notwendigen Maßnahmen soweit aufgeweicht wurden und zwangsläufig gescheitert sind, dass auch Mitteleuropa mit den unmittelbaren Wandel des menschengemachten Klimawandels zu kämpfen hat.
Kurzweilig und auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend entwirft der Autor ein Szenario, wie es eintreten könnte. Waldbrände an vielen Stellen in Deutschland gleichzeitig, dicht aufeinanderfolgende Dürreperioden, die auch hier Maßnahmen wie das Abstellen und Rationieren von Trinkwasser notwendig machen, flächendeckende Triage in Krankenhäusern, die aufgrund von dehydrierten Menschen vollkommen überlastet sind.
Dies ist der Raum in dem sich die Handlungsstränge dieser modernen Dystopie bewegen. Einerseits verfolgen wir hier dem Weg des Wissenschaftlers, der sowohl auf taube Ohren bei der Politik als auch bei der Öffentlichkeit stößt, die die Wahrheit nicht erträgt, andererseits mit den Dämonen der eigenen Familie. Toms Bruder ist als Landwirt direkt betroffen, bekommt die Auswirkungen unmittelbar zu spüren und leugnet dennoch, was er sieht.
In diesen Sphären bewegen wir uns im Laufe der Geschichte, in der Perspektive von Kapitel zu Kapitel wechselnd. Sehr sachlich ist das immer dann, wenn der Autor einem seiner Hauptprotagonisten praktisch „Fachvorträge“ in den Mund legt.
Die Dynamik in der Geschichte entsteht jedoch vor allem durch die Konfrontation der Gegensätze in Form der unterschiedlichen Ansichten der Figuren. Wohltuend ist es, dass sich der Autor nicht nur bemüht hat, eine Seite auszuformulieren. Man kann die Gründe für das Denken der Gegenseite, hier in Figur von Toms Bruder, dadurch zumindest nachvollziehen.
Das gleicht entstandene Längen aus, führt dazu, dass man die spannende Geschichte weiterverfolgt, die innerhalb eines Zeitraums von wenigen Wochen spielt.
Auch das Wechselspiel zwischen den handlungsorten, der weltpolitischen Bühne des Weltklimarats, der Großstadt Berlin und der ländlichen Einöde tragen maßgeblich dazu bei, dass die Erzählung nicht kippt, sondern immer neue Punkte hineinbringt, die auch konsequent weiterentwickelt werden.
Der Autor hat sich in diesem Roman auf wenige Figuren konzentriert, diese auszugestalten, und zeigt dennoch gleichermaßen damit die Dramatik im Großen wie Kleinen gleichermaßen auf, während Nebenfiguren relativ blass bleiben. Diese spielen jedoch auch keine so große Rolle, als dass das entscheidend wäre. Die eine gewichtige Rolle spielenden Gegensätze sind nicht nur anhand dieser aber sehr minutiös ausgearbeitet, gerade das macht die Handlung oder die Entscheidungen der Figuren jedoch glaubhaft.
Mit den Figuren wechselt auch die erzählerische Perspektive. Fakten werden innerhalb der eingearbeiteten Vorträge eingebracht. Alleine für dieses Zusammentragen von Informationen, der plastischen Beschreibung, was dies gerade für Deutschland bedeuten kann, muss man dem Autoren Respekt zollen.
Beim Lesen hat man den Eindruck, dass Hansen immer wieder den Finger in die Wunde legen wollte, um aufzuzeigen, dass das, was heute gar nicht oder nur mit Lethargie angegangen wird, uns eines Tages auf die Füße fallen könnte, und nie dagewesene Maßnahmen erfordern würde. Und dafür ist ein Roman vielleicht die geeignetere Form. Einen solchen liest man eher als ein trockenes Sachbuch.
Der Roman ist mit all diesen Punkten sehr schlüssig, dazu spannend geschrieben. Interessant ist zudem das halboffene Ende, was zwar in seiner Ausgestaltung nicht verraten werden soll, aber auch hier wieder ein Fingerzeig des Autoren und vieler Wissenschaftler darstellt. So könnte es aussehen, wenn wir nicht aufpassen. Bei uns und nicht irgendwo anders auf der Welt, wo uns das „egal“ sein könnte. Das wirkt unglaublich stark.
Ab Mitte der Erzählung gewinnt der Roman zudem gehörig an Erzähltempo, welches einem noch mehr in dieses Szenario hineinzieht, als man das zu Beginn des Lesens vielleicht ahnt. So schnell wie die Kapitel hochzählen, passend in Grad Celsius angegeben, die Anzeige des Thermometers klettert unerbittlich, so fix scheinen sich die Befürchtungen des einen Protagonisten zu bewahrheiten, wie auch ein immer bedrohlicher werdender Unterton im Text den Raum einnimmt.
Da das alles in Deutschland spielt und nicht irgendwo anders kann man sich als hier lebender Lesender gut vorstellen, wissen wir doch um staubtrockene Böden in Ostdeutschland, stetig steigende Waldbrandgefahr im Hochsommer oder Niedrigpegel in Flüssen, die für die Binnenschifffahrt oder zum Betrieb von Kraftwerken wichtig sind. Auch wegen Hitze strapazierte Straßen gab es hierzulande ja schon.
Thore D. Hansens Szenario lässt nachdenklich zurück. Möchten wir wirklich so etwas wie dieses erleben oder sollten wir nicht endlich etwas tun, klein im Privaten, groß in der Gemeinschaft. Wer mit wissenschaftlichen Studien nichts anfangen kann, diese schwer zugänglich findet, ist mit diesem wissenschaftlich unterfütterten Roman gut bedient, um Ansätze zu finden, wegen des Warums. Danach ist es vielleicht einfacher, sachlich über das Wie zu diskutieren. Wenn dazu Thore D. Hansens Text beitragen kann, ist viel gewonnen.
Autor:
Thore D. Hansen wurde 1969 geboren und ist ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Er studierte zunächst in Hamburg und Boston Politikwissenschaft und Soziologie, bevor er für verschiedene Tageszeitungen und Magazine in Europa zu arbeiten begann. Stationen waren u. a. Deutschland, Österreich und Spanien. Für das Magazin Tomorrow begleitete er den Aufstieg und Fall der New Economy 2001 als Wirtschaftsredakteur, bevor er als Pressesprecher verschiedener Banken arbeitete. Seit 2010 ist er vorwiegend als Schriftsteller tätig. Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland ist er seit 2019.
Nach verschiedenen Arbeiten, etwa zu den Geheimdiensten oder zur Hochfinanzkrise, veröffentlichte er 2017 die Einordnung der Biografie Brunhilde Pomsels, welche die Sekretärin Joseph Goebbels gewesen ist. Basierend auf 30 Stunden Interviewmaterial des gleichnamigen Dokumentarfilms („Ein deutsches Leben“) nimmt er in einen historischen Vergleich Analogien der Gegenwart auf.
Immer wieder verarbeitet Hansen so hochaktuelle und diskutierte Themen in seinen Werken.