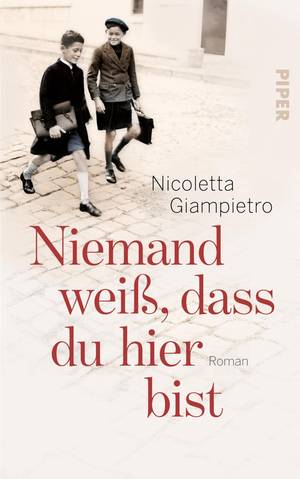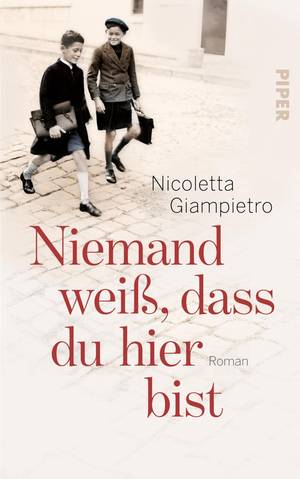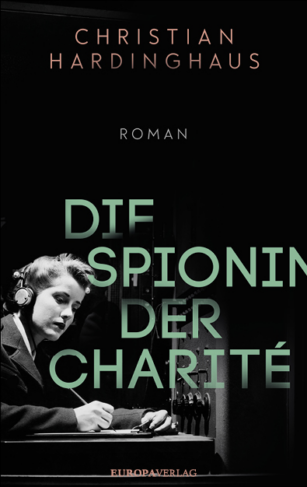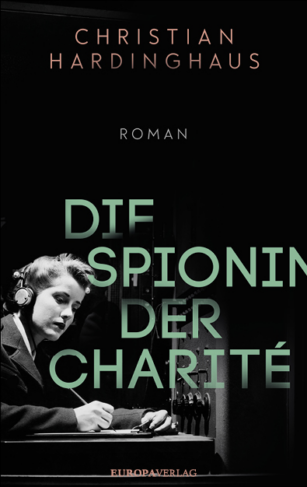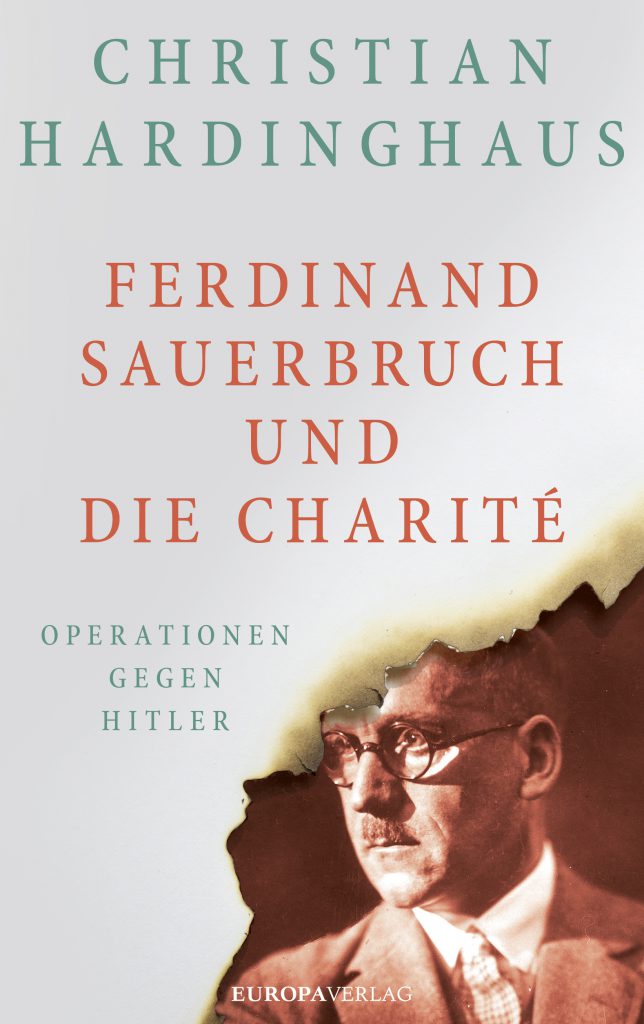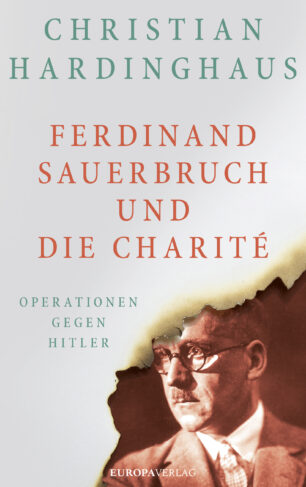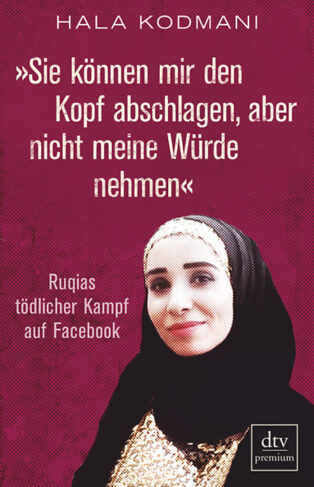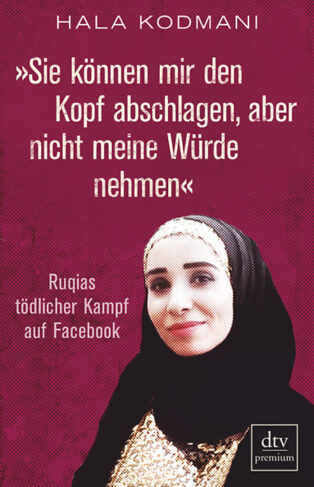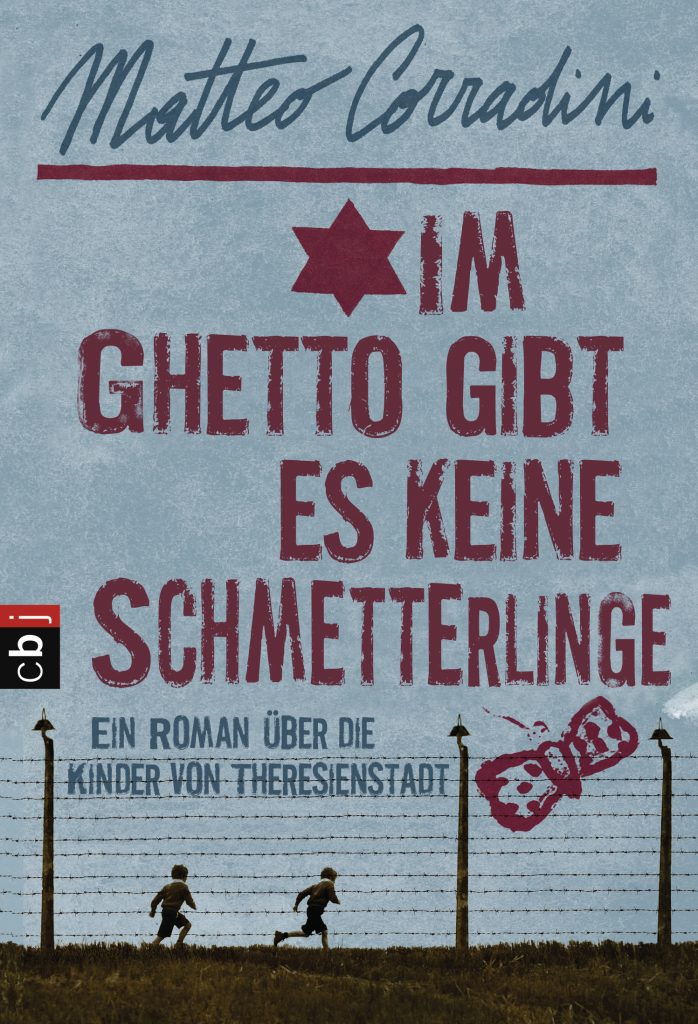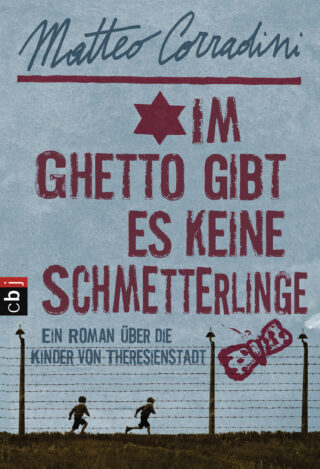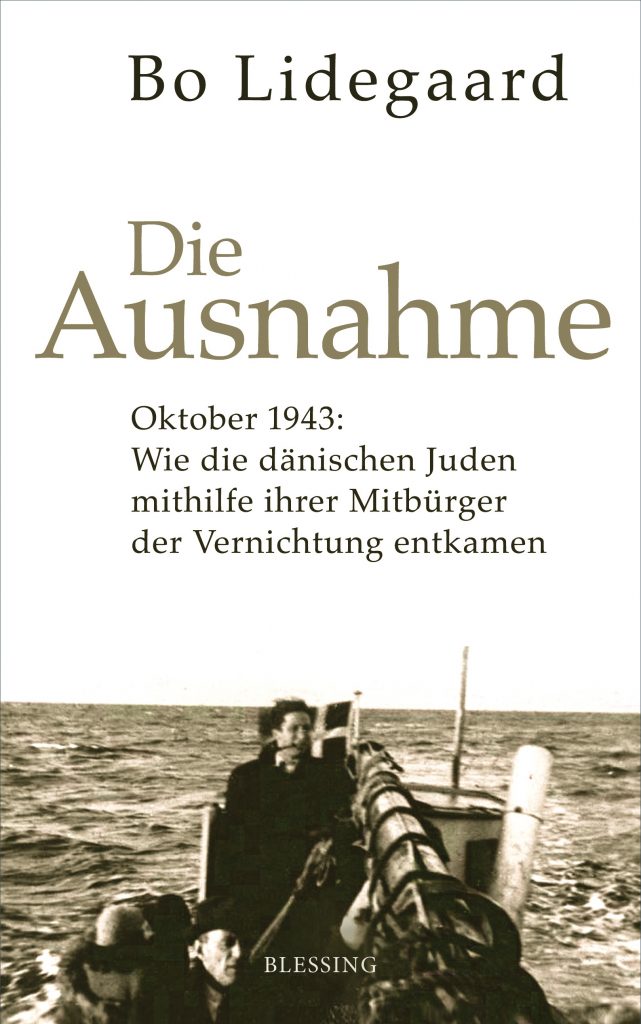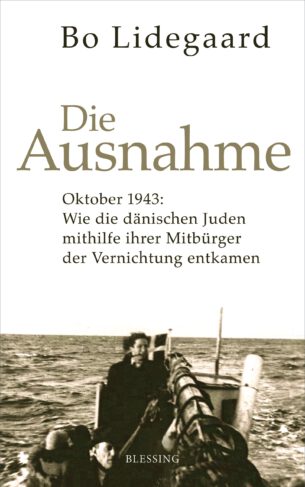Margaret Atwood: Die Zeuginnen
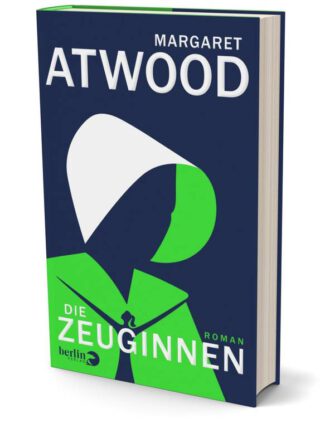
Inhalt:
Fünfzehn Jahre nach „Der Report der Magd“ erzählt die Autorin Margaret Atwood die Geschichte weiter. Drei Zeugenaussagen dreier Erzählerinnen aus dem totalitären Schreckensstaat Gilead zeigen, wie eines zum anderen führte und welchen Verlauf Desfreds Schicksal nahm. (eigene Inhaltsangabe)
Rezension:
Wenn ich von Verlagen offensichtliche Fortsetzungen von Erzählungen angetragen bekomme, erkundige ich mich danach, ob diese auch ohne Kenntnis des Vorgängerbandes zu lesen sind? Wenn dies der Fall ist, teste ich es gerne aus, mich in die Geschichte hinein zu finden, mit den Protagonisten Bekanntschaft zu schließen und ihren Weg zu verfolgen.
Nur dann macht ein vollständiges Eintauchen in das Geschehen Sinn. Auch hier hatte ich darum gebeten, mir nur dass Rezensionsexemplar zukommen zu lassen, wenn dies möglich sei. Ich bekam es.
Mit „Die Zeuginnen“ legt Margaret Atwood die von vielen Fans ersehente Fortsetzung zum „Report der Magd“ hin, deren Geschichte serienmäßig erfolgreich verfilmt wurde. fünfzehn Jahre nachdem die Buchdeckel zugeklappt sind, erfahren die Leser nun, was nach Handlungsende passierte. Der rote Faden aus dem totalitären theokratischen Phantasiestaat Gilead wird wieder aufgenommen und in Form von drei Zeugenaussagen, die einen stetigen Perspektivwechsel ergeben, weiter erzählt.
Das funktioniert für alle Leser von Beginn an, so sie mit dem Vorgänger-Werk vertraut sind, jedoch nicht für Leser, die erst jetzt auf das von Atwood geschaffene Konstrukt stoßen. Nur schwer gelingt dann der Einstieg, nur schwer die Zuordnung und Benennung, auch Einordnung der einzelnen Protagonisten. Erst im weiteren Verlauf gibt es eine kleine Auffrischung, für Neuleser Einführung in die Welt Gileads. Viel zu spät, auch im Vergleich mit anderen Fortsetzungsromanen.
Am ehesten liest sich „Die Zeuginnen“ noch als Parabel auf das Leben und Funktionieren einer theokratischen Diktatur, wie es sie in verschiedenen Formen in der realen Welt noch gibt. Die Autorin konstruiert eine Welt aus Lügen, Intrigen und Verrat und erzählt, was passieren kann, wenn einzelne Karten aus dem Kartenaus verschoben oder gar entfernt werden. Eine Lawine ungeahnten Ausmaßes wird losgetreten, die alles im Weg stehende mit sich reißt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die gibt es auch hier.
Der Perspektivwechsel trägt zur Verwirrung bei Erstlesern bei, denen unbedingt empfohlen sei, den Vorgängerband zuerst zu lesen. So, wie ich das getan habe, ist die Geschichte nicht zu konsumieren und dabei stellt sich dann auch kein Lesegenuss ein.
Ich kann praktisch nur auf die Beschreibungen der Diktatur als die von Atwood geschaffene Welt mich beziehen. Die Protagonisten indes blieben mir fremd und auch Hanndlungs- und Spannungsbögen, waren zwar erkennbar, doch für mich mit allzu großen Lücken durchsetzt.
Das reicht nicht aus, um mich bei Stange zu halten. Wahrscheinlich müssen jetzt erst einmal ein paar Jahre vergehen, ehe ich es wieder mit Margaret Atwood versuche. Vielleicht bleibt es aber auch nur bei diesem einen, erfolglosen Versuch. Andere Autoren teilen dieses Schicksal. Auch dafür gibt es Zeuginnen.
Autorin:
Margaret Atwood wurde 1939 in Ottawageboren und ist eine kanadische Schriftstellerin und Dichterin. Merfach ausgezeichnet, schrieb sie zahlreiche Romane, Essays und vielseitige Lyrik. „Der Report der Magd“ wurde vielfach ausgezeichnet und als Serie verfilmt. 2017 erhielt Atwood den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sie Ist Mitglied des Schriftstellerverbandes PEN.
Margaret Atwood: Die Zeuginnen Weiterlesen »