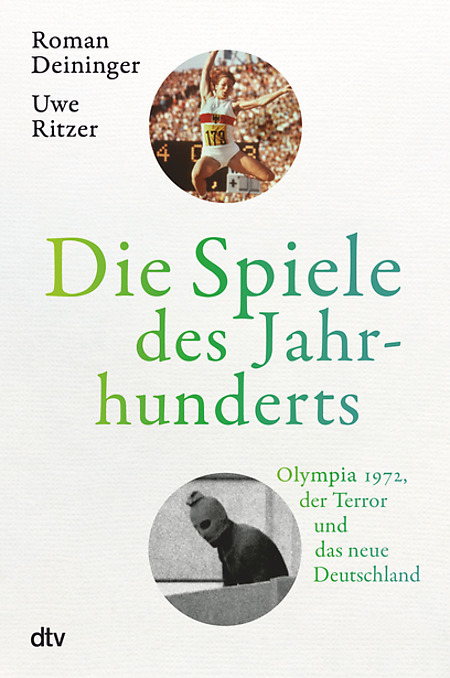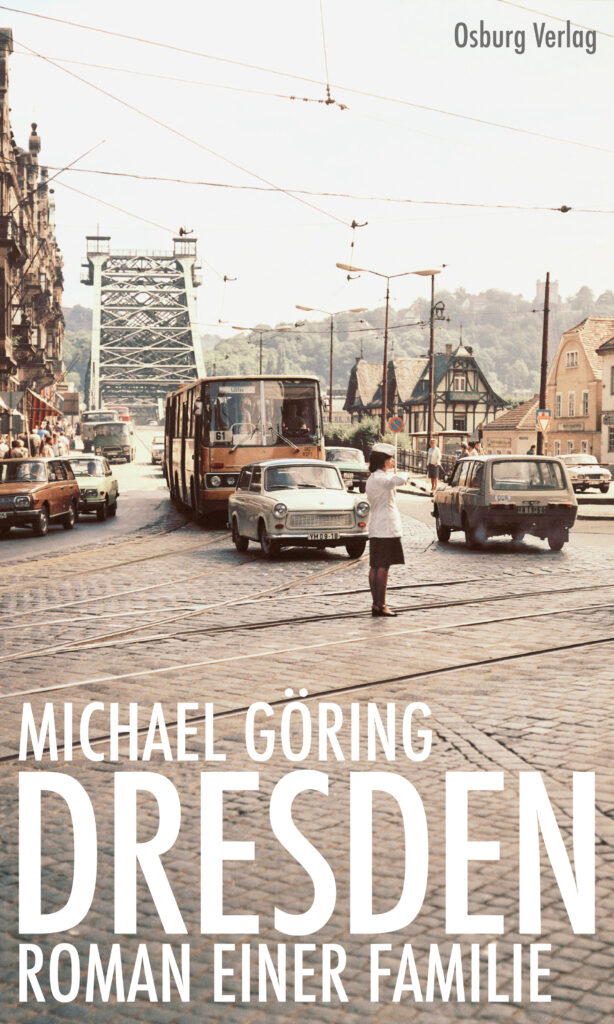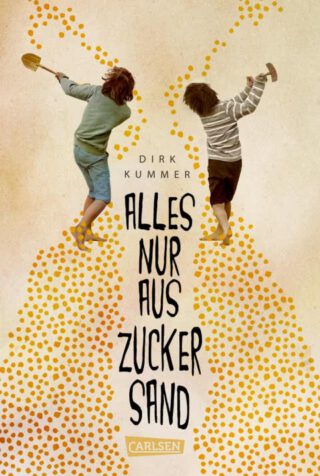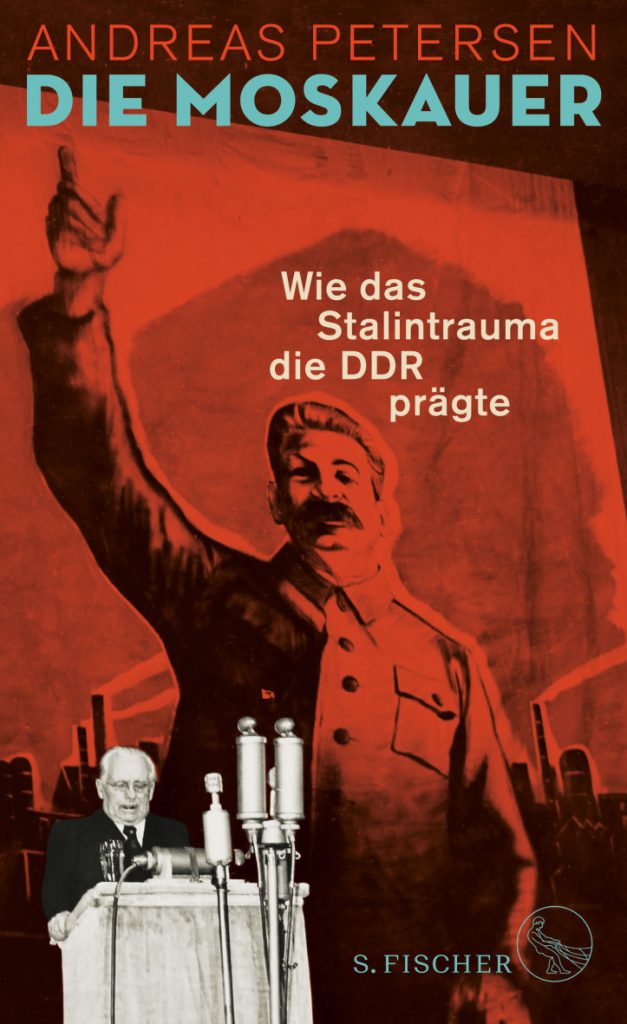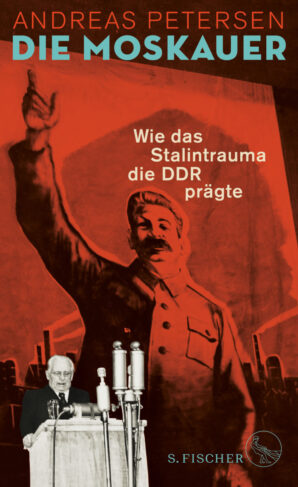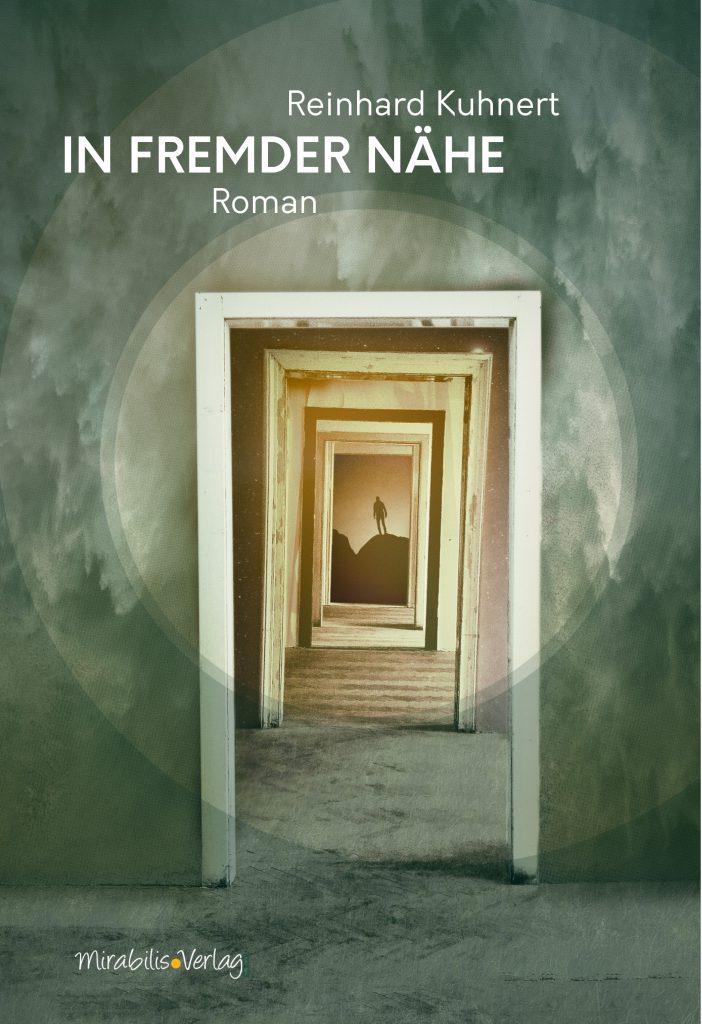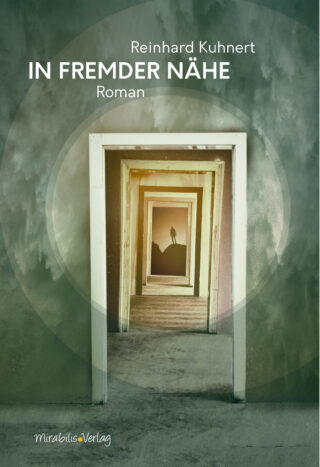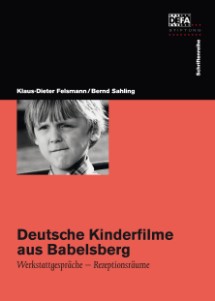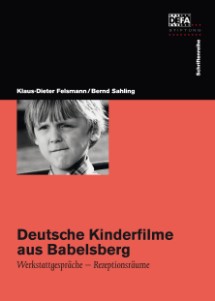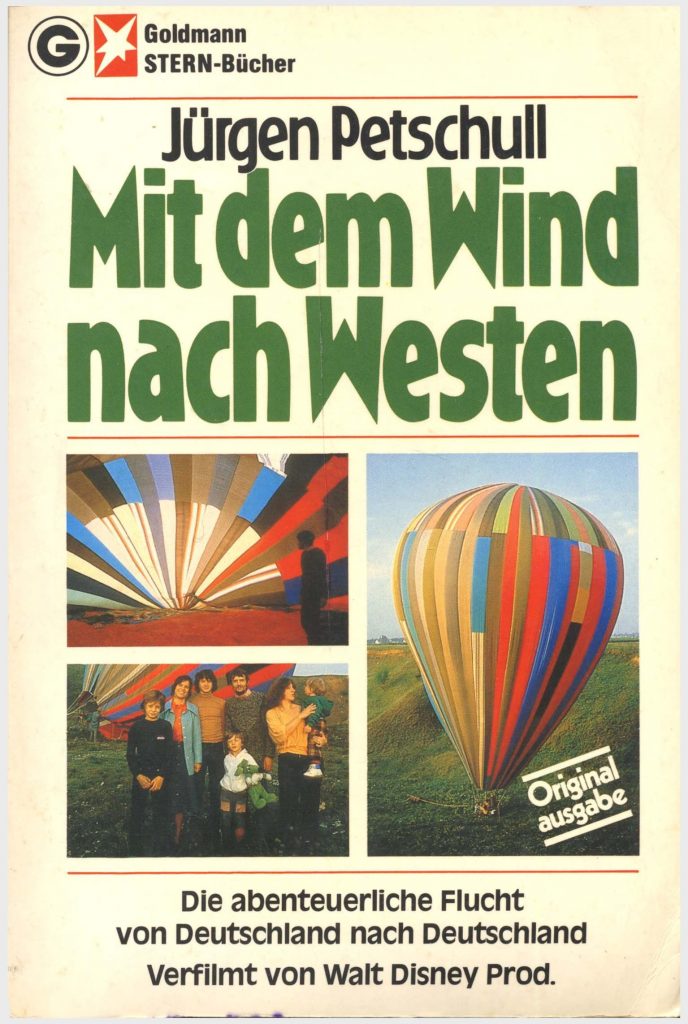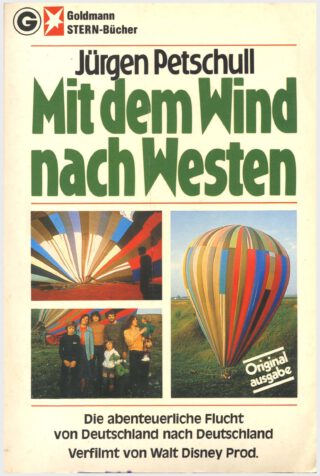Kerstin Apel: Der Kreuzworträtselmord
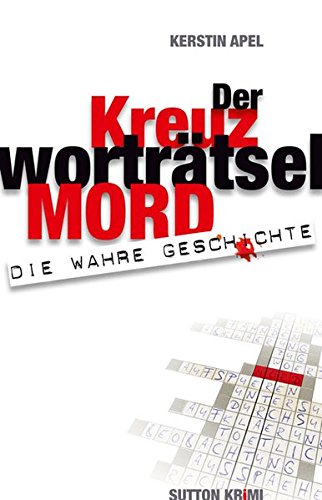
Inhalt:
Die Berliner Journalistin Shiva ist alles andere als begeistert, als ihr Chef sie aus dem lang ersehnten Urlaub in Oberhof reißt, um einen uralten, längst gelösten Kriminalfall neu zu recherchieren. Und damit will der die miese Auflage steigern?
1981 hatte der Kreuzworträtselmord die ganze Republik wochenlang in Atem gehalten und eine der größten Fahndungsaktionen der DDR ausgelöst. Aber der Täter wurde gefasst und hat seine Strafe abgesessen. Lustlos beginnt Shiva, Zeugen zu befragen und die Fakten zu rekonstruieren. An eine Story glaubt sie nicht so recht.
Nur, warum gibt sich die Polizei so zugeknöpft und wer versucht, den Täter zu verstecken? Als Shiva eine Zeugin ausfindig macht, wird sie angegriffen. Was ist damals wirklich geschehen? (Klappentext)
Rezension:
In der Kriminalgeschichte Ostdeutschlands gehören die Ermittlungen im Fall des Verschwindens und der Ermordung des siebenjährigen Lars Bense zu den bekannteren unter den Fällen der ehemaligen DDR. Als ein Langstreckenläufer entlang der Bahngleise den Koffer mit der Kinderleiche findet, tappen die Ermittler der Volkspolizei zunächst im Dunkeln.
Erst später führt eine beispiellose Sammlung von Schriftproben zur Ergreifung und schließlich zur Verurteilung des Täters, wie sie so unter dem rechtstaatlichen System der Bundesrepublik nicht möglich gewesen wäre.
So viel zur Geschichte selbst, die bereits in mehreren Fernsehserien zur Grundlage genommen, sowie in einigen Dokumentationen verarbeitet wurde. Bis zum Erscheinen des True Crime Romans galt der Fall als aufgeklärt, ohne offene Fragen. Die stellten sich jedoch 2013 der Staatsanwaltschaft, als Kerstin Apel im Sutton Verlag die Fiktionalisierung der Geschichte veröffentlichte. Das brisante, die Autorin war als junge Erwachsene 1981 mit dem Täter befreundet.
In „Der Kreuzworträtselmord – Die wahre Geschichte“ wird die Geschichte zunächst aus der Sicht der Lokaljournalistin Shiva erzählt, die diesen Fall noch einmal nachrecherchieren soll, um eventuell Details zu finden, die bislang noch unentdeckt geblieben sind, um ihren Beitrag dafür zu leisten, die kränkelnde Auflage ihrer Zeitung zu retten. Nicht ahnend, in welches Wespennest sie stochert, begibt sie sich auf Spurensuche, auf eine Zeitreise in die jüngere Kriminalgeschichte und in menschliche Abgründe hinein.
So viel zur Geschichte, deren Grundgerüst mit dem realen Fall hinlänglich bekannt sein dürfte und abgesehen von der blaß bleibenden Hauptprotagonistin keine neuen Facetten einbringt. Wer diesen Krimi liest, bekommt ein flüssig zu lesenden, aber nach Schema F ausgearbeiteten Roman, den man ebenso wie die Ermittlungsbehörden sich nur zu Gemüte führt, da die Autorinschaft Detailwissen vermuten lässt, welches sonst so nicht möglich ist.
Jedoch wird gleich zu Beginn durch den Verlag klar gestellt, dass hier reales Geschehen hinreichend verfremdet wurde, so dass sich hieraus nicht wirklich Aussagen ziehen lassen. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin auch ihre Ermittlungen 2014 wieder eingestellt.
Die Handlung, wenn auch absolut vorhersehbar, kommt dennoch schnell voran. Schreiben kann Kerstin Apel, auch ihr alter Ego, die Protagonistin, in der sie sich, wie auch immer, wiederfindet, ist nachvollziehbar dargestellt. Mit ihr kommt im zweiten Teil des Romans auch genug Tempo hinein, wenn auch der Abschluss im Blick auf die Rolle der Shiva nicht ganz rund wirkt. Da kommt das Autorinnendebüt dann doch zu sehr durch und die Schwächen in der nicht sehr tiefgehenden Ausarbeitung der Figuren.
Flüssig erzählt ist das alles, aber eben ohne wirkliche Überraschungen, immerhin ist keine Verklärung der Tat und auch sonst zu finden.
Bleibt die Frage, was wollte die Autorin mit diesen Kriminalroman erreichen? Ist die Fiktionalisierung eines schrecklichen Geschehens ausreichend, um dieses zu verarbeiten, vorausgesetzt, es ginge darum? Hat sie mit diesem zeitlichen Abstand verdeckt Wissen preisgeben wollen, was ihr damals aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen ist?
Wollte sie einfach einmal sich im Schreiben ausprobieren und hat dafür Ereignisse verwendet, zu denen sie Berührungspunkte hat? Gehen wir davon aus, ist es ihr gelungen, wenn auch der ganz große Wurf ausgeblieben ist.
Autorin:
Kerstin Apel wurde 1963 geboren und lernte als Schülerin in Halle-Neustadt den Täter kennen, dessen Verbrechen in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen sollte. Dies ist ihr erster Roman, mit dem sie das Erlebte 30 Jahre später zu verarbeiten suchte.
Kerstin Apel: Der Kreuzworträtselmord Weiterlesen »