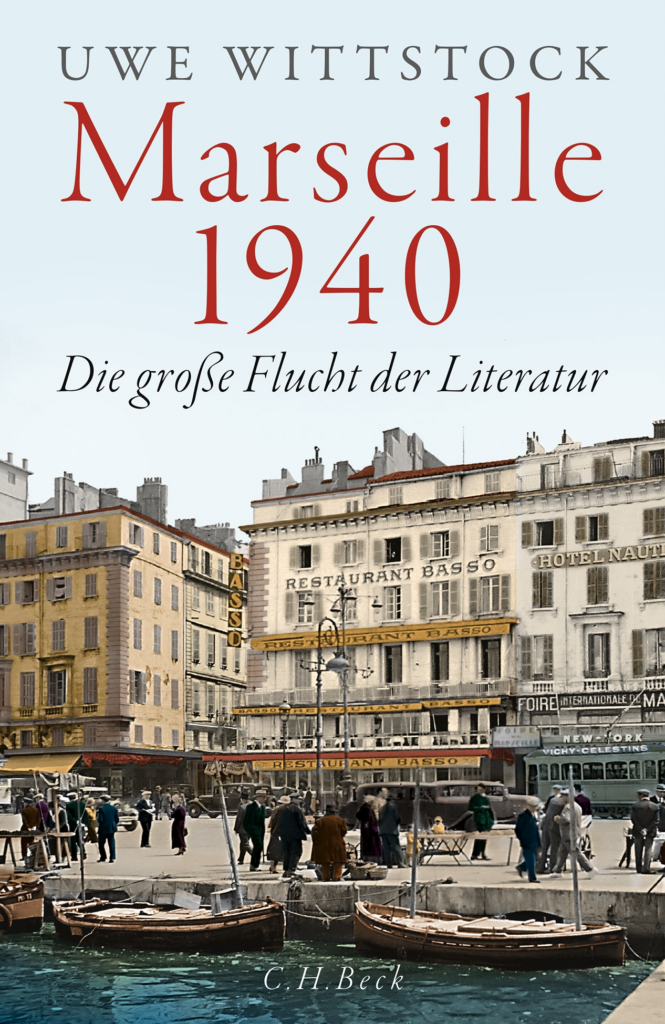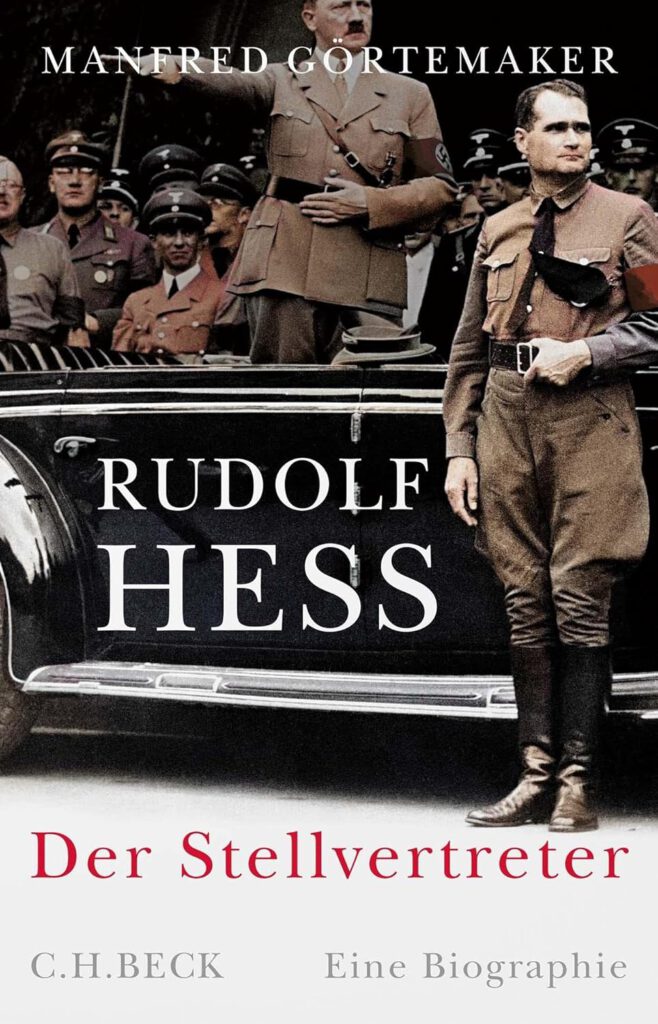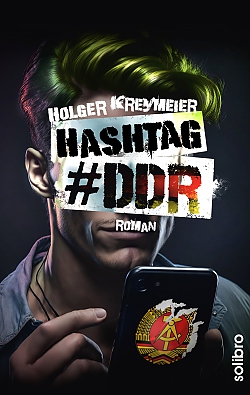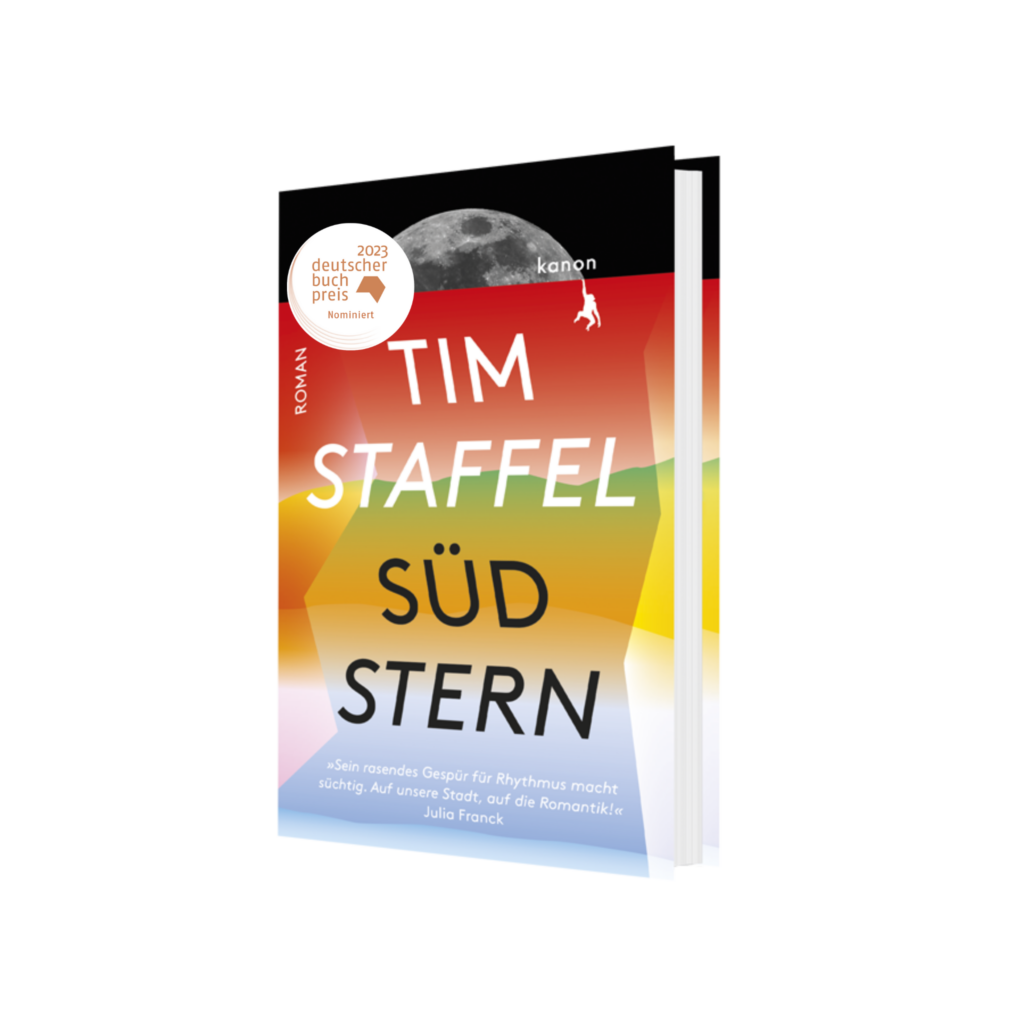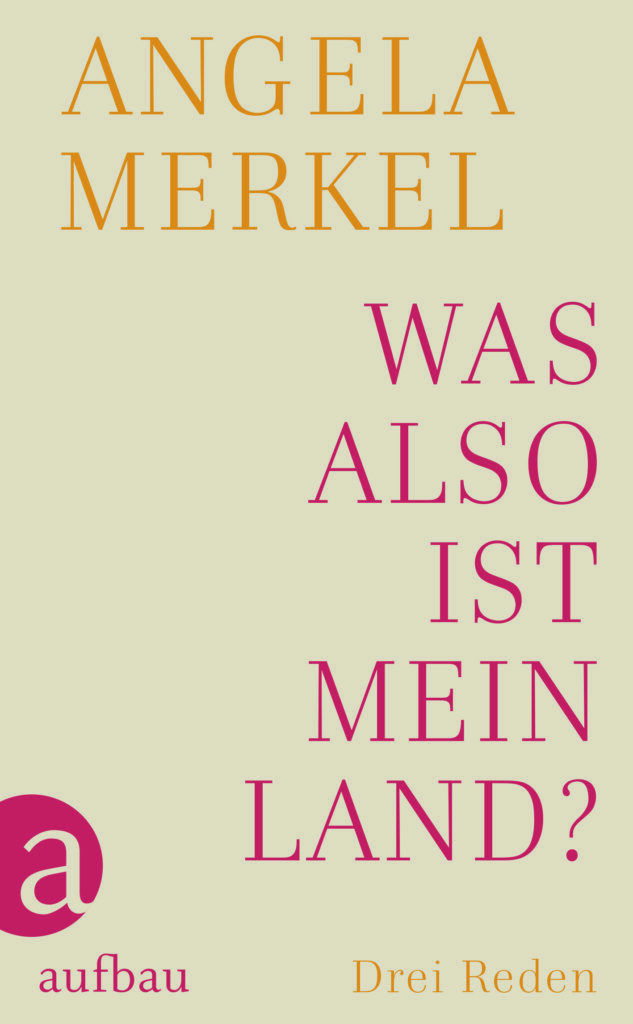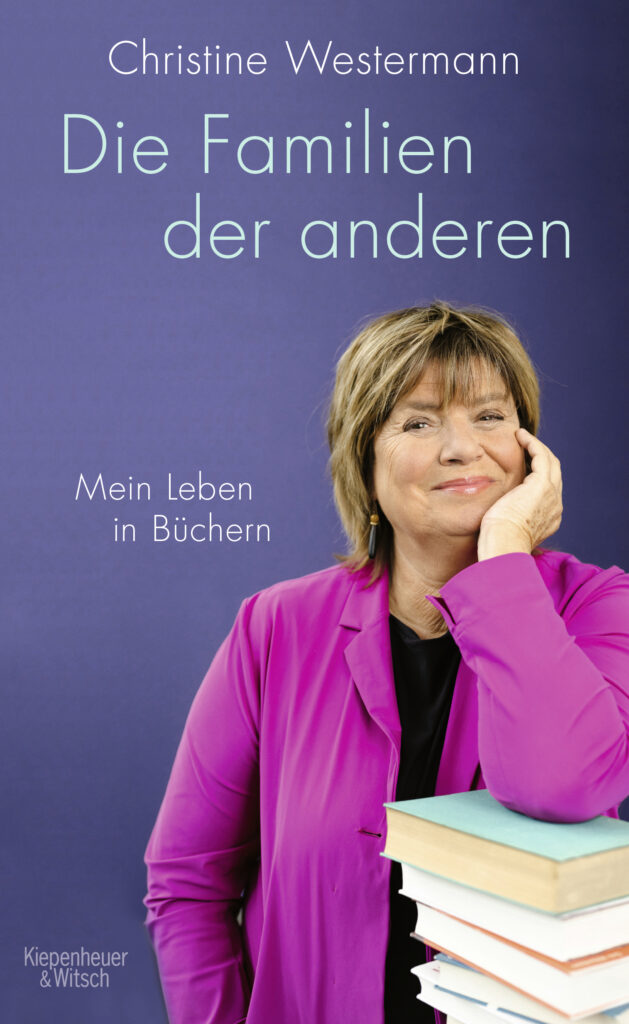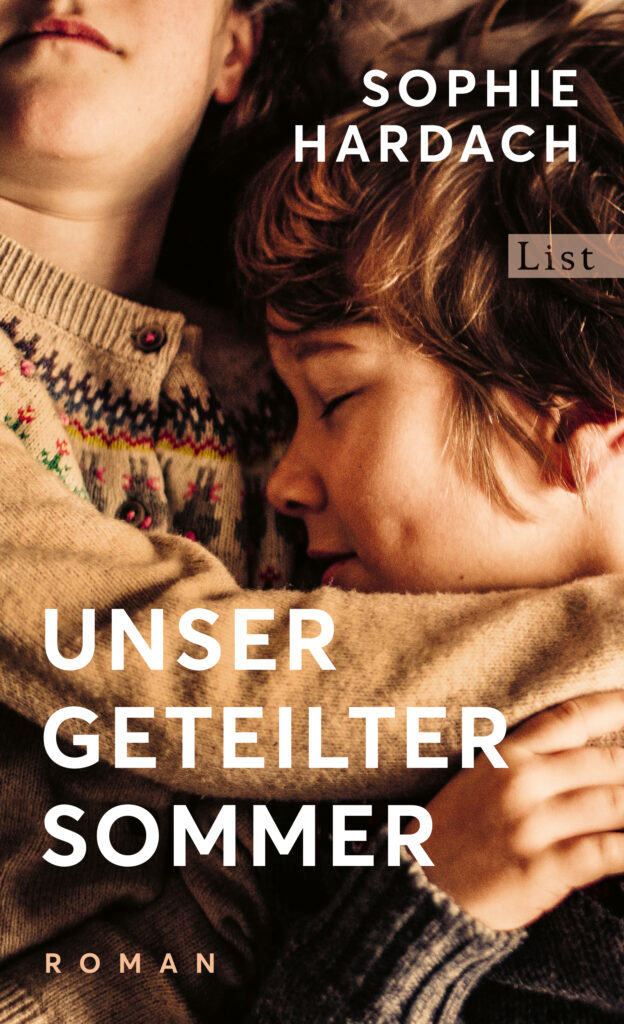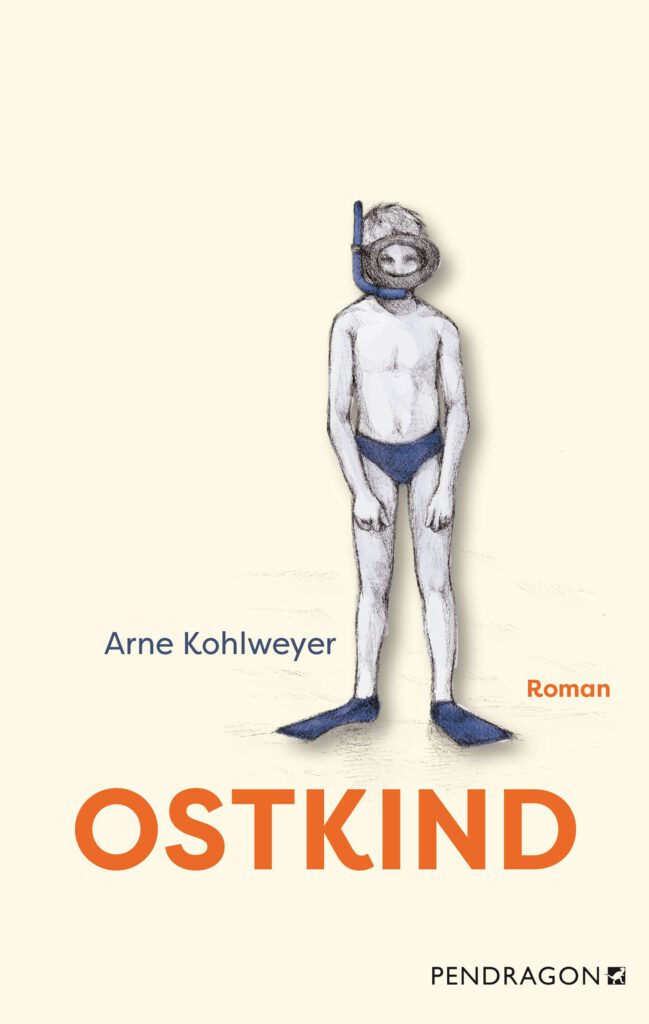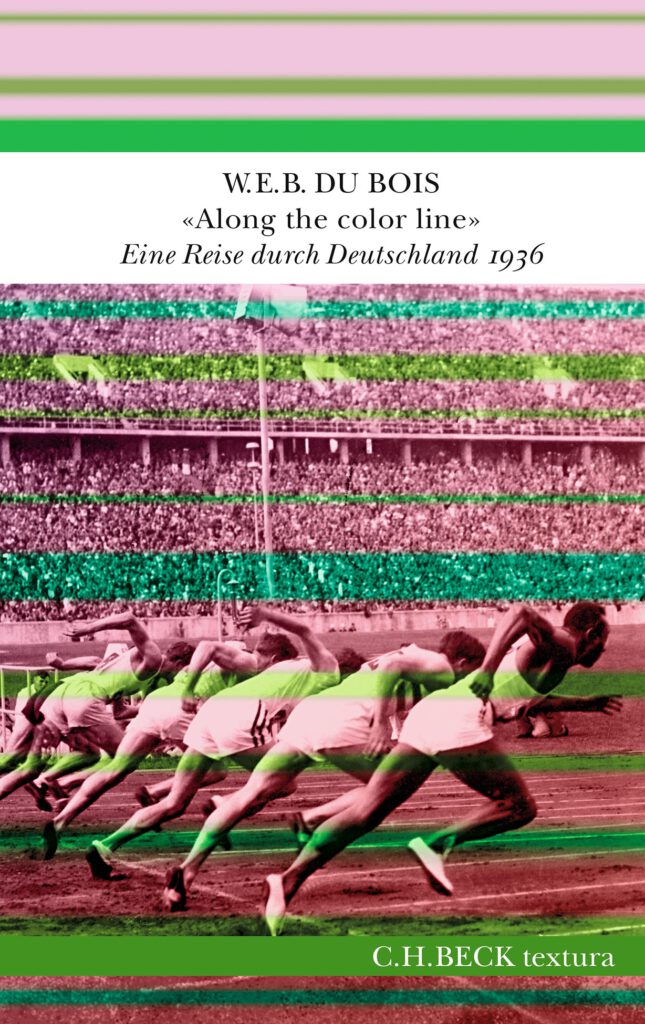Sabine Böhne-Di Leo: Die Erfindung der Bundesrepublik
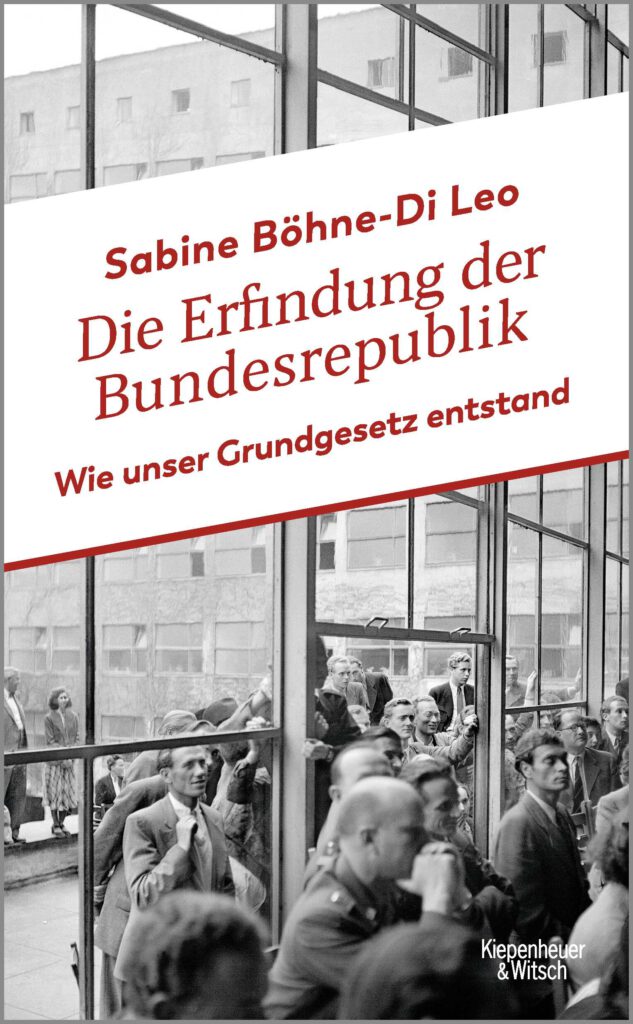
Inhalt:
Im Sommer 1948 beauftragen US-Amerikaner, Briten und Franzosen die westdeutschen Politiker, eine Verfassung zu schreiben. Monate leidenschaftlicher Diskussionen beginnen. Während die Abgeordneten in Bonn um das Grundgesetz ringen, wollen die Sowjets mit der Berlin-Blockade die Gründung des westdeutschen Staates verhindern. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. (Klappentext)
Rezension:
1948. In London ringen die westlichen Siegermächte und die Benelux-Staaten darum, Grundlagen für die Beteiligung eines demokratischen Deutschlands an die Völkergemeinschaft zu schaffen, woraus nach zähen Diskussionen die sogenannten Frankfurter Dokumente hervorgehen. Eine Verfassung sollen die Deutschen schaffen, für einen zu gründenden Weststaat. Jenen, die die Grundlagen erarbeiten sollen, steckt das Nazi-Regime noch in den Knochen, zudem ziehen dunkle Wolken vom Osten her auf. Die Sowjets riegeln Westberlin ab. Die Überreste der in Trümmern liegenden Stadt können sich nur mit Hilfe der Amerikaner am Leben erhalten, die eine Luftbrücke errichten, um die Berliner Bevölkerung zu versorgen.
Politikern wie Adenauer ist klar, das Gegengewicht in Form eines westdeutschen Staates muss schnell geschaffen werden, zudem, ein zweites Weimar muss um jeden Preis vermieden werden. So ringen bald in Bonn, der Stadt am Rhein, 61 Väter und vier Mütter um eine Verfassung, die nicht so heißen soll. Noch gibt es Hoffnung. Den Weg zu einem einheitlichen Deutschland befürchten sich manche damit zu verbauen. Leidenschaftliche Diskussionen um die Zukunft Deutschlands beginnen. Die Journalistin Sabine Böhne-Di Leo erzählt von diesen Tagen.
„Die Erfindung der Bundesrepublik“ erzählt als hoch informatives Sachbuch sehr kompakt über ein Lehrstück von Demokratiegeschichte, die erstmals auf deutschen Boden einigermaßen beständig und von Dauer sein sollte. Dabei folgt die Autorin den Geschehnissen verschiedener Schauplätze, zum einem das Ringen zwischen den Großmächten, die einst im Krieg als Verbündete, sich langsam mit ihren weltanschaulichen Systemen diametral gegenüberstehen sahen, zum anderen, in Bonn, jene Landespolitiker, die nun die Grundlagen für das künftige Zusammenleben in Deutschland erarbeiten sollten.
Ereignisse, die gegenseitig Sand im Getriebe bilden und doch zu Reaktionen auffordern, zeigt die Autorin um welche Fragen gestritten wurden, schon damals ersichtlich, sich für die Zukunft herausschälende politische Konkurrenten. Aber auch die Strukturen des künftigen Deutschlands stehen zur Diskussion, von der Frage, ob die Todesstrafe beibehalten soll und ob die Gleichberechtigung der Frauen ins künftige Verfassungsdokument gehört oder doch separat geregelt werden muss. Kurzweilig schildert die Autorin die Lust am Meinungsstreit, das Zuspielen von Bällen, aber auch, wie kurz vor knapp gelang, was ein Jahr später in die Gründung der Bundesrepublik münden würde.
Was in heutiger Zeit wieder bedroht ist, gelang damals unter Vorlage verschiedener schon in der Welt vorhandenen Verfassungen mit ganz eigenen Komponenten. Immer wieder wird bei der Lektüre deutlich, wo damals, noch unwissend ob der künftigen Geschehnisse, Stellschrauben geschaffen wurden, um derer wir in vielen Ländern beneidet werden. Sabine Böhne-Di Leo macht deutlich, die Geschichte unseres Landes hätte auch anderes beginnen und damit auch verlaufen können, wenn die Vorzeichen nur ein wenig anders gesetzt worden wären. Ein Glücksfall, dass es so gekommen ist. Die Lektüre zeigt, die Geschichte seiner Entstehung ist so spannend, wie das Grundgesetz selbst.
Autorin:
Sabine Böhne-Die Leo wurde 1959 in Bochum geboren und ist eine deutsche Journalistin und Hochschulprofessorin. Sie studierte zunächst Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte an den Universitäten Münster und Perugia und schloss das Studium 1985 ab. Nebenher arbeitete sie als staatlich geprüfte Italienisch-Übersetzerin für Polizei und Justiz. Nach journalistischen Anfängen bei der Münsterschen Zeitung, arbeitete sie im Journalistenbüro Kontur, sowie in Hamburg als freie Autorin für Zeitschriften und Magazine. 2009 wurde sie mit dem Deutschen Preis für Naturjournalismus ausgezeichnet, zudem wurde sie Professorin für den Studiengang Ressortjournalismus in Ansbach. Daneben baute sie eine Lehrredaktion auf und leitete diese zwölf Jahre lang.
Sabine Böhne-Di Leo: Die Erfindung der Bundesrepublik Weiterlesen »