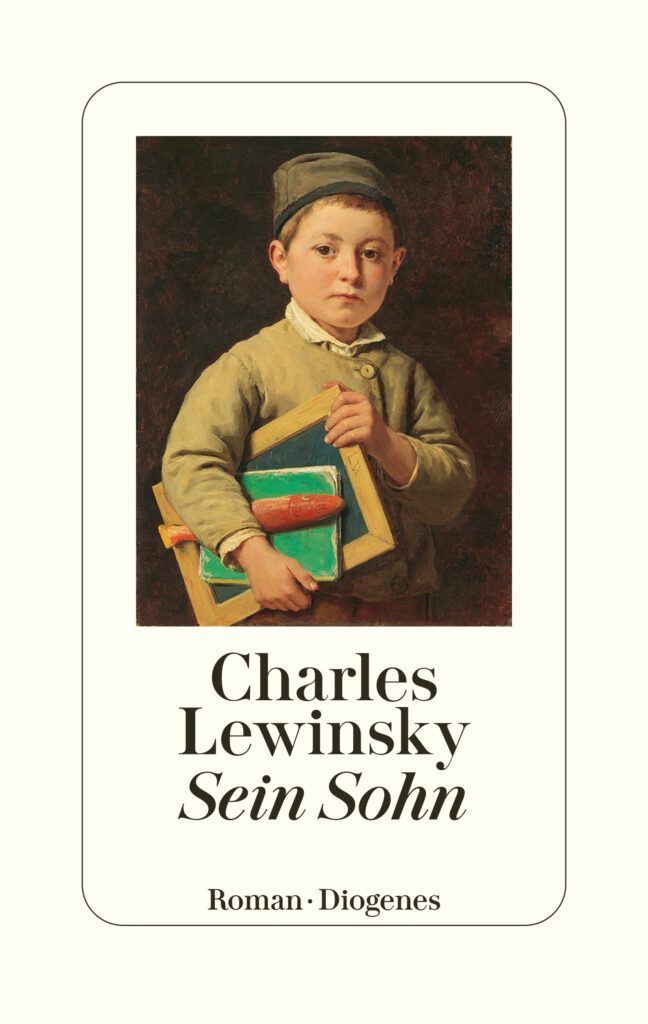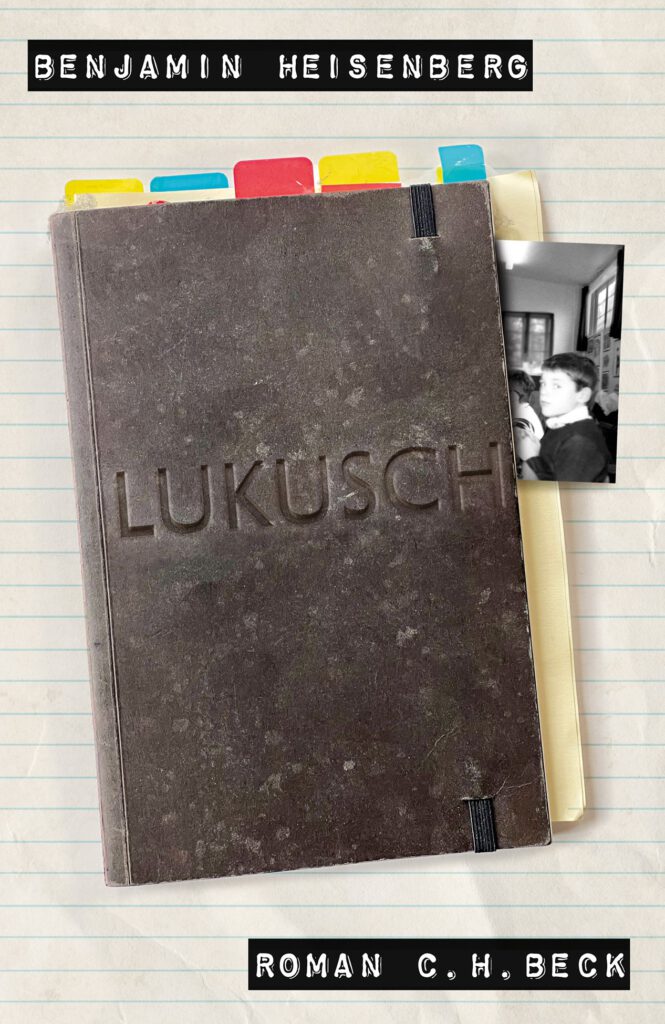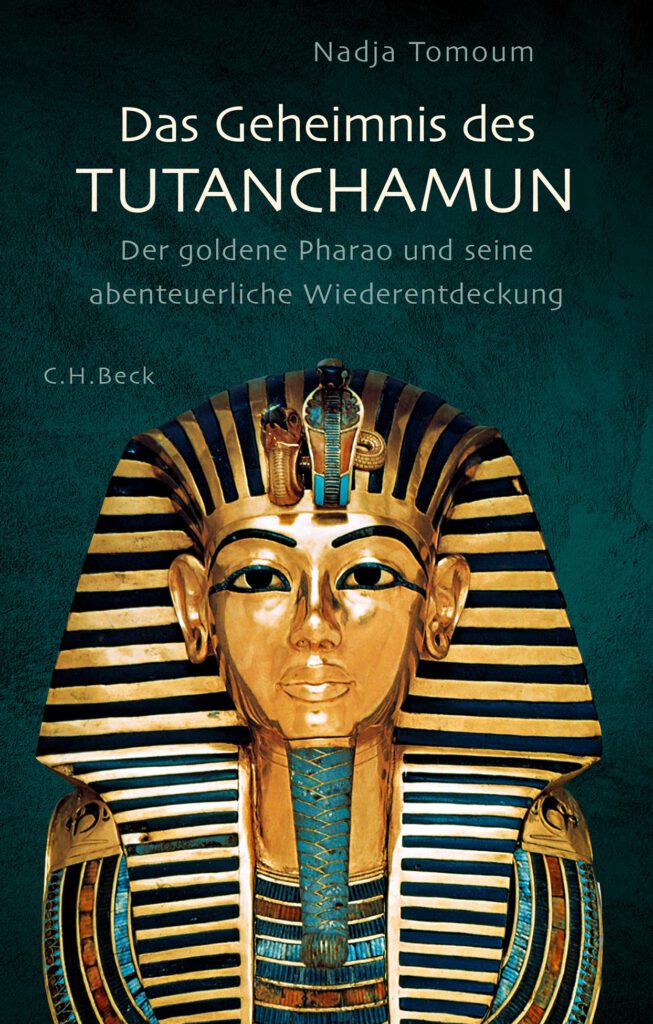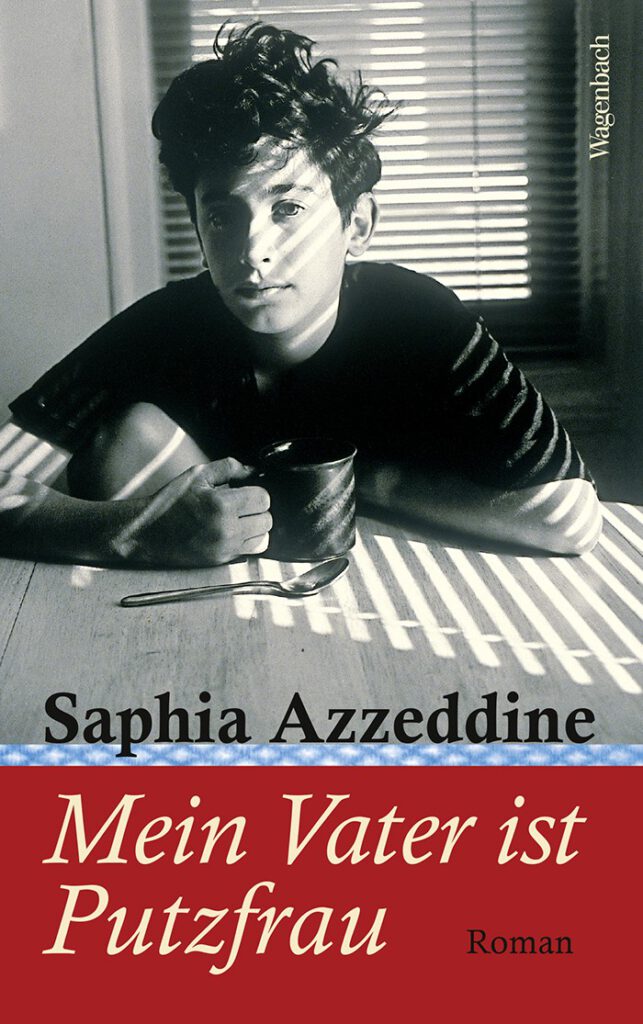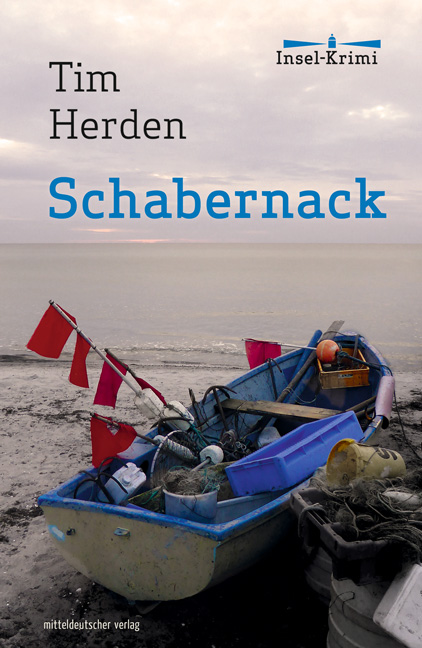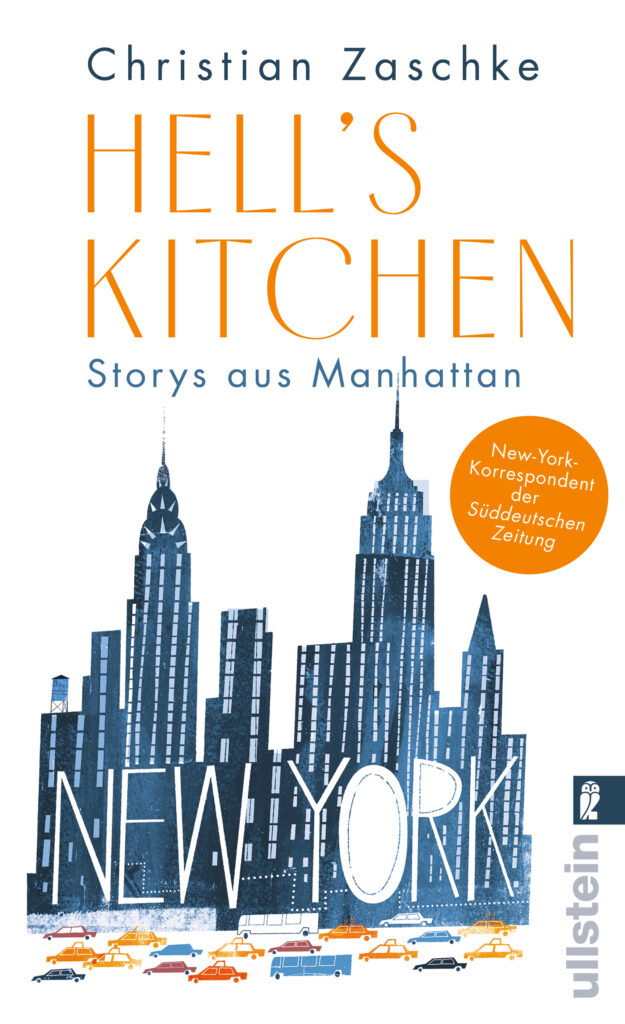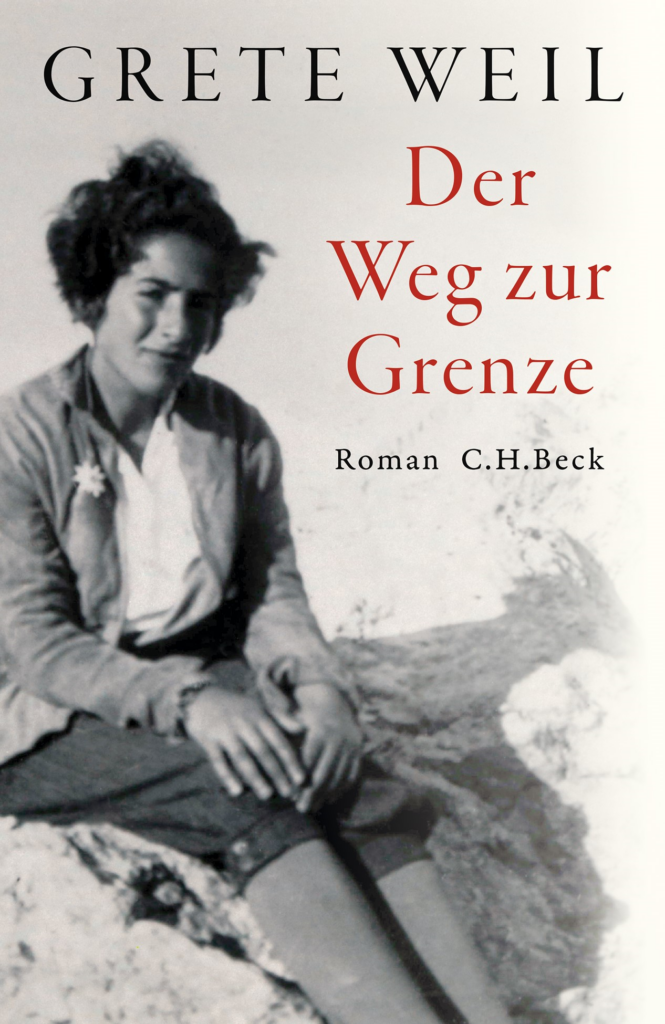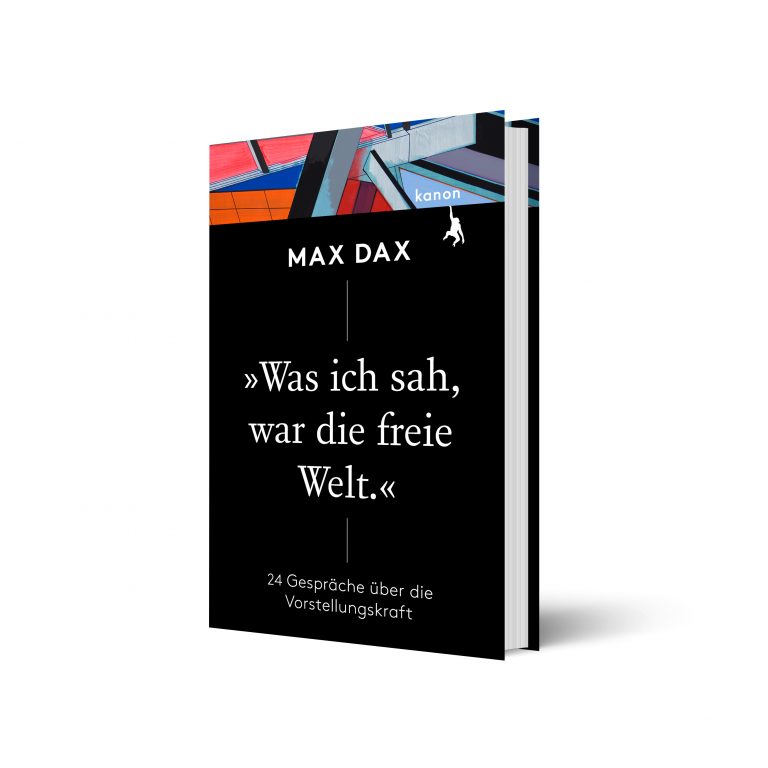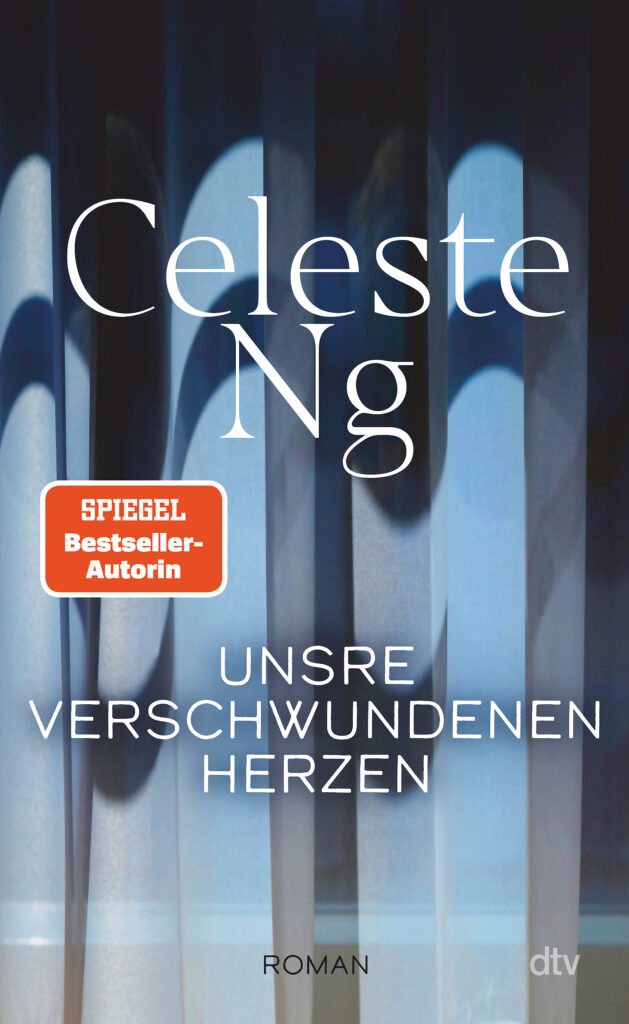Arne Kohlweyer: Ostkind
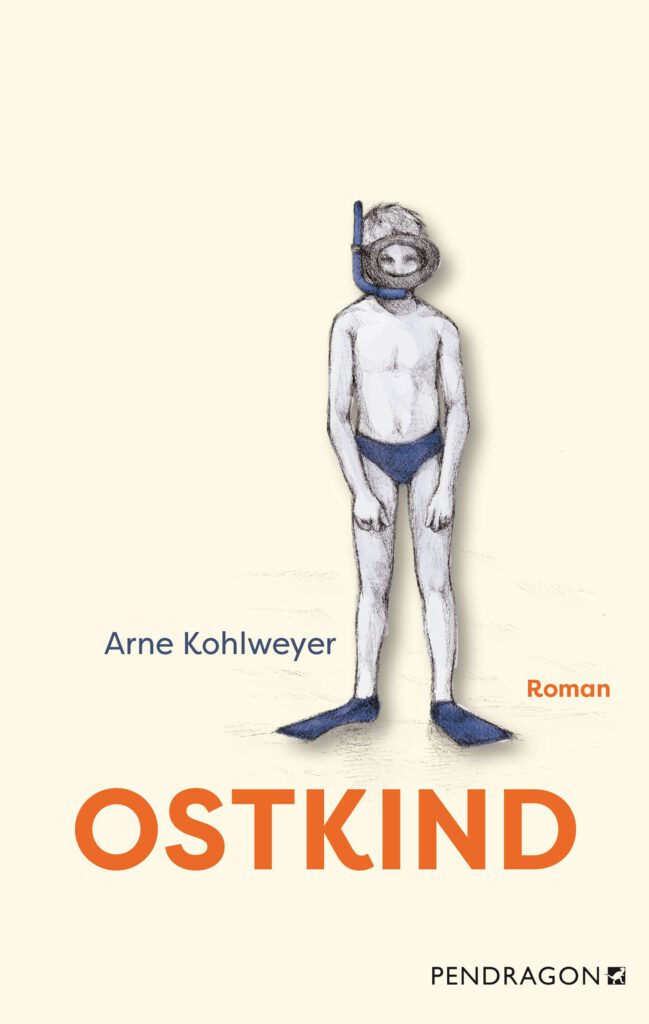
Inhalt:
1992 am östlichen Rand Berlins: Der neunjährige Marko hat es endgültig satt, wie ein kleiner Junge behandelt zu werden und will allen beweisen, wie erwachsen er sein kann. Er schreibt eine Liste mit Dingen, die man so macht als Erwachsener: Kaffee trinken, dicke Bücher lesen, den Walfang stoppen, rauchen und Anna heiraten. Anfangs läuft bei der Umsetzung noch alles nach Plan, doch das Erwachsensein stellt Marko zusehends vor große Probleme. (Umschlagstext)
Rezension:
Zunächst erscheint alles als heile Welt, in dem vorliegenden Romandebüt des Filmemachers Arne Kohlweyer, dessen Erzählung „Ostkind“ zwischen Coming of Age und Novelle pendelt. Wie jedes Jahr unternimmt die Familie des frisch neunjährigen Marko zu dessen Geburtstag einen Ausflug an den heimischen Badesee.
Mit seinem Geschenk, einem Schnorchel-Set, lässt sich der Protagonist fotografieren. Doch, die heile Welt bekommt bald Risse. 1992 steckt das ehemals geteilte Berlin noch inmitten der unmittelbaren Nachwirkungen der Wendezeit, in derer sich unzählige Biografien von einem Tag auf den anderen ändern. Markos Vater, zuvor Professor für Marxismus-Leninismus fährt nun Taxi. Der Junge registriert die Veränderungen um sich herum, ohne sie zu begreifen. Nur ernst genommen werden, möchte er und dafür so schnell wie möglich erwachsen werden.
Während er dafür eine Liste erstellt, mit Dingen, die man als Erwachsener eben so tut, brauen sich, ohne dass Marko es zunächst bemerkt, noch mehr dunkle Wolken am Himmel über die Familie zusammen. Dinge, die nicht einmal die wirklich Erwachsenen zu händeln wissen.
So viel zum Inhalt dieses zunächst sehr unscheinbaren, aber in allen Aspekten großartigen Romandebüts, welches die Lesenden auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle mitnimmt. Nichts ist, wie es scheint und so werden die zunächst kaum sichtbaren Risse bald unfassbar groß, zu groß für den liebevoll ausgestalteten Protagonisten, der sich nichts sehnlicher wünscht als wahr- und ernstgenommen zu werden, aber noch zu klein für die damit verbundenen Konsequenzen ist.
„Da war es wieder! Dieses ,Das verstehst du noch nicht‘, das sich manchmal als ein ,Dafür bist du noch zu jung‘ verkleidete. Je älter Marko wurde und je mehr er in der Schule lernte, desto häufiger schmetterten die Erwachsenen es ihm entgegen. Genau wie letztens auf seine Frage, wie denn eine Hand bitteschön treu sein könne …“
Arne Kohlweyer: Ostkind
Der behutsam ausgearbeitete Handlungsstrang deckt einen Zeitraum von gerade mal zwei Wochen ab. Trotz der sehr kompakten Art des Erzählens hat es der Autor geschafft, so viel an Themen hinein zu packen, dass es schwerfällt, die überschaubare Seitenzahl zunächst ernst zu nehmen. Das funktioniert jedoch wunderbar, können sich doch fast alle in die Hauptfigur hineinversetzen, die man einfach nur in den Arm nehmen und schützen möchte. Arne Kohlweyer hat Marko als wachen, intelligenten Jungen geschaffen, dessen Kindlichkeit feinfühlig ausgearbeitet, genauso wie die Hilflosigkeit der Erwachsenen ausgestaltet, die der Hauptfigur eine heile Welt erhalten wollen, ohne zu bemerken, dass nicht nur für sie die Situation immer mehr ins Unkontrollierbare kippt.
Die bereits angesprochene Themenvielfalt ist glaubhaft, ebenso wie das gesetzte Zeitkolorit, welches nur ein Hintergrundrauschen darstellt, und schafft einen eigentümlichen Roman, der sowohl als Jugendbuch, wenn bereits ein wenig Wssen vorhanden ist, gelesen werden kann als auch als Novelle, die es in sich hat. Kinder sehen, begreifen viel mehr, als das die Erwachsenen denken. Auch schmerzhafte Wahrheiten können sie erfassen. Die Katastrophe aber stellt sich dann an, wenn dieser Aspekt unberücksichtigt gelassen wird, zumal wenn es ein enges Familienmitglied betrifft.
Arne Kohlweyers liebevolles Plädoyer kann nicht gelesen werden, ohne zwischendurch tief durchzuatmen, die Seiten einmal kurz wegzulegen und lohnt sich dennoch. Auch szenemäßig umgesetzt ist dies hervorragend. Hier merkt man das Fachgebiet des Autoren an. Fast ist es so als hätte man eine Mini-Serie in Buchform vor sich. So komponiert ist das großartig.
Autor:
Arne Kohlweyer ist ein deutscher Regisseur und Drehbuchautor, der zunächst Filmregie in Prag studierte, ebenso Fotografie, Literaturwissenschaft und Filmtheorie. Er führte Regie bei mehreren TV-Auftragsproduktionen und wurde 2017 als Autor und Regisseur für den Grimme-Preis nominiert. Seit 2010 ist Kohlweyer Mitglied im Verband Deutscher Drehbuchautoren und arbeitet heute als freiberuflicher Autor, dramaturgischer Berater und Associate Producer. „Ostkind“, ist sein Romandebüt.
Arne Kohlweyer: Ostkind Weiterlesen »