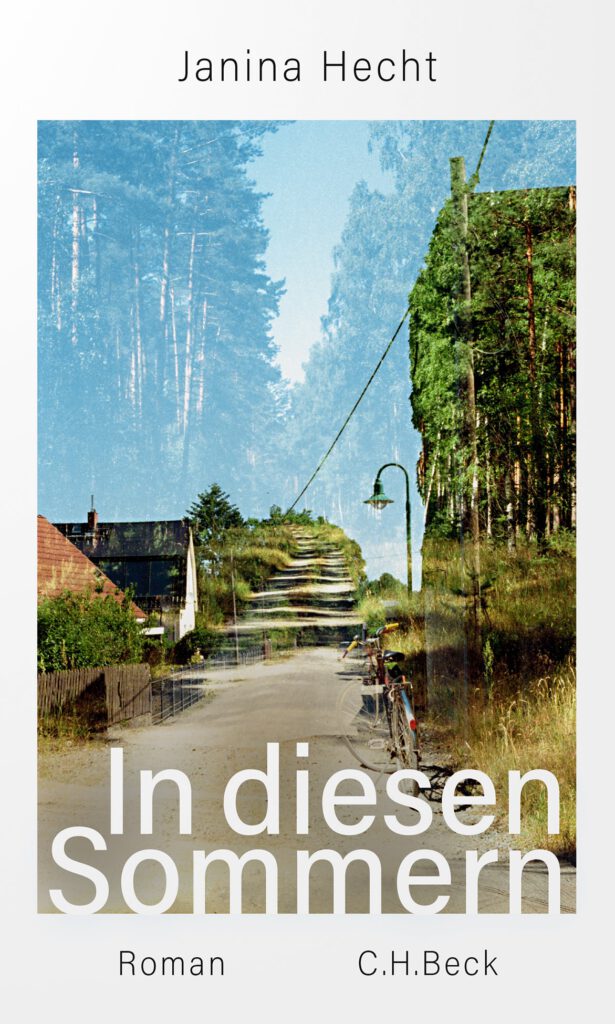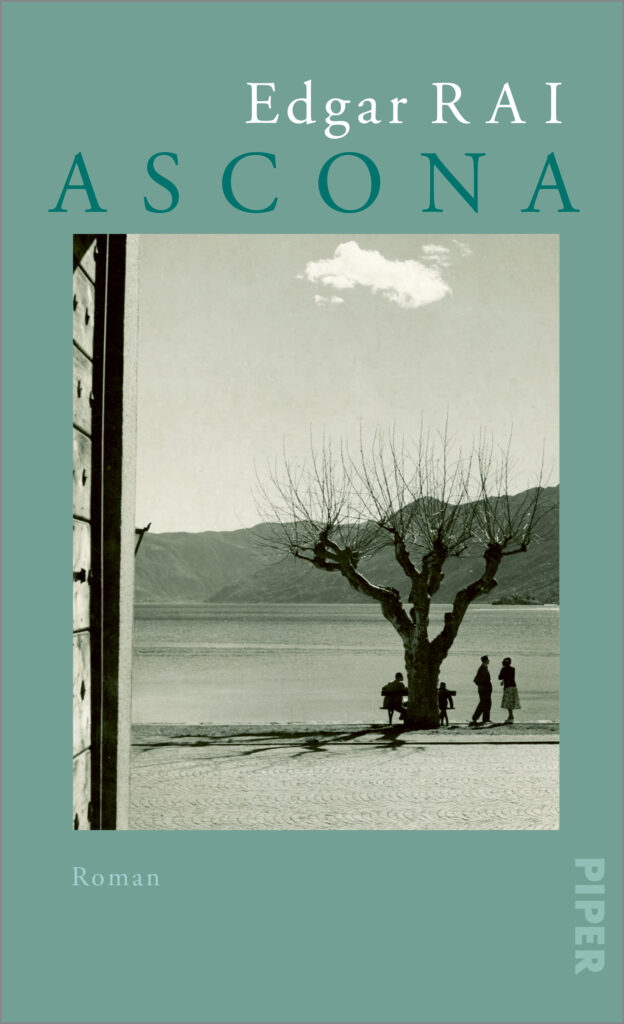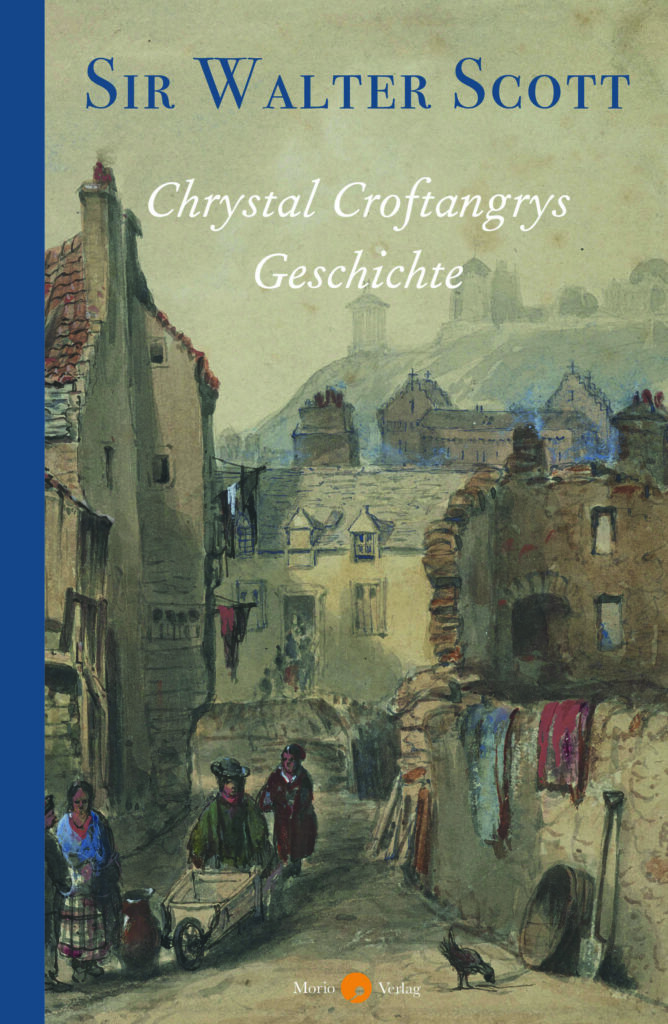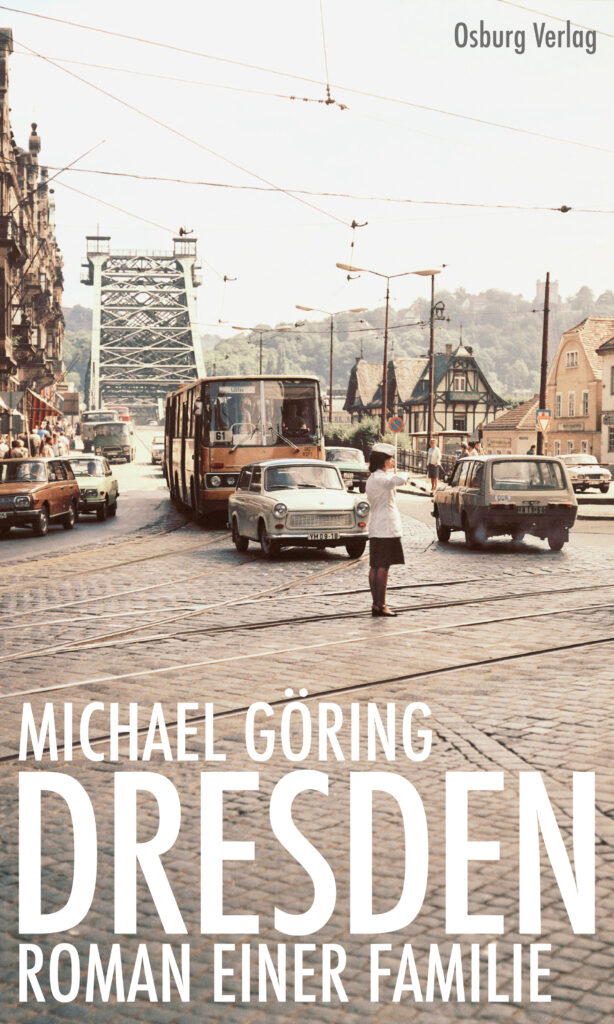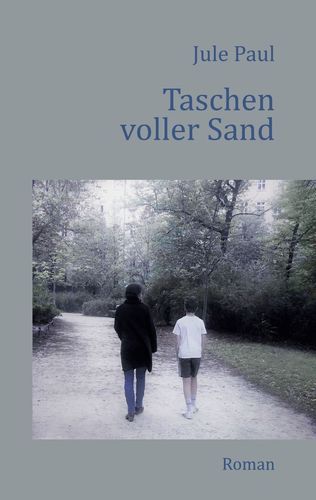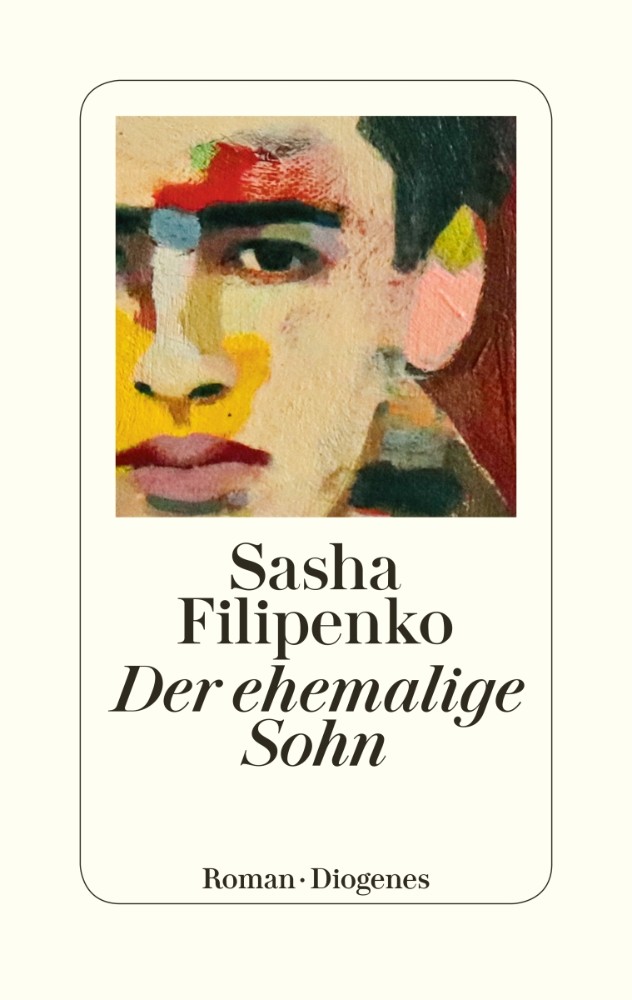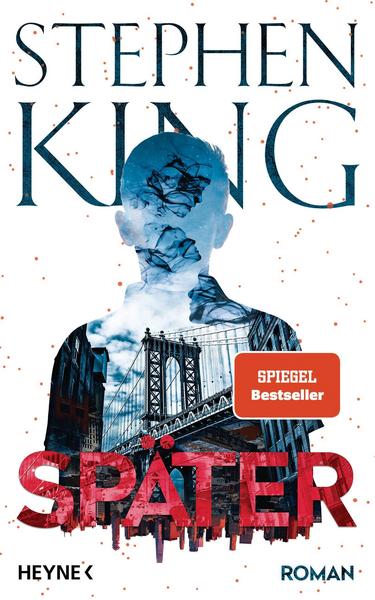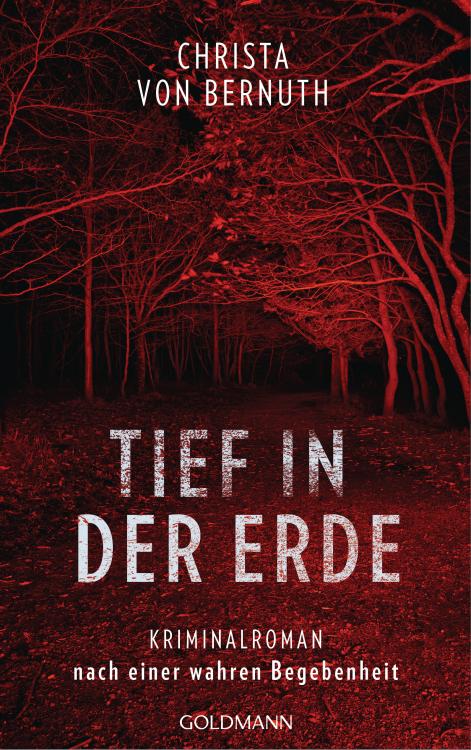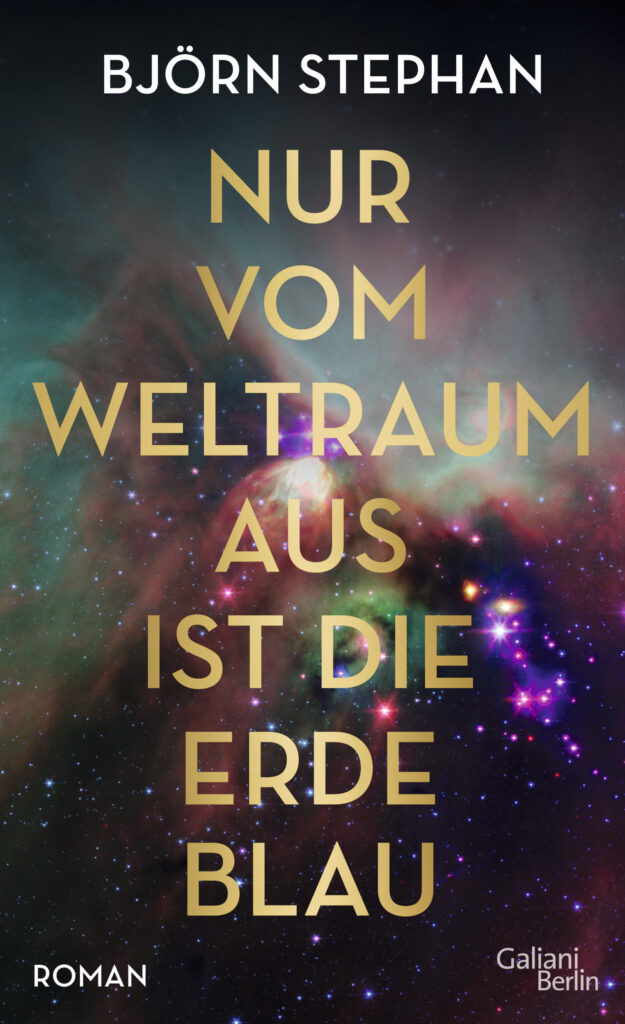Andreas Moster: Kleine Paläste
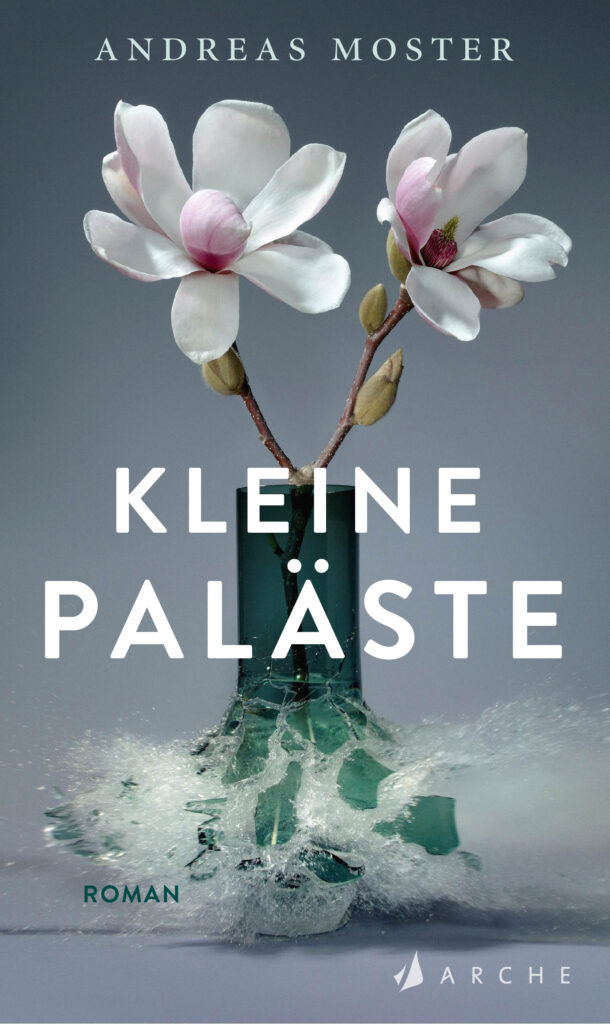
Inhalt:
Mehr als dreißig Jahre haben sich die früheren Nachbarskinder Hanno Holtz und Susanne Dreyer nicht gesehen. Als jugendlicher verließ Hanno die heimatliche Kleinstadt urplötzlich, nun ist er zurückgekehrt, um sich nach dem Tod der Mutter um den Vater zu kümmern. Unsicher streift er durch eine Welt, die im näher und fremder nicht sein könnte. Susanne sieht ihm dabei zu.
Seit Jahrzehnten hat sie das Haus der Familie Holtz nicht aus den Augen gelassen. Als sie Hanno ihre hilfe anbietet, treffen Erinnerungen an ein Fest im Sommer 1986 aufeinander. Niemand blieb damals unversehrt – und niemand kann nun verhindern, dass immer mehr Licht durch die Risse der kleinen Paläste dringt. (Klappentext)
Rezension:
Das Haus herausgeputzt, den Sohn vor versammelter Nachbarschaft dazu angetrieben, sein Instrumentenspiel vorzuführen. Schiefe Töne, schiefe Blicke. Des Nachbarsmädchens und der Nachbarn, jene Gemeinschaft, die sich allesamt näher sind als sie glauben und doch wie Geier einander umkreisen. Nur keine Schwäche zeigen. Nur die Fassade wahren. Keinen Blick dahinter zulassen.
Der Übersetzer und Schriftsteller Andreas Moster hat sie geschrieben, diese Erzählung, die nach und nach unter die Haut geht, niemanden unberührt lässt. Es ist ein leiser Roman, zumindest zu Beginn beinahe unscheinbar. Langsam ist das Erzähltempo, doch schon die ersten Kapitel fordern die Lesenden heraus.
Perspektiven wechseln ebenso abrupt, wie Zeitebenen, ohne dass dies besonders gekennzeichnet wäre. Nur in der Draufsicht bemerkt man, wer wen beobachtet. Erinnerungen werden aus der Sicht der Protagonisten, alles kreist um die beiden Hauptfiguren, die nach und nach das Puzzle der Vergangenheit freisetzen, klarer.
Dieser Gesellschaftsroman zeigt die typische Dynamik einer Kleinstadt auf, in der alle einander zu kennen glauben und doch, einmal aufgedeckt, nichts mehr ist, wie es mal war. Die Fallhöhe der Protagonisten, in die der Autor mit immer schnelleren wechseln, die jedoch allesamt nachvollziehbar bleiben, ist unglaublich hoch.
Die Lesenden beobachten, was über Jahrzehnte zwischen den beiden Hauptfiguren unausgesprochen bleibt. Als würde man direkt in deren Umgebung sein und einem Konflikt beiwohnen, der nur sie etwas angeht. Hölzern, fast linkisch, scheu begegnen sie sich zunächst und spielen sich ein. Ein Team wider Willen und doch willens. Mit inneren ungelöst aufgestauten Konflikten.
Sprachlich ist das so unscheinbar ausgearbeitet, dass einzelne Sätze einem mit einer Wucht überfallen, die man nicht erwartet, die einem nachdenklich werden lassen. Was wäre, wenn Unaussprechliches in unserer unmittelbaren Nachbarschaft geschehen würde?
Was würde passieren? Wie würden Verhältnisse sich neu ordnen? Welche Bindungen wären nicht mehr zu kitten? Was wäre für immer zerstört? Wie hätte man eingreifen, bestimmte Dinge verhindern können? Große Fragen, die Protagonisten beginnen zu Beginn der Geschichte die Verarbeitung.
Jeder Handgriff am pflegebedürftigen Vater Hannos, jeder Handgriff am renovierungsbedürftigen Elternhaus steht symbolisch dafür. Der leise Schrei, der hätte laut sein sollen, aber nie die Chance dazu hatte, so zu werden. Andreas Moster ist das Kunststück gelungen, dies auf Papier zu bringen.
Autor:
Andreas Moster wurde 1975 in der Pfalz geboren und ist ein deutscher Übersetzer und Schriftsteller. Zunächst studierte er Englische Philologie, Geschichte und Kommunikationswissenschaften und arbeitete danach als freier Übersetzer. 2017 erschien sein erster Roman „Wir leben hier, seit wir geboren sind“. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg.
Andreas Moster: Kleine Paläste Weiterlesen »