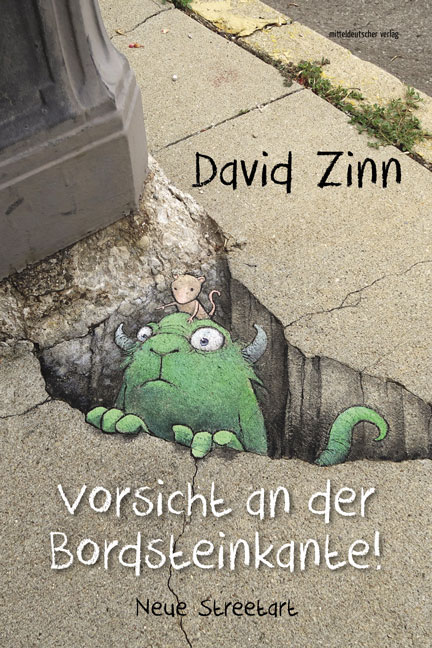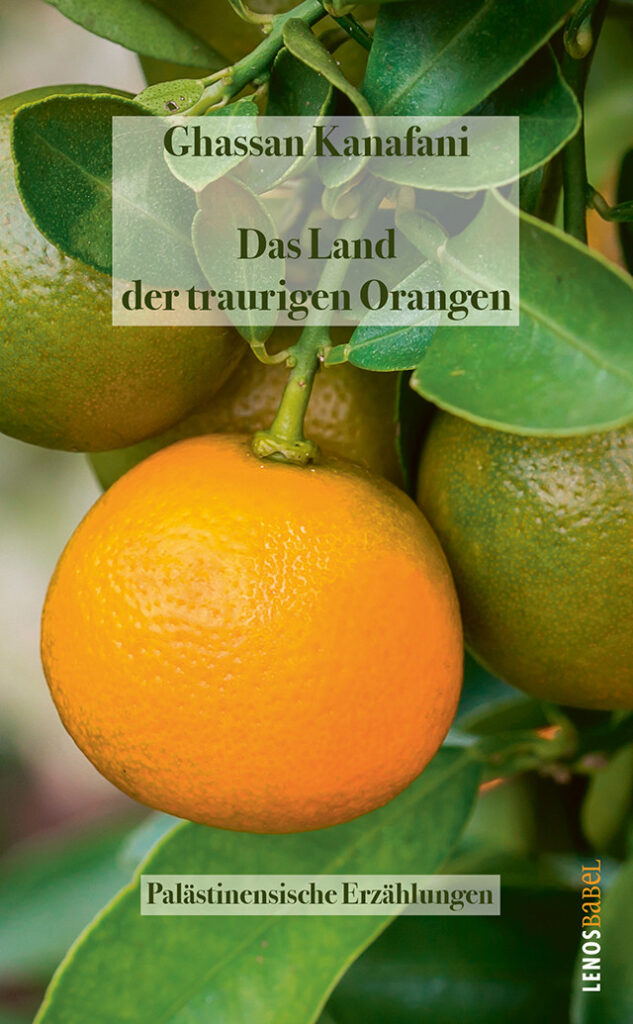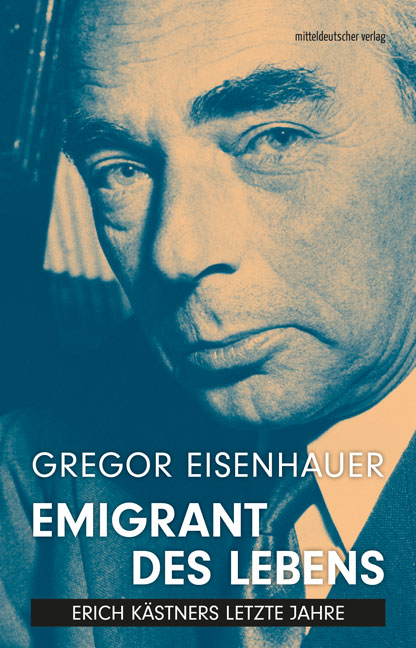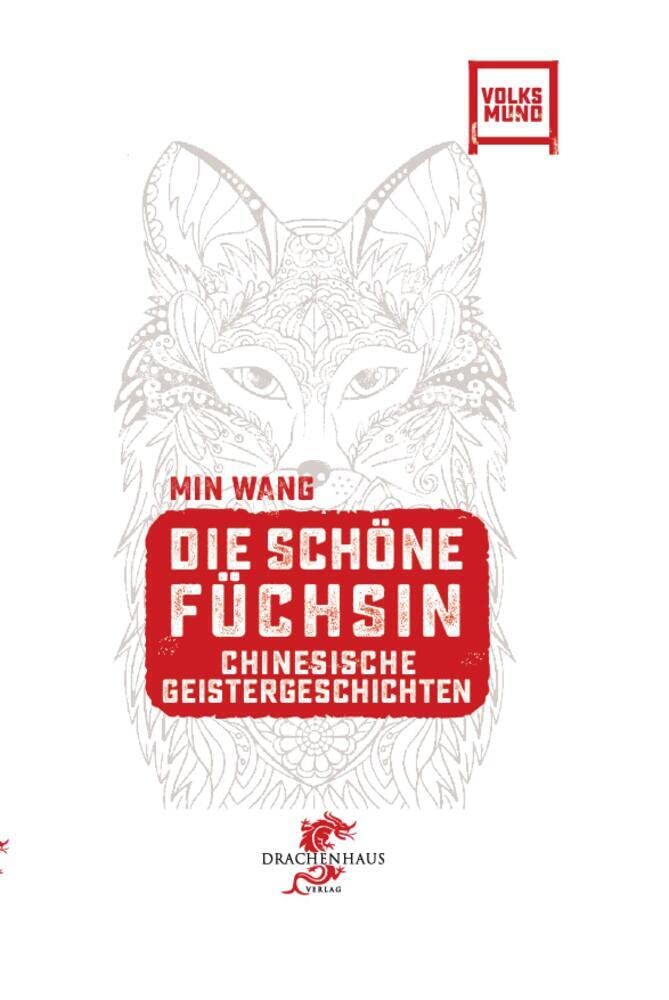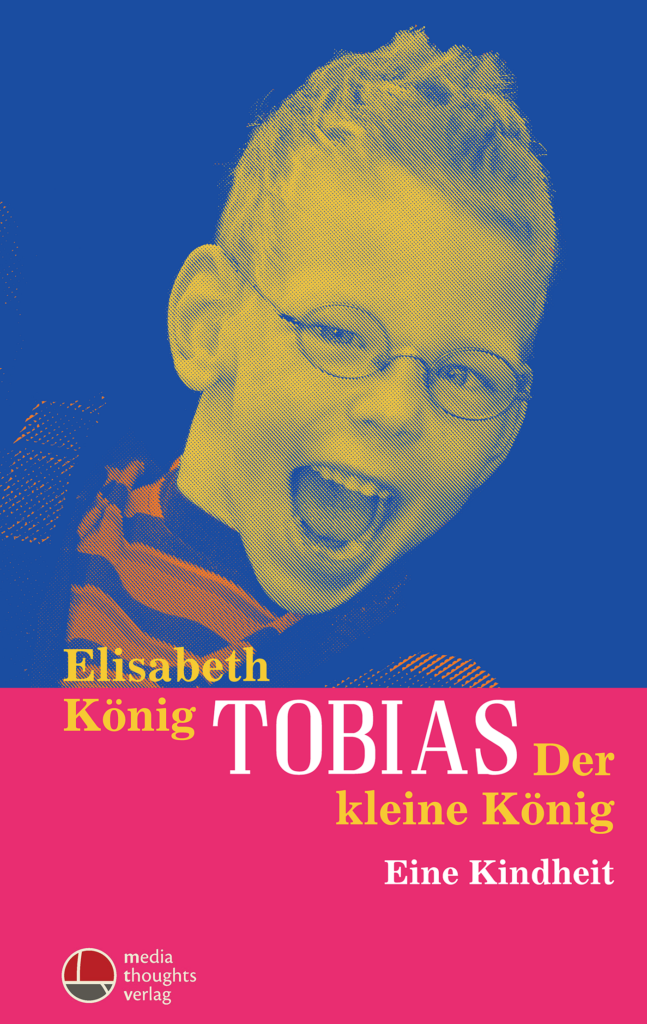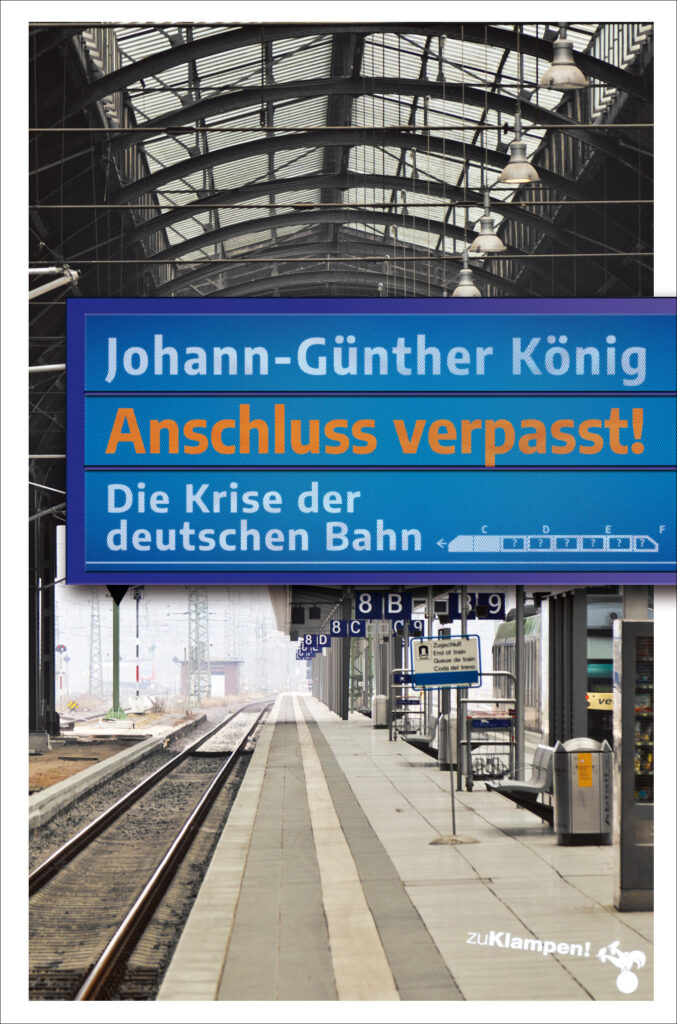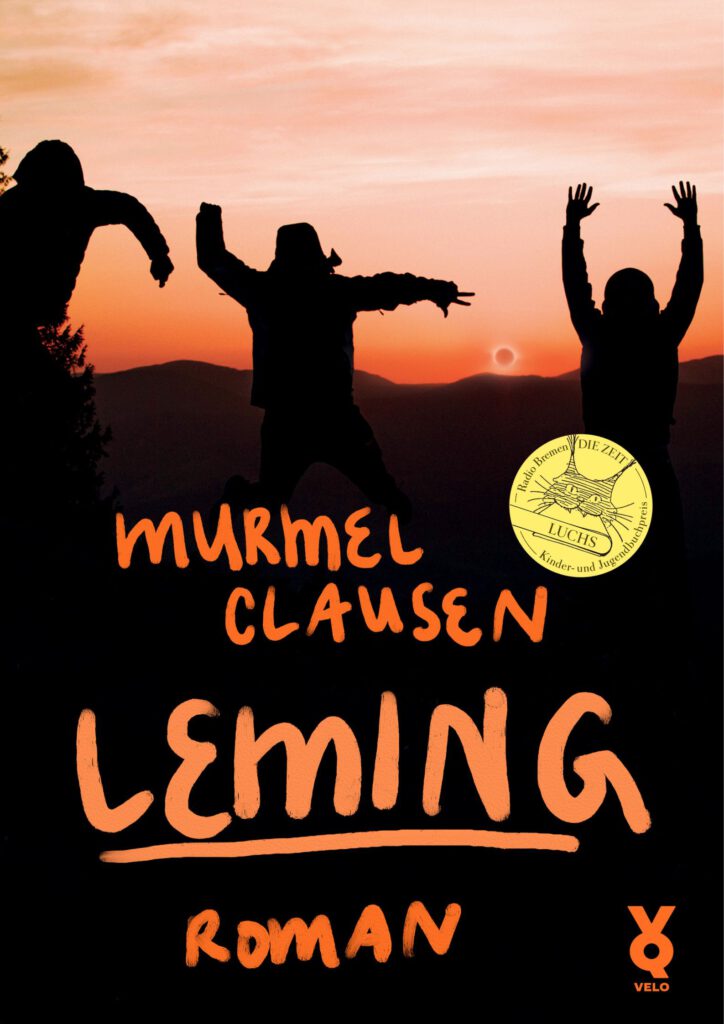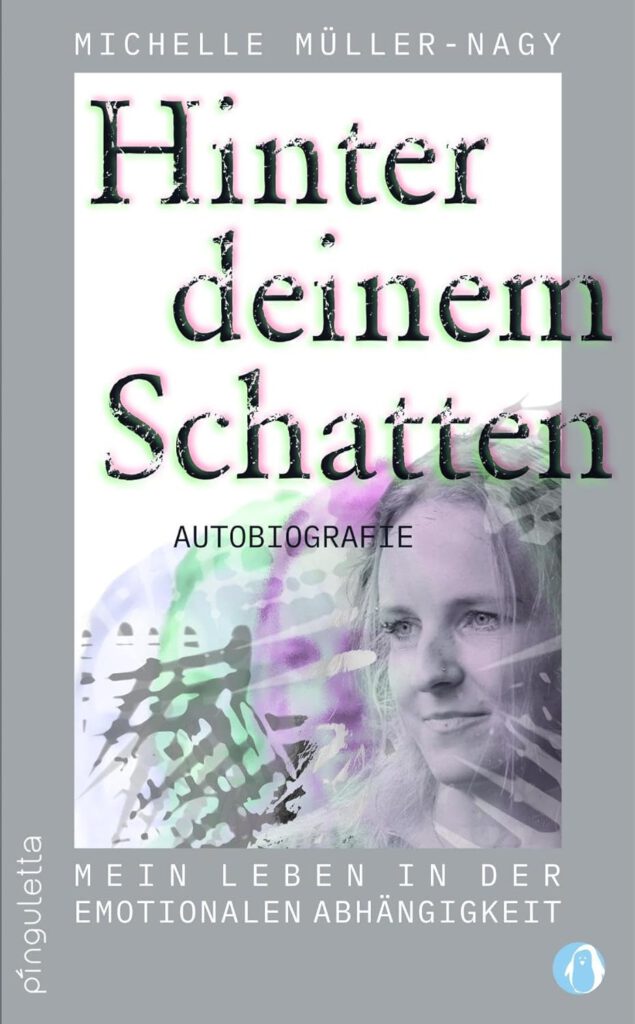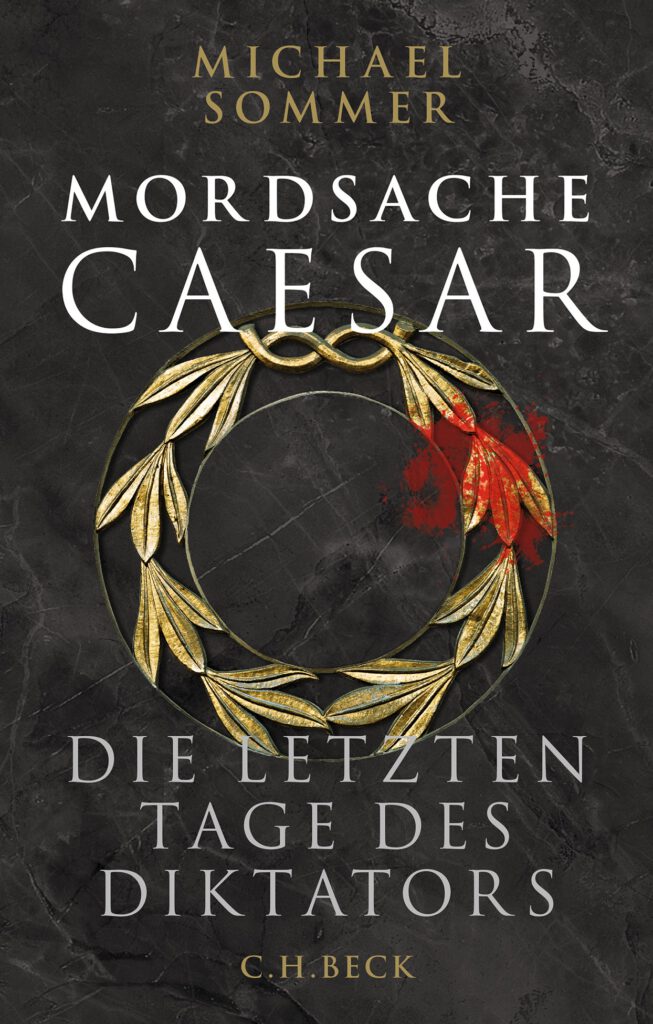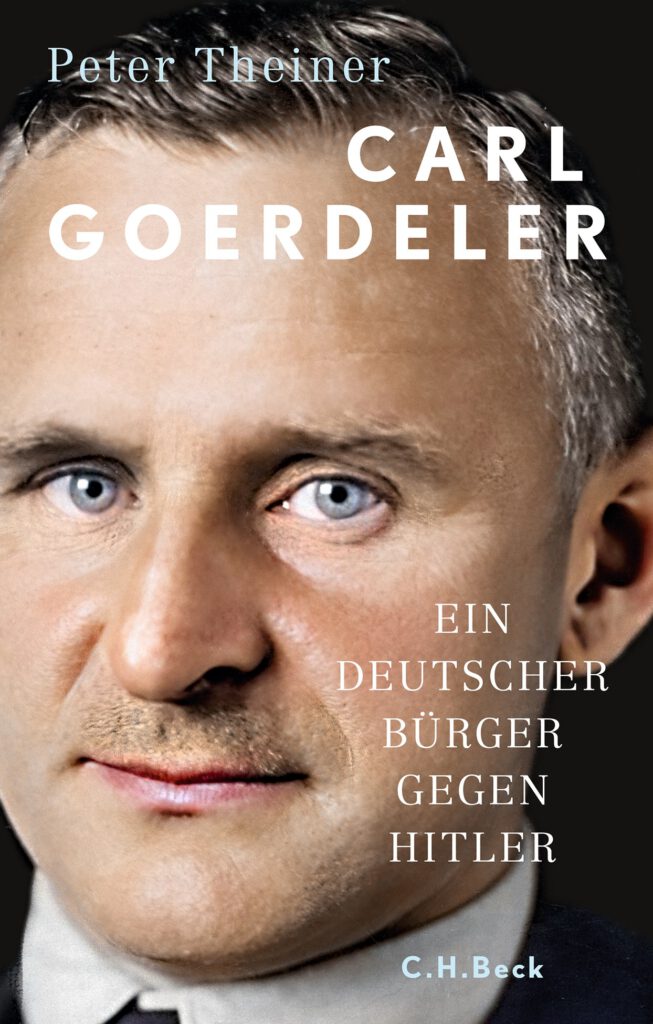Inhalt:
Carl Goerdeler (1884-1945) ist bekannt als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Die nun vorliegende Biografie zeichnet den Weg dieses mutigen Bürgers nach, der nach einer erfolgreichen Karriere in der Kommunalpolitik als entschiedener Gegner des Regimes auftrat und im Februar 1945 hingerichtet wurde. (Klappentext)
Rezension:
Nichts sprach dafür, dass der konservative Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker Carl Friedrich Goerdeler zum Widerstandskämpfer berufen war und doch geschah eben dies. Um ihn, den ehemaligen Oberbürgermeister der Messestadt Leipzig, dessen Karriere in den Verwaltungen von Solingen und Königsberg ihren Anlauf nahm, bildete sich ein Netzwerk des Widerstands, welches Menschen unterschiedlicher politischer Richtungen verband, bis er noch vor dem 20. Juli 1944 zur Fahndung ausgeschrieben, später denuziert und hingerichtet wurde.
Der Historiker Peter Theiner hat nun die Lebensgeschichte dieses Mannes aufgearbeitet, der früh die Fehler des NS-Regimes erkannt und Überlegungen zur Gestaltung eines vereinten Europas angestellt hat, welche erst viel später verwirklicht werden sollten.
Was Sophie Scholl oder Georg Elser für München und Claus Schenk Graf von Stauffenberg für Berlin bedeuten, ist für Leipzigs geschichtlicher DNA Carl Friedrich Goerdeler, dessen Leben von Posen nach Solingen und Königsberg in die schon damals posierende Messestadt führen sollte.
Überall dort reformierte er unter den Eindrücken des ersten Weltkrieges und den turbulenten Jahren der Weimarer Republik kommunale Strukturen, was ihn, zunächst parteilos, später Mitglied der DNVP Respekt über die Grenzen aller politischer Lager einbrachte und dazu führte, dass selbst kurz vor seiner Hinrichtung Himmlers Schergen ihn die Ausarbeitung letzter Grundsatzpapiere abrang, um aus seiner Expertise zu schöpfen.
Doch, wie wurde der Theoretiker zu einem der Dreh- und angelpunkte des Widerstands und weshalb scheiterte einer, der stets bemüht war, das Große und Ganze zu sehen? Diesen und damit zusammenhängenden Fragen geht der Autor in der von ihm vorgelegten umfassenden Biografie nach. Ausführliche Rechercheleistung vorangehend, zeigt Peter Theiner den Weg Goerdelers von seiner Kindheit bis hin zu seinem Ende in Plötzensee auf. Kleinteilig und detailliert schildert er Stationen und Wegpunkte, ohne dabei die Sichtweisen derer außer Acht zu lassen, mit denen Goerdeler im Laufe seines Lebens in Kontakt kam.
Anhand seiner zahlreichen Überlegungen, die er in unterschiedlichste Denkschriften hat einfließen lassen, Tagebuchaufzeichnungen und den Protokollen seiner Gegner entsteht nach und nach das Portrait eines vielschichten Mannes, dessen politischen Wandel man an einzelnen Stationen festmachen kann, wie auch der Wertekanon in turbolenten Zeiten, der trotz der Sperrigkeit Goederles selbst doch genügen sollte, um selbst dünne Fäden des Widerstands in Bewegung zu halten.
Der Text ist dabei gespickt von zahlreichen Details, nicht unbedingt leicht zu lesen, doch ist ja nichts spannender als das wahre Leben und das Goerdelers liest sich wie ein Krimi, der unweigerlich auf die Katatstrophe zusteuert. Dass Goerdeler diese Weitsicht durchaus besaß, zeigt der Autor anhand von zahlreichen Beispielen, aber auch, dass dieser bis zuletzt daran glaubte, an Stellschrauben drehen zu können, die ihm da schon längst entglitten waren.
Wie er selber ein klar denkender, rechtlich urteilender, gradlinig wollender Mensch war, der wenig oder nichts an Dunklem, Unerlöstem, Hintergründigem in sich trug, so nahm er auch von seinen Mitmenschen an, dass, so weit nicht Selbstsucht oder böser Wille im Wege stehe, auch bei ihnen es nur der verständigen Aufklärung und der wohlmeinenden sittlichen Belehrung bedürfe, um sie von etwaigen Irrtümern zurückzubringen und auf den rechten Weg zu führen. […] Wie er selbst ein durch und durch undämonischer Mensch war, so wusste er auch nicht um das Dämonische. Und das hatte eine verhängnisvolle Wirkung: in seinem politischen Kalkül fehlten diese wichtigen Posten.
Peter Theiner: Carl Goerdeler – Ein deutscher Bürger gegen Hitler
So wird in der Biografie sehr ausführlich dargestellt, welche Überlegungen von Staatsverständnis bis hin zum europäischen Denken ihn leiteten, wie sie entstanden und wie sich Deutschland in dieses Gebilde einfügen sollte. Zuweilen wirkt dies sehr theoretisch, zumal in der Konfrontation mit Goerdelers Gesprächspartnern von England über Frankreich bis nach Amerika. Niemand, den er warnte, wollte ihn glauben.
Der Autor zeichnet anschließend weiter das Dilemma eines Widerstands auf, der aufgrund mangelnder Ressourcen und unglücklicher Fügungen nicht mehr als ein Achtungszeichen in die Welt senden konnte. Das liegt, so wird hier aufgezeigt, an der zeit selbst, als auch an Ereignissen, die über die Protagonisten hinwegrollten, aber auch an Personen, die sich selbst im Weg standen.
Goerdeler bildet da keine Ausnahme und doch ist er eine der herausstechenden Personen, die zumindest versucht haben, dem Widerstand eine Form zu geben, dessen Strahlkraft bis ins Heute wirkt. Der Anhang zeigt das umfassende Recherchematerial, welches verschriftlich aufgelockert wird, mit wenigen Bildern, immer wieder durchsetzt mit zahlreichen Zitaten und Auszügen aus Texten Goerdelers und seiner Diskutanten ein wichtiges Dokument gegen das Vergessen darstellt.
Neben den zivilen und den, weniger Militärs, zeigt Peter Theiner mit seinem Werk nun einen kleinen, aber wichtigen Teil des politischen Widerstands auf, den es eben auch gab.
Nicht nur deshalb ist diese Biografie zu empfehlen.
Autor:
Peter Theiner wurde 1951 in Haan geboren und ist ein deutscher Historiker und Stiftungsmanager. Nach Schule und Wehrdienst studierte er Geschichte, Romanistik, Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften in Düsseldorf und Dijon, mit Station in Paris, wonach eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent und seine Promotion folgten.
Danach war er in der Weiterbildung und Personalentwicklung tätig, sowie Leiter des Bereichs Völkerverständigung der Robert Bosch Stiftung. An der Universität Stuttgart war er Lehrbauftragter am Historischen Institut. Theiner verfasste mehrere Schriften, u. a. eine vielbeachtete Biografie über Robert Bosch.
Der virtuelle Spendenhut
Dir hat der Beitrag gefallen? Dann freue ich mich über eine virtuelle Spende. Vielen lieben Dank.
Folge mir auf folgenden Plattformen: