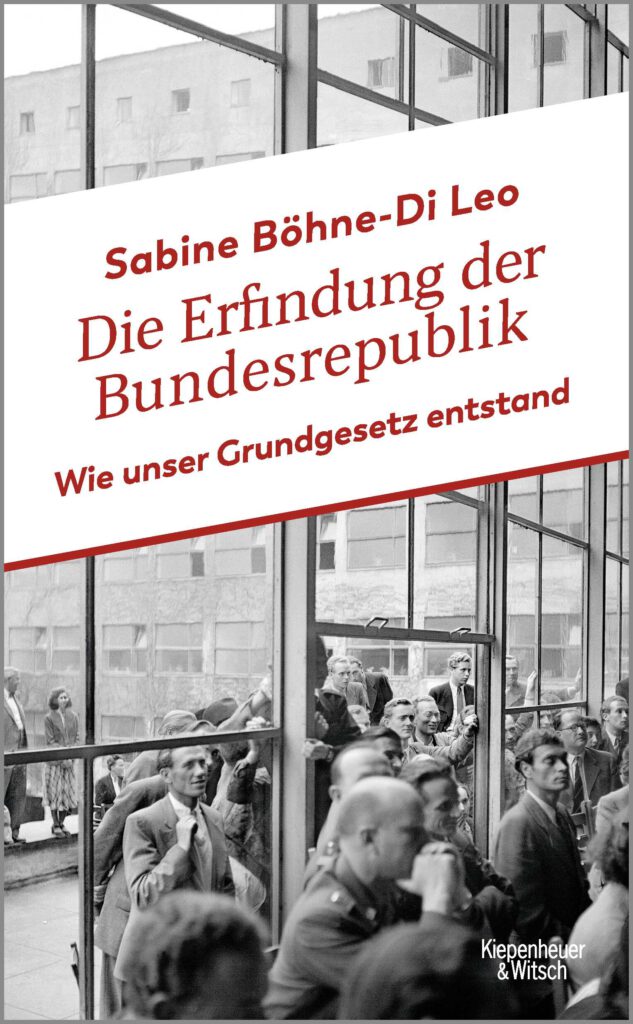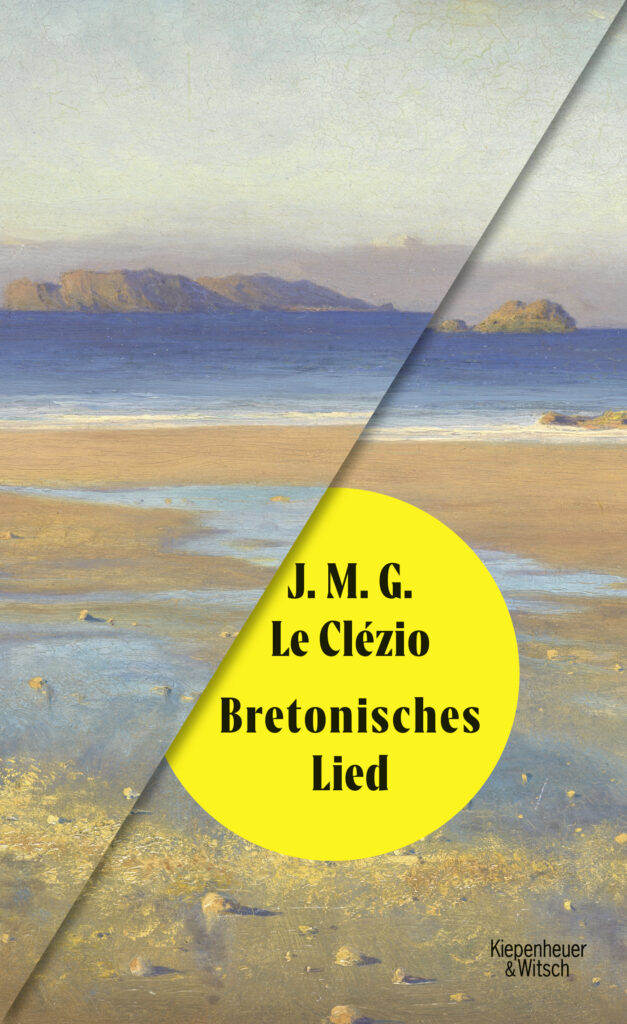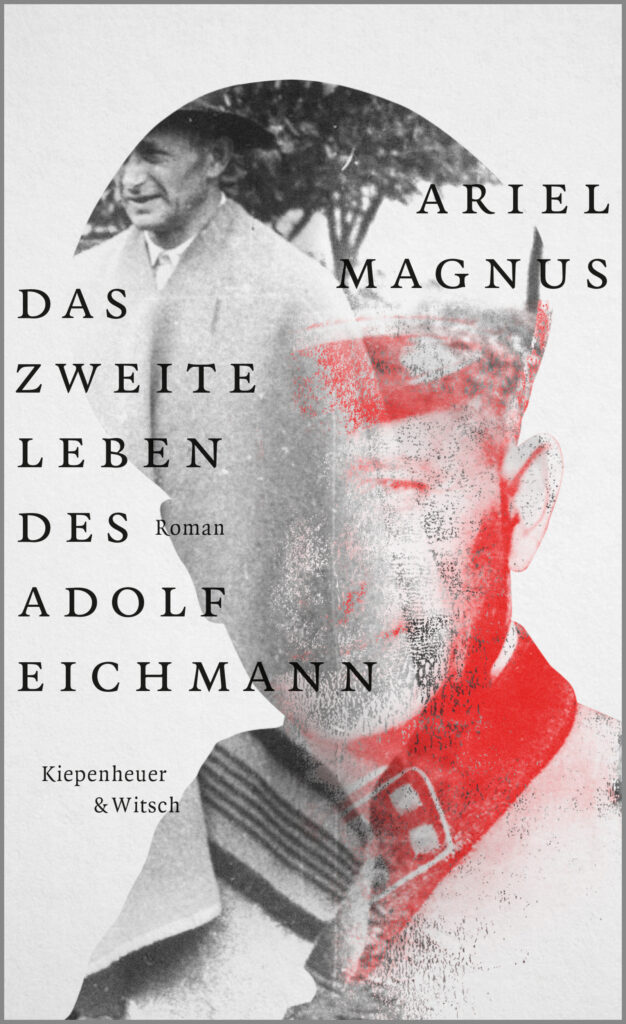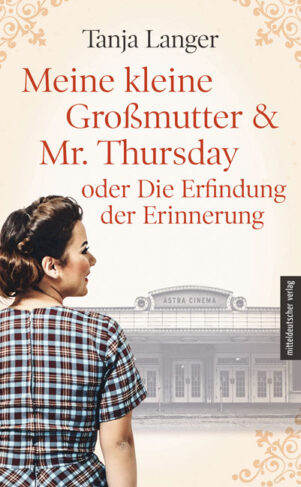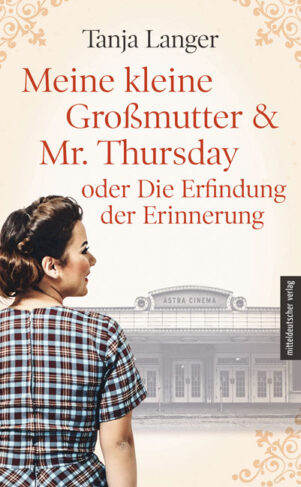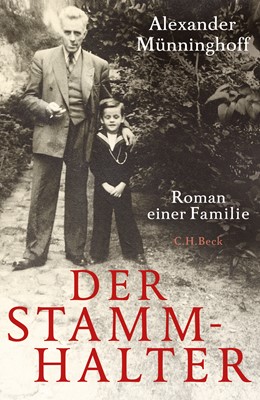Elsa Morante: La Storia
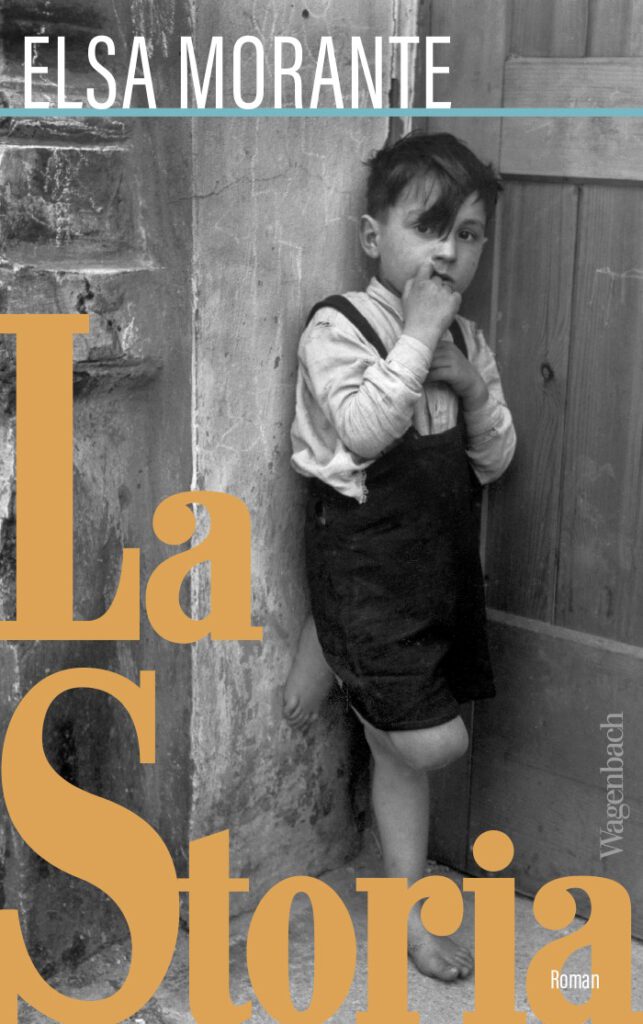
Inhalt:
La Storia ist die große Geschichte von Diktaturen, Weltkriegen und Menschheitsverbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber vor allem die Geschichte der verwitweten Lehrerin Ida und ihren zwei sehr unterschiedlichen Söhnen, vom Leben im faschistischen Rom, Trotz, Not und Hunger, rivalisierenden Partisanen. Manchmal in Gesellschaft, manchmal allein. (eigene Inhaltsangabe)
Rezension:
Die ewige Stadt im Ständigen Wandel, heruntergebrochen auf nur ein paar Geschichten, zu einer großen Erzählung miteinander verwoben, dies ist Elsa Morantes „La Storia“, welches bereits 1974 erschien und mit dieser Ausgabe in einer beeindruckenden Neuübersetzung vorliegt.
In dieser bewegen wir uns durch die Armenviertel Roms, aus derer die behutsam ausgestaltete Protagonistin Ida nie ausbrechen wird können, und den Weg ihrer beider Söhne, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Trotzdem oder gerade deswegen gelingt der Kampf eine lange Zeit, auch wenn alle Figuren immer wieder an gewisse Glasdecken gesellschaftlicher Schichten stoßen und nicht zu durchdringen vermögen. Ein Aufstieg ist kaum gegeben. Ida, Nino und Useppe und all die anderen, denen wir im Laufe der Erzählung begegnen, schlagen sich durch das Leben, welches sie immer wieder umstoßen wird, kaum dass sie Kräfte fassen, in einer Zeit, welche es wahrlich nicht gut mit den Menschen meint.
Dabei werden sehr umfangreich unterschiedlichste Themen aufgemacht, die in verschiedensten Handlungssträngen nicht immer mit aller Konsequenz bis zum Ende hin verfolgt werden. So ist La Storia zugleich ein Roman über eine Familie, Gesellschafts- und Systemkritik, eine Bestandsaufnahme, in der jede der Figuren, von denen einige wunderschön ausgestaltet sind, eine eigene Erzählung vedient hätte. Mit der gewählten Form hier jedoch hat sich die Autorin nur bedingt einen Gefallen getan.
Einzelne Ausarbeitungen von Figuren dürfen als gelungen bezeichnet werden, allen voran die der Hauptfigüre, die man ins Herz schließen mag. Bei Vernachlässigung anderer Handlungsstränge gäbe es hier alleine genug zu erzählen, ob nun der Konflikt zwischen den Generationen beleuchtet oder vererbte unverarbeitete Traumata, deren Auswirkungen sich erst sehr viel später zeigen werden. Aber La Storia ist eben auch Partisanengeschichte oder eben die Verhandlung einer gesellschaftlichen Systemfrage. Schwer zu bündeln und damit über manche Strecken ganz und gar nicht einfach zu lesen.
Erzählt wird dieses italienische Epos per Perspektivwechsel, dem man durchaus folgen kann. Selbst der tierische Begleiter Useppes, einer Figur, die man einfach nur liebhaben muss, bekommt da eine Stimme und der kleine Junge damit eine Form, was aber nicht darüber hinweg hilft, dass alleine durch die Länge es beim Lesen dazu kommt, dass man einzelnen Figuren gerne nachspürt, sich bei anderen Passagen über kurz oder lang erwischen tut, sie nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit verfolgen zu wollen. Da kommen sich Handlungsstränge in die Quere. Auch muss man sich des im Vergleich zu heutigen Zeit etwas gemächlicheren Erzähltempos bewusst sein, was dann ebenfalls zu ein paar Längen beiträgt.
Elsa Morante widmet sich kleinteilig der Kriegs- und Nachkriegszeit in den staubigen Gassen Roms und zeigt dabei Licht- und Schattenseiten. Jede Figur hat ihre Ecken und Kanten, auch deren Standpunkte werden immer wieder neu verhandelt, trotzdem schleicht sich immer wieder das Gefühl ein, hier von hätten es gerne ein paar Seiten weniger, hier unbedingt mehr sein können, da es Morante ja durchaus gelungen ist, für Detailschärfe zu sorgen.
Vielleicht ist das aber auch nur ein Empfinden in heutiger Zeit. Zum Erscheinen war La Storia in Italien ein großer Publikumserfolg, der vielerseits diskutiert wurde. Eines ist jedoch gelungen, eine Art Lebensgefühl zu transportieren, auch nicht immer nur auf eine Seite hin fokussiert.
An manchen Stellen übertrieben wirkende Reduzierungen, an anderen eine ewisse Üppigkeit, und ja, auch hin und wieder ruppiger Sprache, hinterlassen einen wechselhaften Eindruck, was streckenweise enervierend sein kann, vor allem auf einem bestimmten Monolog gegen Ende bezogen, ansonsten folgen hier Aktion und Reaktion der Figuren einer gewissen Logik. Die Beschreibungen der Schauplätze ist der Autorin gelungen. Man kann sich die Gassen des Armenviertels, das Flussufer, die Enge von Räumen gut vorstellen.
Der Konzentration fordernde Roman lässt sich in keinem Fall nebenher lesen und ist zumindest im Haupthandlungsstrang durchaus lesenswert. Wer dann noch die anderen mit etwa dem gleichen Interesse begegnet, entdeckt eine Geschichte über viele Geschichten.
Auch das ist ja irgendwie Rom.
Autorin:
Elsa Morante wurde 1912 in Rom geboren und war eine italienische Schriftstellerin. Nach der Schule begann sie ein Literaturstudium, welches sie aus Geldmangel vorzeitig beenden musste. Dennoch veröffentlichte sie Gedichte und Erzählungen, zunächst in Zeitschriften, gab nebenher Unterricht in Italienisch und Latein.
In ihrem Roman La Storia verarbeitete sie Erlebnisse aus ihrer eigenen Biografie, musste vorher zu Zeiten des Krieges aus Italien 1943 fliehen, kehrte aber 1944 bereits wieder nach Rom zurück. 1948 wurde ihr erster Roman veröffentlicht, dem weitere folgten. La Storia, 1974, welches in den 1980er Jahren verfimt wurde. 2023 entstand eine TV-Serie. Morante erhielt u. a. den Prix Medicis, 1984. Ein Jahr später starb die Autorin.
Elsa Morante: La Storia Weiterlesen »