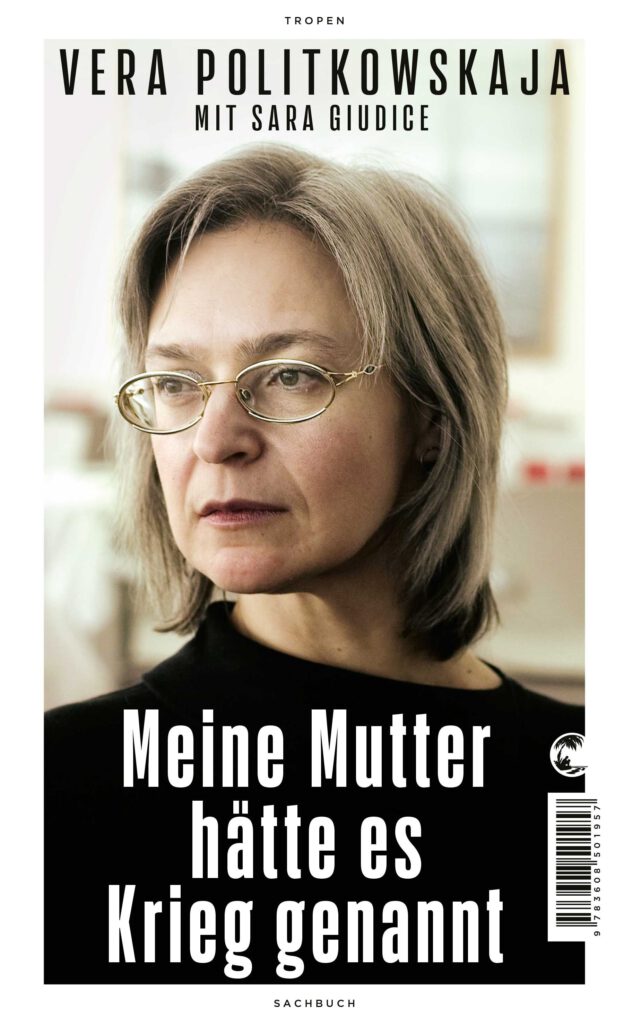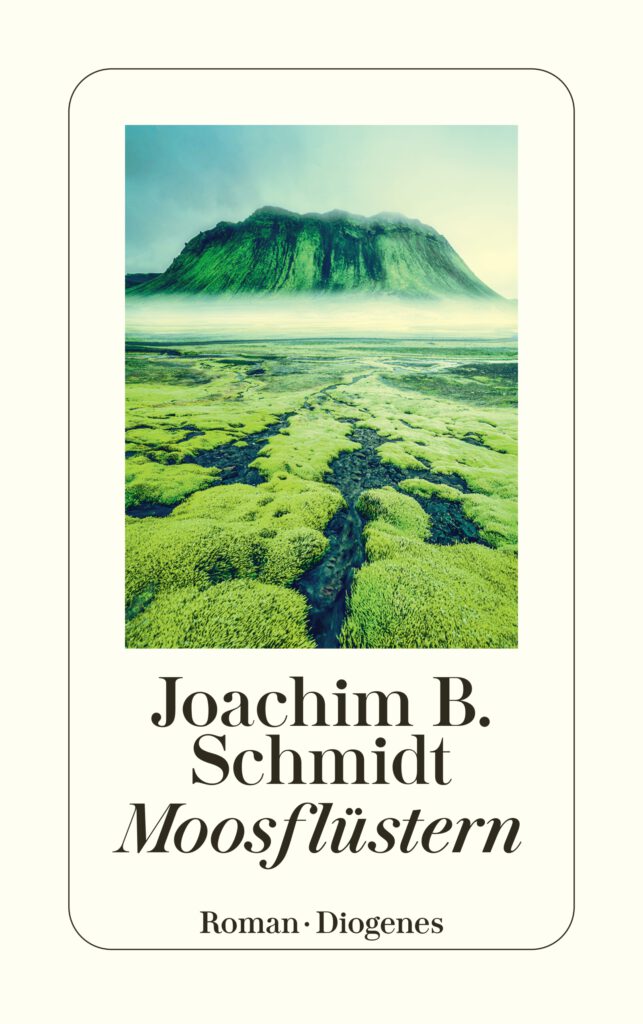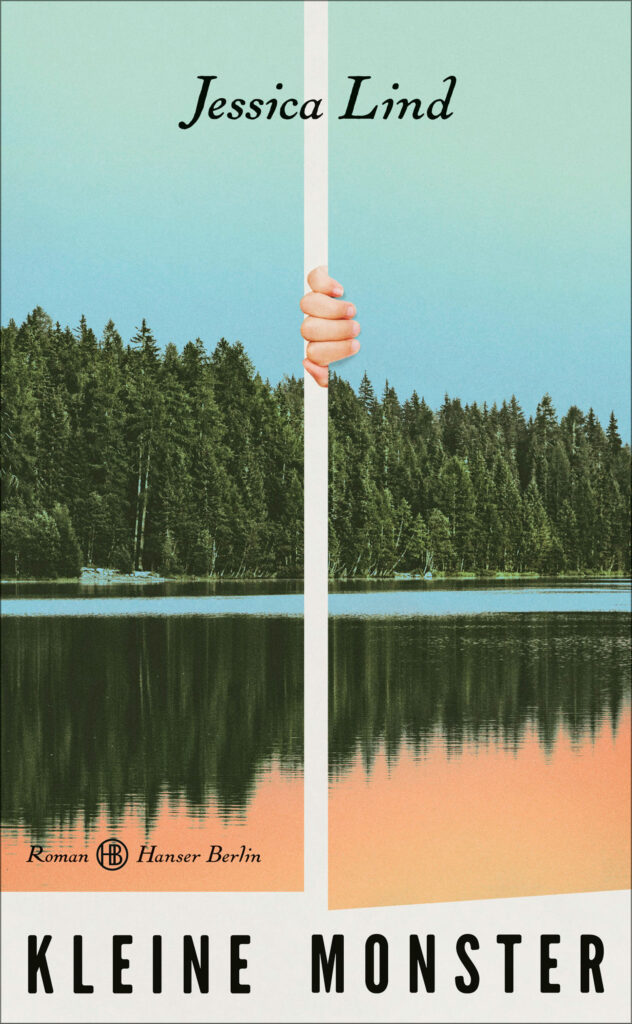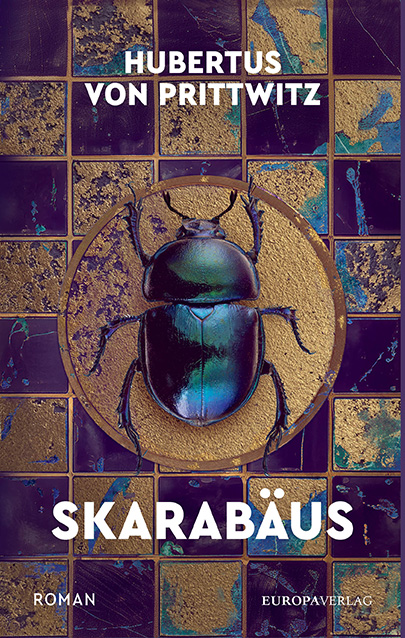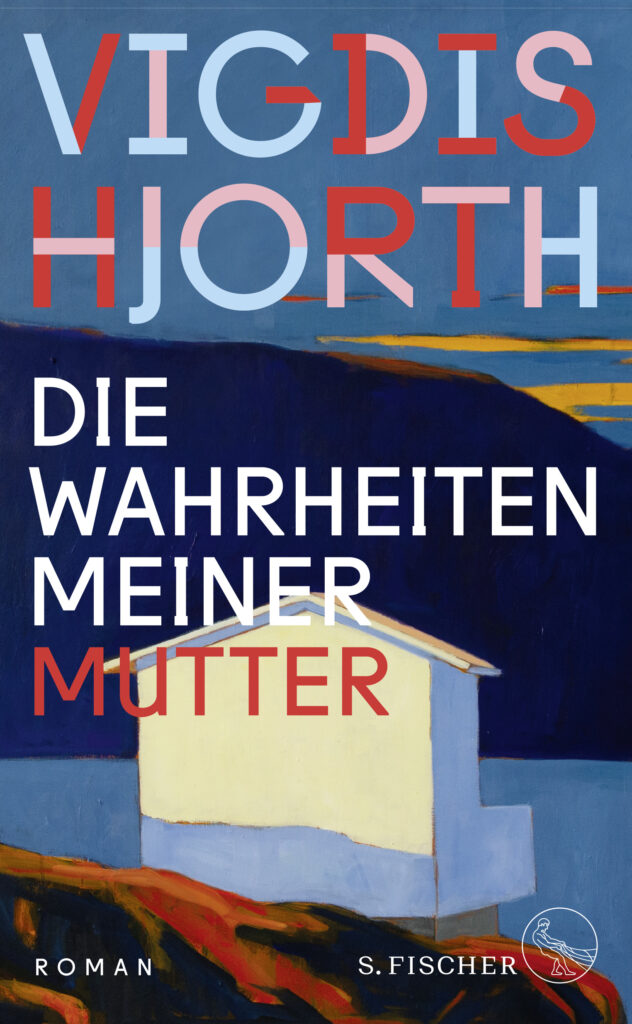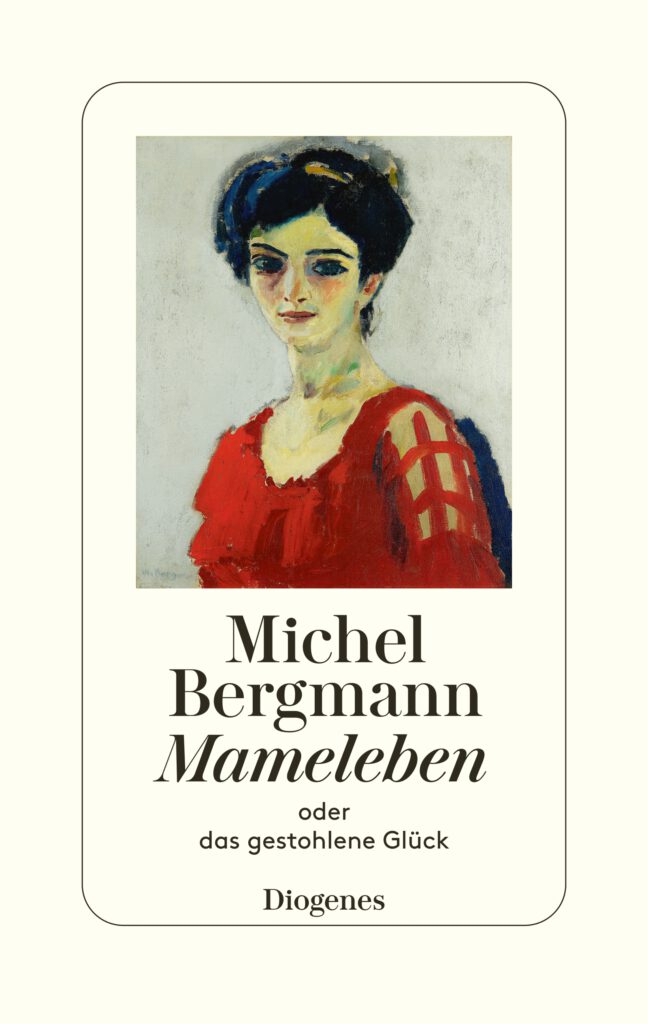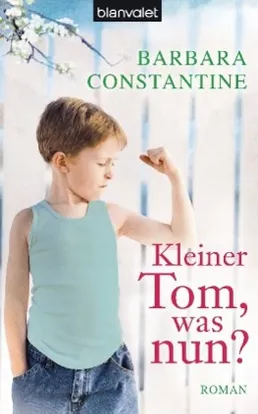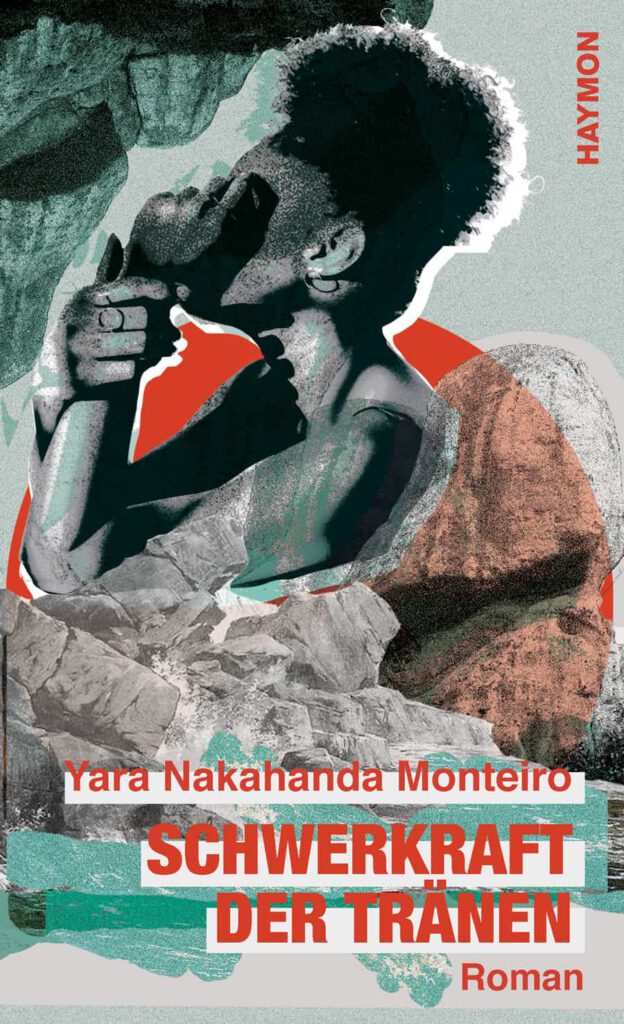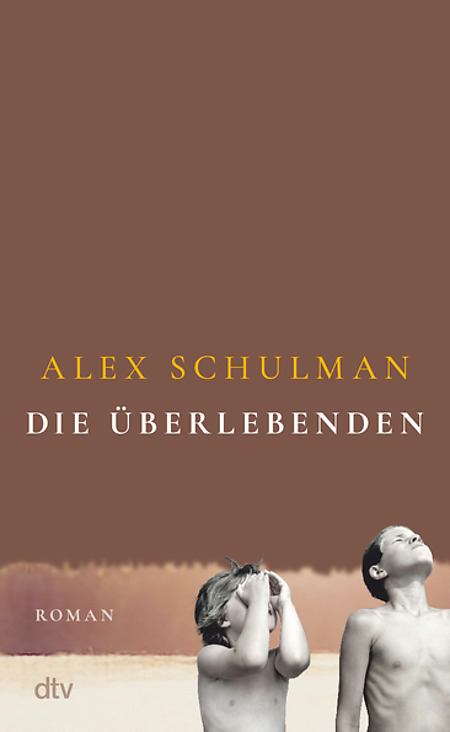Mattia Insolia: Brennende Himmel
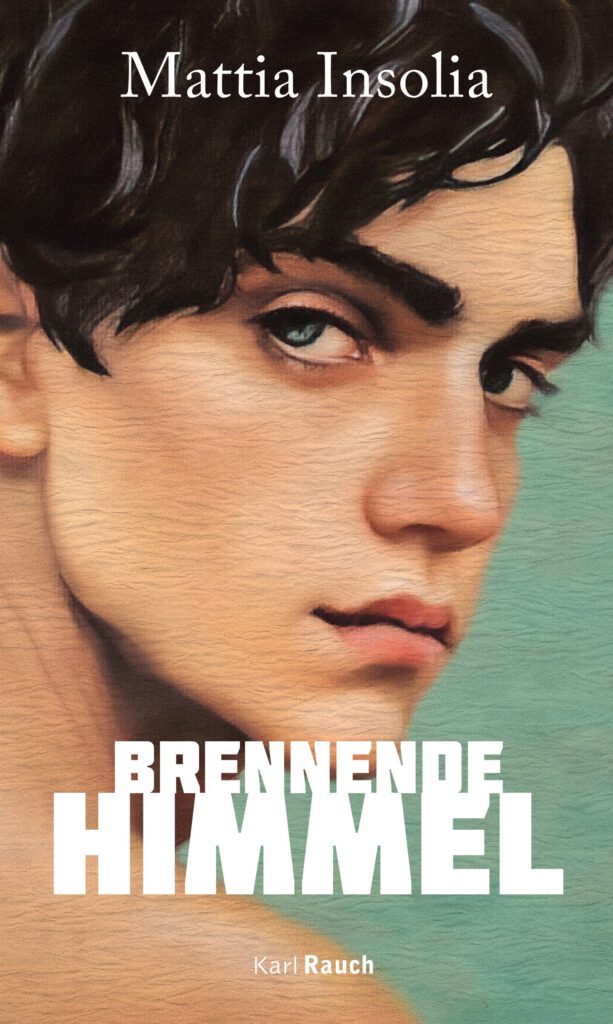
Inhalt:
Sommer 2000 – Teresa macht mit ihren Eltern Ferien in Camporotondo. Sie hat Träume, ist neugierig und gleichzeitig verunsichert von der Welt um sie herum. Während des Urlaubs in Sizilien lernt sie den schönen und verwegenen Riccardo kennen. Eine verhängnisvolle Begegnung.
Winter 2019 – Niccolo ist Teenager, er trinkt und kokst, gibt sich unnahbar und handelt rücksichtslos. Als sein Vater Riccardo ihn zu einem gemeinsamen Roadtrip überredet, wird Niccolo mit der Vergangenheit seiner Eltern konfrontiert.
Mattia Insolia erzählt von Jugendlichen, die alles daran setzen, nicht den vorgegebenen Lebenswegen zu folgen. Und er beschreibt, wie sich Eltern schuldig machen – durchaus mit Empathie, aber sie niemals aus ihrer Schuld entlassend. (Klappentext)
Rezension:
Wild und roh ist die Erzählung eines Roadtrips, der in die Vergangenheit führt, kantig und beinahe unangenehm, wie Sonne auf der Haut. In seinem Roman „Brennende Himmel“ bündelt der italienische Autor Mattia Insolia diese Strahlen zweier Erzählstränge und zeigt Protagonisten, die ihrem Erbe entfliehen wollen, aber erkennen müssen, dass das Unterfangen aussichtlos ist.
Der kompakt gehaltene Roman liest sich schwergängig. Wechselnd zwischen den Zeitebenen erzählt er parallel die Geschichte von Jugendlichen, die aufs Verhängnisvolle miteinander verbunden sein werden und keine Gelegenheit auslassen, einander wehzutun. Weil sie nichts anderes können. Die Handlung spielt zwei Sommer lang, zwanzig Jahre voneiander entfernt. In diesen erleben die Protagonisten alles. In Zeiten, die entlos scheinen und Weichen stellen.
Dabei geben sich die Figuren fast die gesamte Handlung über unnahbar, kalt. Keine der Figuren hat, vor allem im Zusammenspiel der Perspektiven, wenn sich die Zeitebenen miteinander verbinden, wirkliche Sympathien auf ihre Seite. Es ist, als wollte Mattia Insolia zeigen, dass sich gerade die unangenehmen Eigenschaften über Generationen weiter vererben. Zeichen, die man nicht los wird, und die, lernt man damit nicht umzugehen, alles Schlimme zum Vorschein bringen.
Der Fokus der Erzählung liegt auf drei Protagonisten. Teresa, von der psychischen und zu weilen körperlichen Gewalt ihrer Mutter bestimmt, die versucht aus dem engen Korsett ihres Elternhauses auszubrechen, jedoch nicht weiß, wie und damit so tollpatschig und einfältig wirkt, dass dies unerträglich ist zu lesen, deren Leid und Frust sie später auf ihren Sohn übertragen wird.
Riccardo, der die schlimmsten Eigenschaften männlichen Gehabes auf sich zu vereinen scheint und Niccolo, dessen Egal-Mentalität sich ebenso widerlich anfühlt, aber aus der Geschichte heraus zumindest erklärlich scheint. Andere Figuren kommen allerhöchstens mal im Nebensatz, in ganz wenigen Momenten als Projektionsfläche von Wut vor, die sich kanalisieren muss, bleiben dabei blass. Sie sind ja auch sonst für die Handlung unbedeutend.
Die Figuren handeln nachvollziehbar, jedoch keineswegs so, dass man mit ihnen mitfühlen könnte. Kälte, Unnahbarkeit sind noch die klarsten Eigenschaften, die man dieser dysfunktionalen Familie zuschreiben könnte, ansonsten ließt man den Roman ständig mit geballter Faust, die man sich gegen die Stirn schlagen möchte. Wenigstens der Perspektivwechsel bringt dabei Abwechslung, so dass sich die Wut und das Unverständnis wenigstens immer wieder verlagern können. Ein nicht zu unterschätzender Handlungstreiber für diese Erzählung. Ein Roman über eine Familie im Scherbenhaufen, den zusammensetzen niemanden mehr möglich ist.
Mattia Insolia hat es dennoch geschaft, ohne Lücken oder unerklärliche Wendungen zu erzählen. Tatsächlich handeln die Figuren im Sonne der Geschichte und ihrer Charaktere logisch, wenn auch die große Überraschung ausbleibt. Je nach Stimmung könnte man dabei das Ende als folgerichtig oder kitschig empfinden. Am stärksten wirken die Beschreibungen innerer Gefühlswelten, die sich durch den gesamten Text ziehen, auch die Schilderung des italienischen Ferienortes lassen sicherlich beim Lesen die eine oder andere Erinnerung aufkommen. Das wird alles fast filmisch beschrieben, jedoch reicht die Qualität nur für eine Vorabendserie mit ganz viel Drama.
Positive Momente gibt es in dieser Erzählung kaum. Wenn vorhanden, werden sie in der nächsten Zeile wieder negiert. Der Autor hat hier keinen Feel-Good-Roman geschrieben. Wer diesen sucht, ist mit „Brennende Himmel“ schlecht bedient. Ausweg- und Perspektivlosigkeit ziehen sich dagegen durch den gesamten Text. Darauf muss man sich einlassen können, um die Handlung, die sich in zwei Erzählsträngen gegenseitig ergänzt, zu ertragen.
Wer das nicht kann oder im falschen Moment tut, gerät mit dem Roman auf die falsche Spur.
Autor:
Mattia Insolia wurde 1995 in Catania geboren und ist ein italienischer Schriftseller. Er studierte Literatur und Verlagswesen in Rom und schreibt für verschiedene Magazine und Zeitschriften Literatur- und Filmkritiken. „Brennende Himmel“ ist sein zweiter Roman.
Folge mir auf folgenden Plattformen:
Mattia Insolia: Brennende Himmel Weiterlesen »