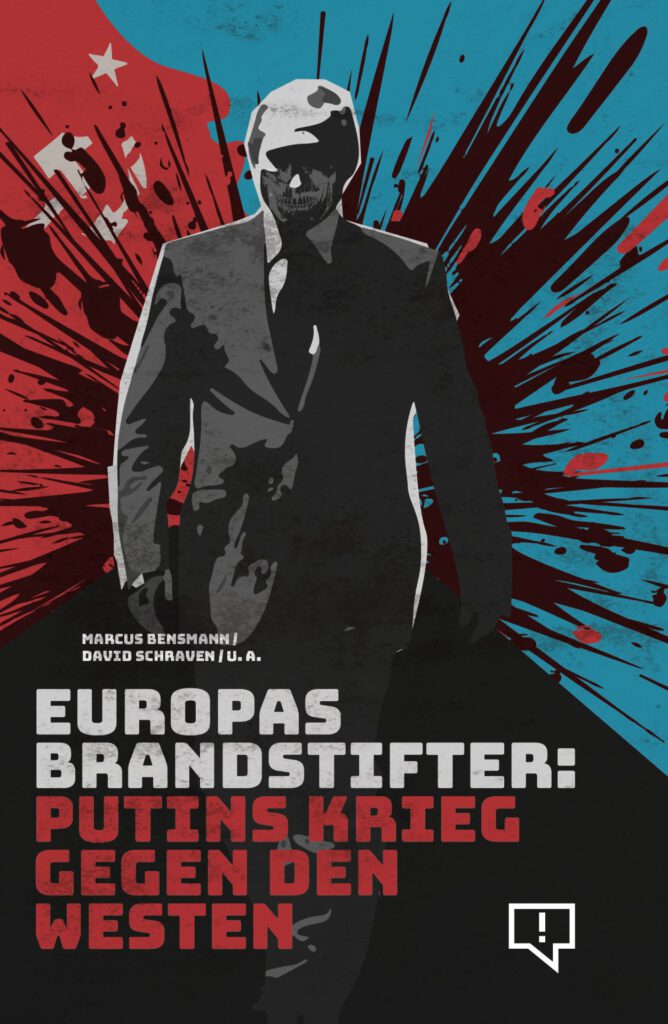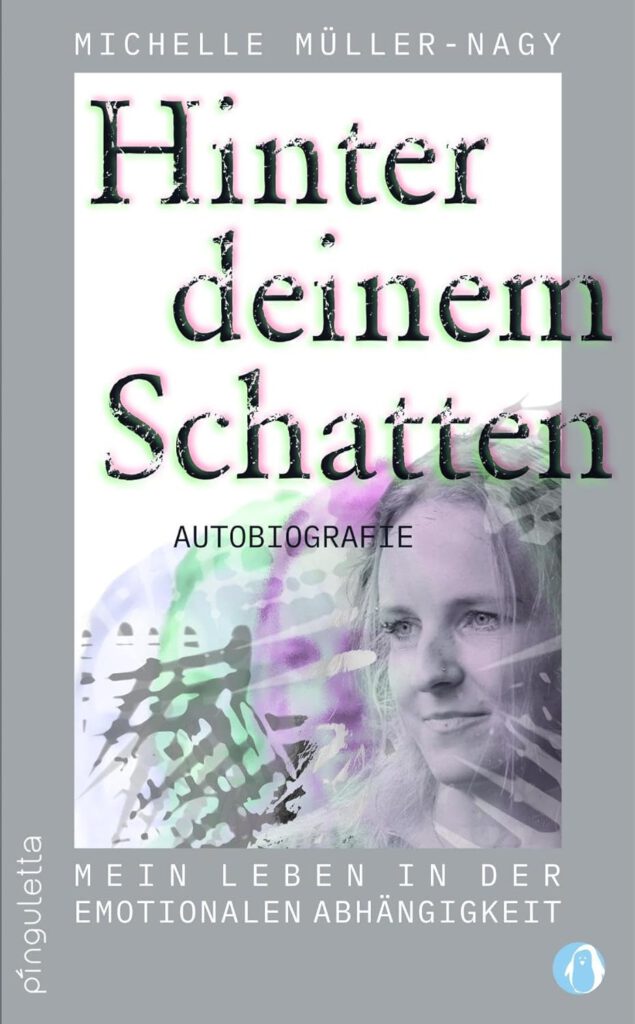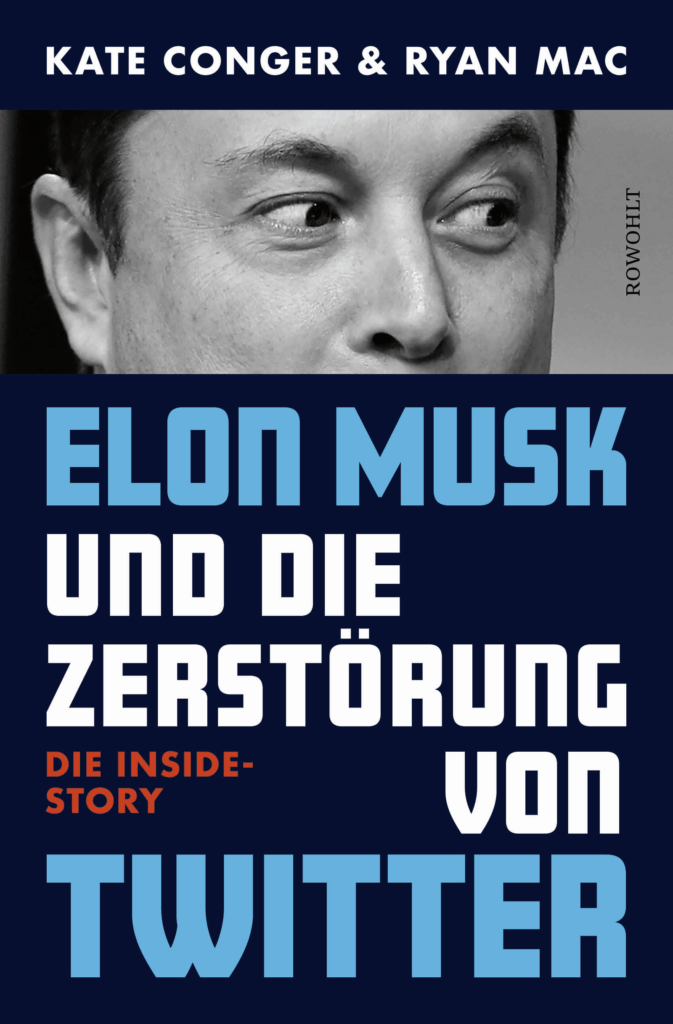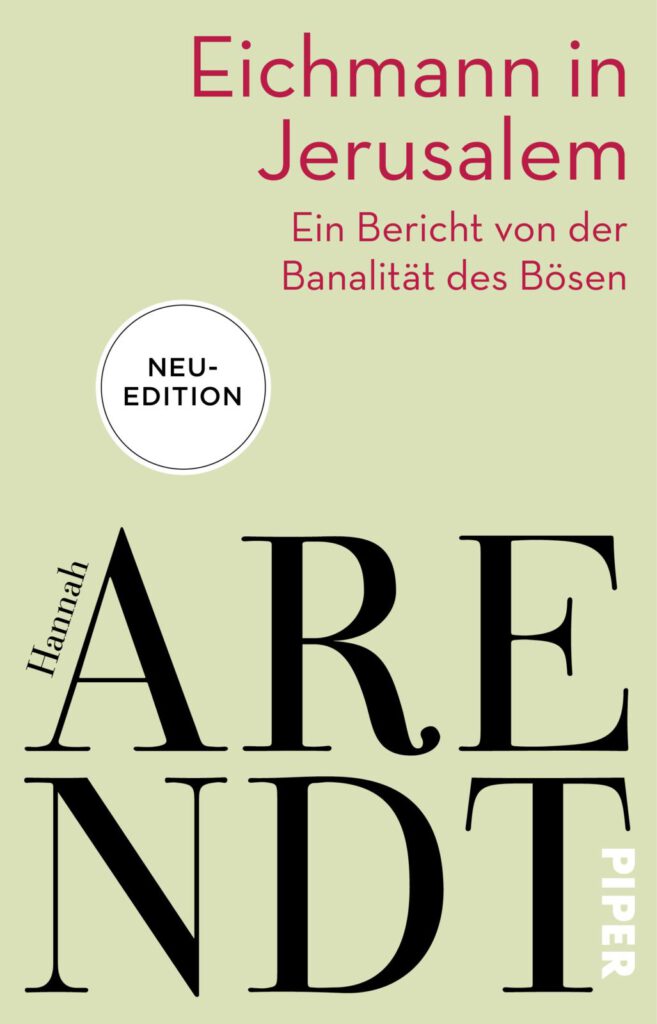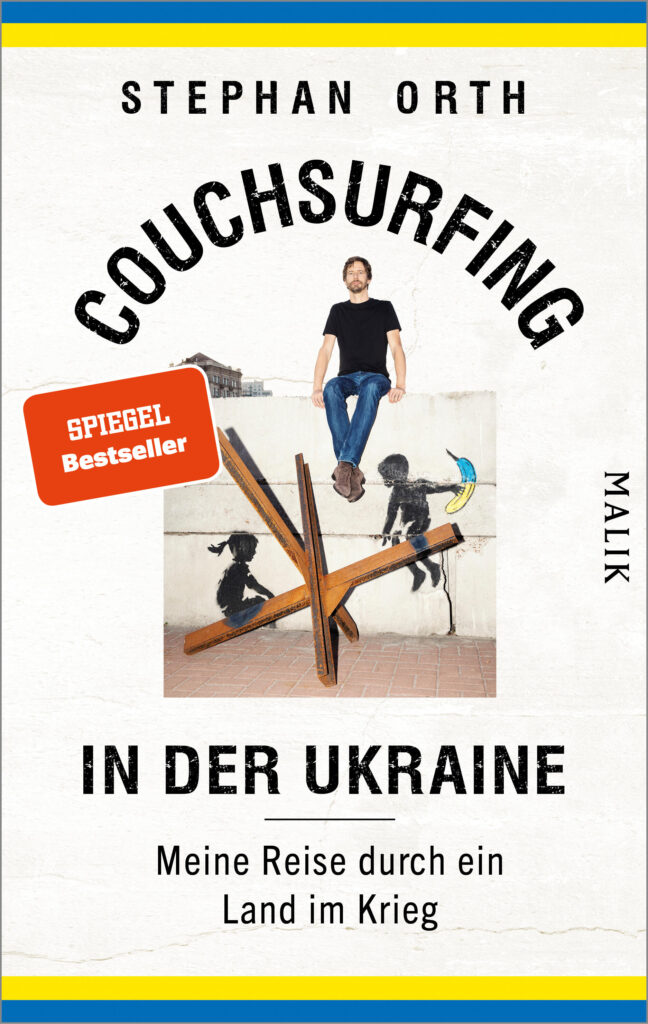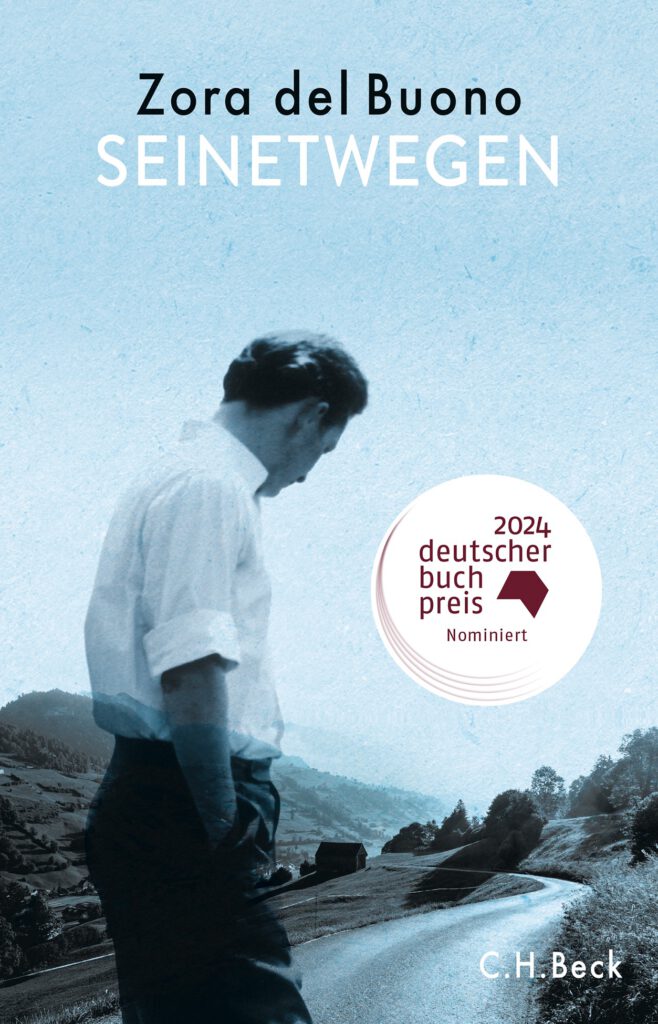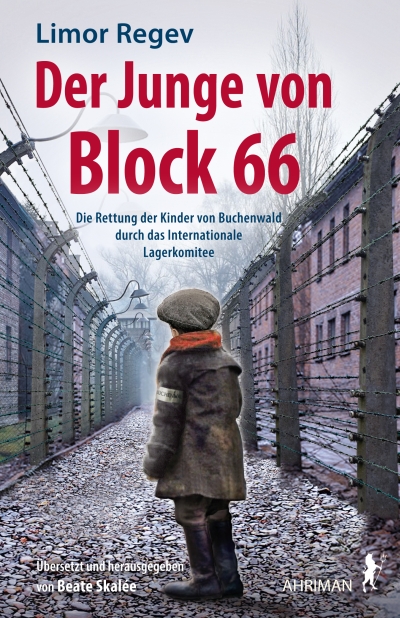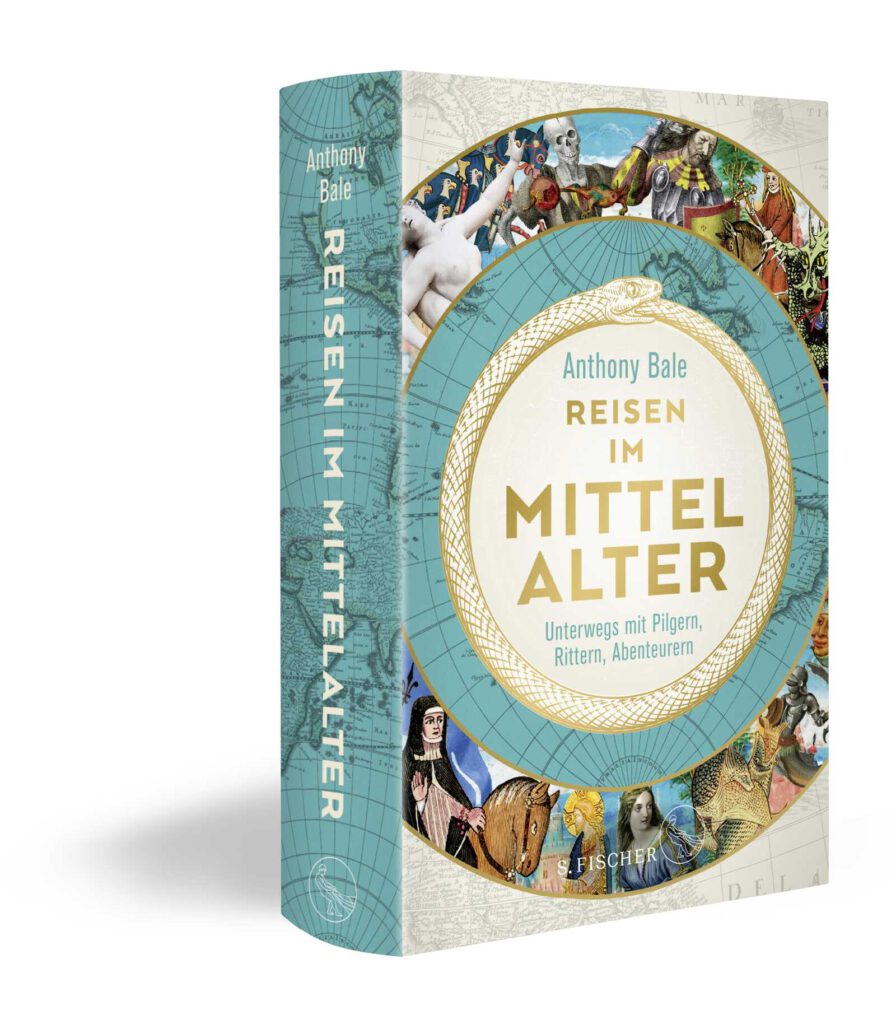Peter Schaar: Schöne neue Stadt
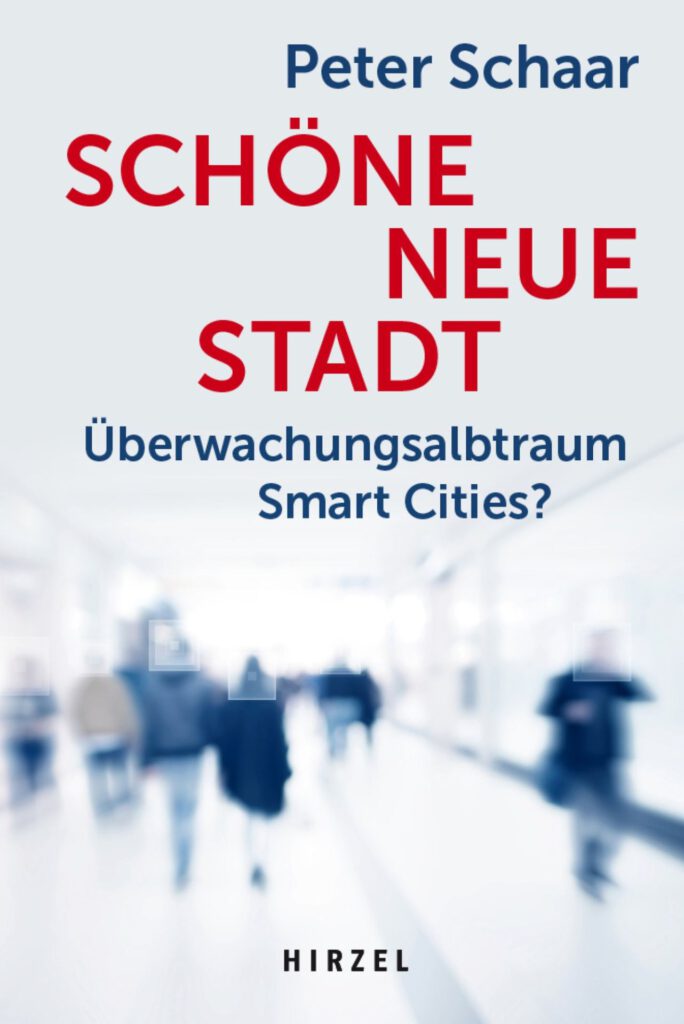
Inhalt:
Der Traum von der idealen Stadt ist so alt wie die Stadt selbst. Die jüngste Ausprägung dieser Utopie ist die Smart City – die intelligente Stadt, vollgepackt mit modernster Technik und umfassend digitalisiert. Doch machen Flugtaxis und Hyperloops, allgegenwärtige Sensorik, Zugangskontrollsysteme und eine datengestützte Steuerung die Stadt der Zukunft wirklich zu einem lebenswerten Ort? Sind sie die Antwort auf die gewaltigen Herausforderungen, vor denen die rasant wachsenden Metropolen heute stehen? Oder mutiert das vermeintliche Verwaltungsparadies am Ende nicht vielmehr zu einem digitalen Moloch?
Diesen Fragen geht Peter Schaar in seinem packenden Buch auf den Grund. Der langjährige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beleuchtet kenntnisreich aktuelle Fehlentwicklungen, zeigt aber auch, wie sich verhindern lässt, dass die smarte Stadt zu einem Überwachungsalbtraum wird. (Klappentext)
Rezension:
Hitzeinseln, das Müllproblem oder die Steuerung des Verkehrsflusses, Teilhabe an Entscheidungen auf kommunaler Ebene. Anwendungsbereiche für Smart Technology gibt es genug, zumal zukünftig, wenn noch mehr Menschen als ohnehin schon in Metropolen und anderen Ballungsräzumen leben werden. Doch, was bedeutet das? Welche Vor- und Nachteile entstehen da durch und womit werden die Entscheidungsträger, nicht zuletzt wir, die dort leben, immer häufiger konfrontiert werden?
Der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar hat dies für das vorliegende Sachbuch einmal verständlich aufbereitet und zeigt an existierenden Beispielen, vor welchen Herausforderungen und Problemen wir inmitten der Smart Cities konfrontiert werden, was es zu beachten gilt und wo unsere Chancen liegen können.
Aber, was ist eigentlich eine Smart City? Wie ist sie aufgebaut und welchen Stand haben Digitalisierung und digitale Transformation iin der Welt und in Deutschland? Welche Ansätze funktionieren schon und wie eigentlich, misst man die Intelligenz einer Stadt überhaupt? Mit dieser Einführung beginnt Peter Schaar seine Darlegung einer hoch komplexen Thematik, die hier jedoch so aufbereitet ist, dass sie für Laien über die gesamte Strecke verständlich bleibt. Kurze Unterkapitel lassen dabei keinerlei langatmige, allzu fachorientierte Ausführungen zu. Jeder abschnitt wird zudem gegen Ende noch einmal zusammengefasst.
So gelingt es, sich ohne Schwierigkeiten einen zwar kritischen Überblick über einen spannenden Bereich städtischer Entwicklung zu gelangen, aber auch welche Faktoren wie betrachtet werden müssen, um aller Facetten gewahr zu werden. An Beispielen rund um den Globus, von Kanada bis China zeigt er Fehlentscheidungen und Problemstellungen auf, erläutert, welche Projekte in Deutschland angestoßen wurden und wo in Europa eine Stadt zeigt, wie Transformation und Datenschutz gelungen im Einklang gebracht werden kann. Es ist dabei keine Buch, in welchem einseitig auf Smart Citys geschaut, sondern vielmehr allen Schattierungen Rechnung getragen wird. Diese Ausgewogenheit, so erfährt man hier, ist auch notwendig, so man sich mit der Materie beschäftigt.
Peter Schaar bietet Überblickswissen und lädt dazu ein, mit offenen Augen durch die eigene Stadt zu gehen, aber auch eigene Recherche zu betreiben. Fachkenntnis trifft hier auf eine umfassende Quellenlage, die gegen Ende des erhellenden Sachbuchs die einzelnen aufgeführten Punkte untermauert. Wer sich unvoreingenommen eine Meinung bilden und alle Seiten betrachtebn möchte, ist mit der Lektüre gut bedient.
Autor:
Peter Schaar wurde 1954 in Berlin geboren und ist ein deutscher Datenschutzexperte. Er studierte zunächst Volkswirtschaft in Berlin, Frankfurt/Main und Hamburg, bevor er in verschiedenen Funktionien in der Verwaltung Hamburgs tätig war. 1986 wurde er zunächst Referatsleiter, dann stellvertretender Datenschutzbeauftragter der Hansestadt. 2002 wechselte Schaar vorrübergehend in die Privatwirtschaft, bevor er 2003 das Amt des Bundesbeauftragten für Datenschutz ausübte, bis 2013.
Er war Mitglied der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU-Mitgliedstaaten, sowie in der Internationalen Datenschutzkonferenz tätig. Seit 2007 ist er zudem Lehrbeauftragter der Universität Hamburg, sowie seit 2016 in der Schlichtungsstelle der Telematikanwendungen der Gesundheitskarte tätig. Er engagiert sich in der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz und Autor mehrere Bücher. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.
Folgt mir auf folgenden Plattformen:
Peter Schaar: Schöne neue Stadt Weiterlesen »