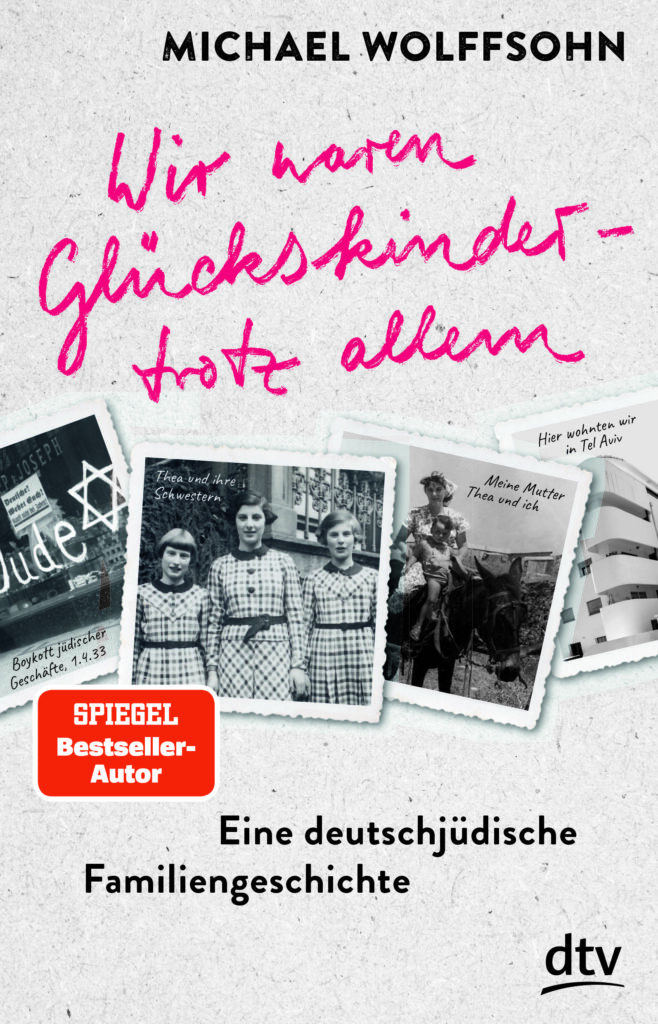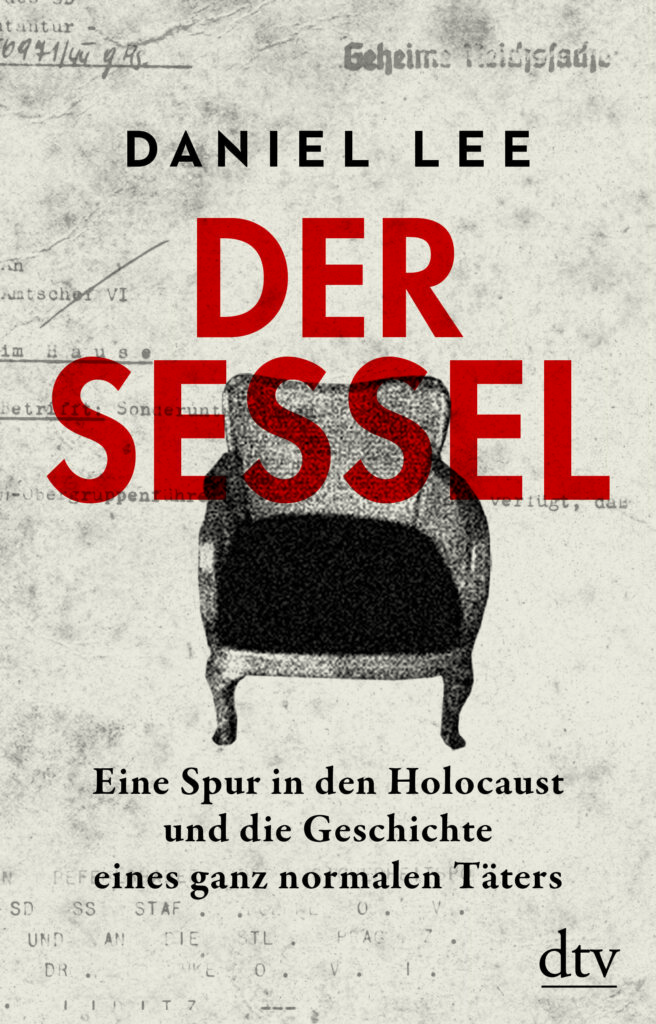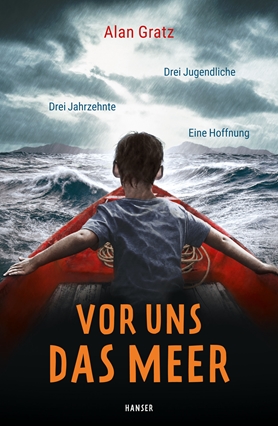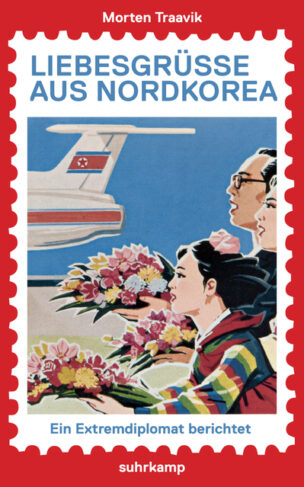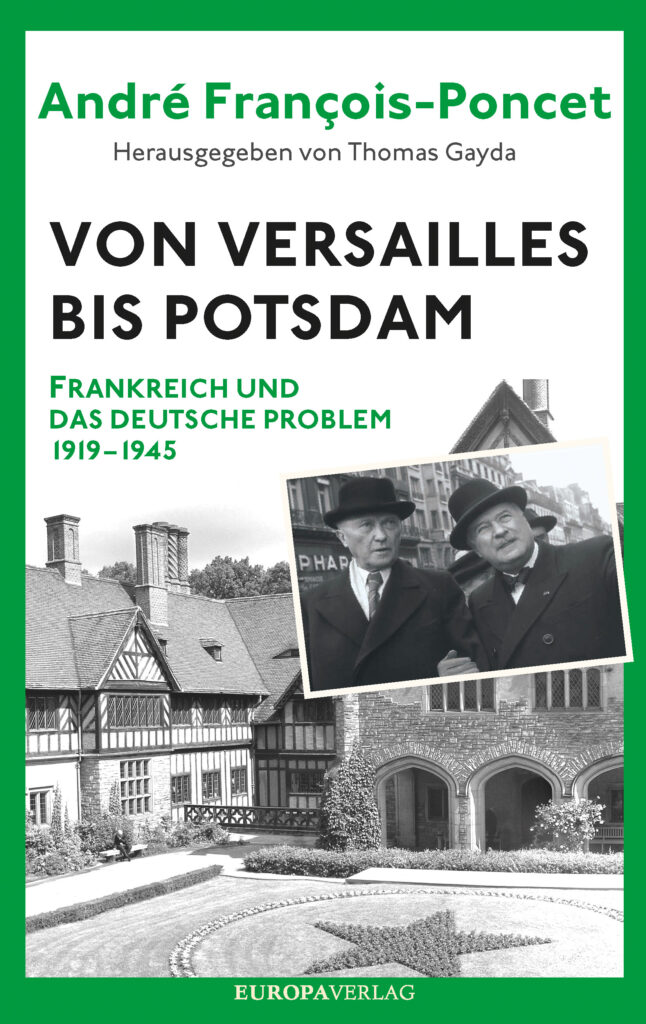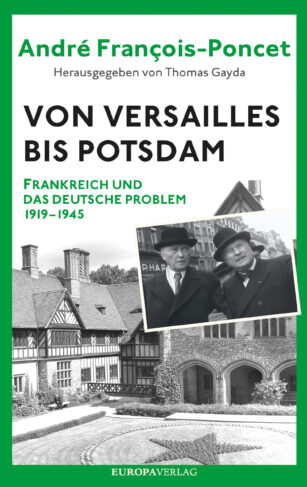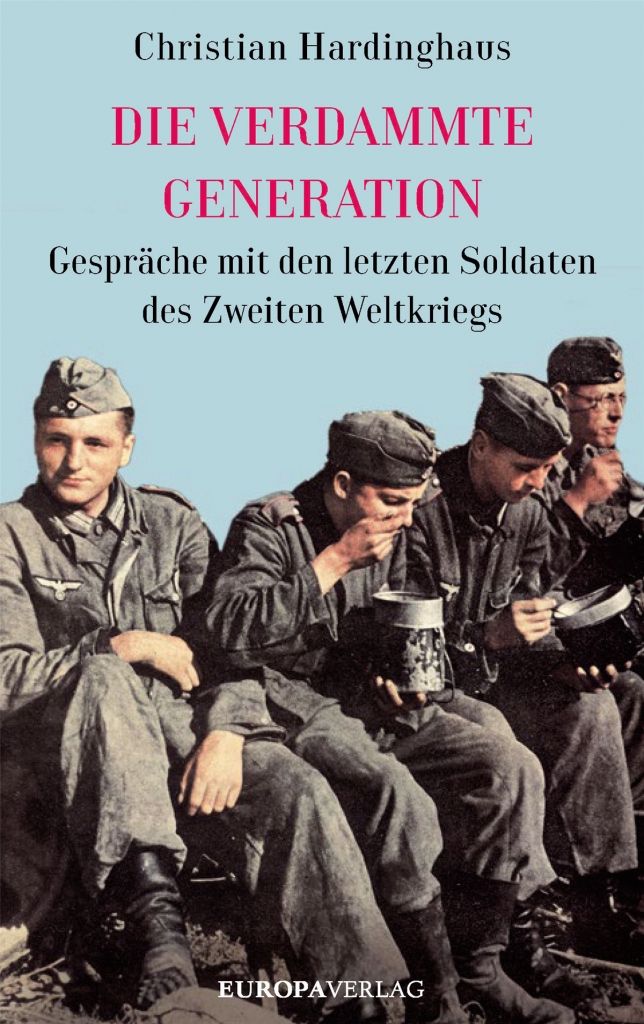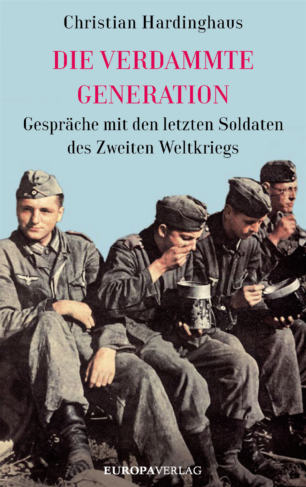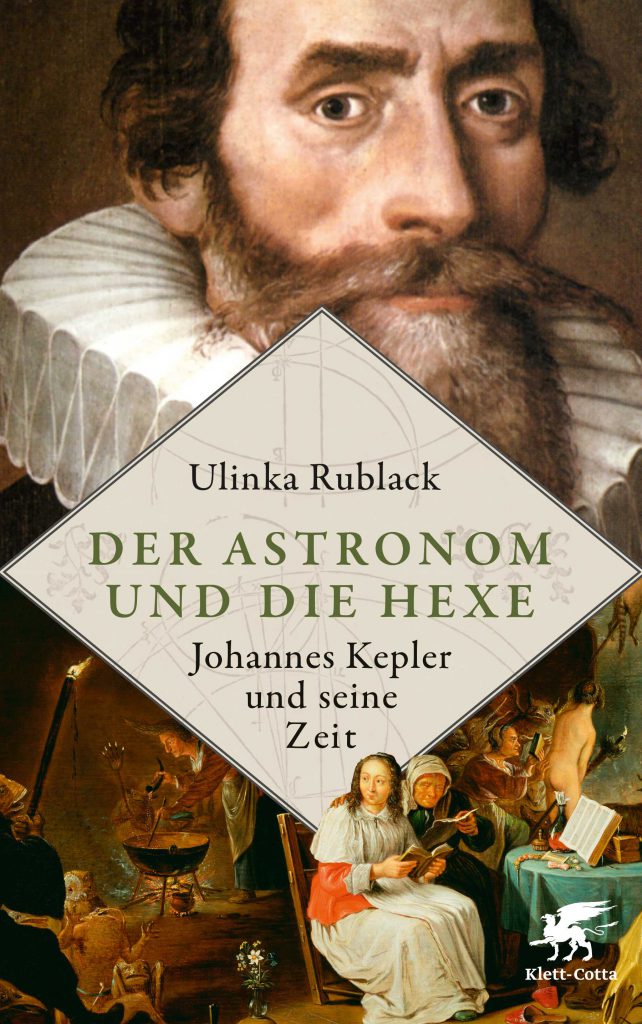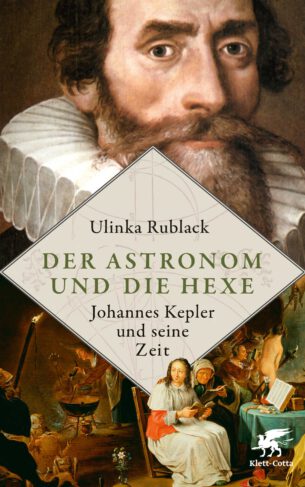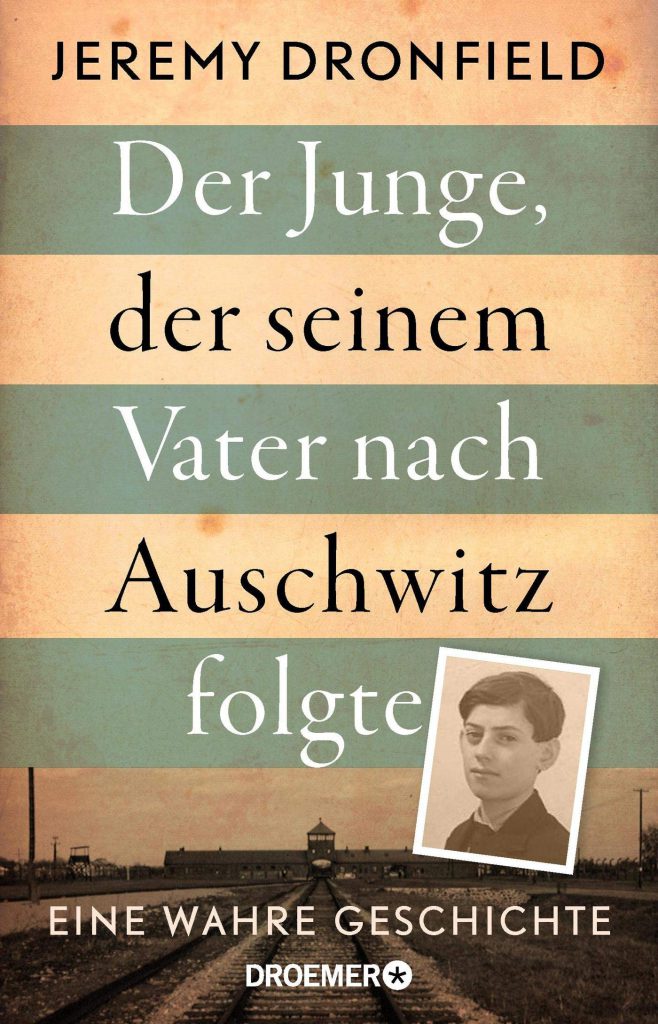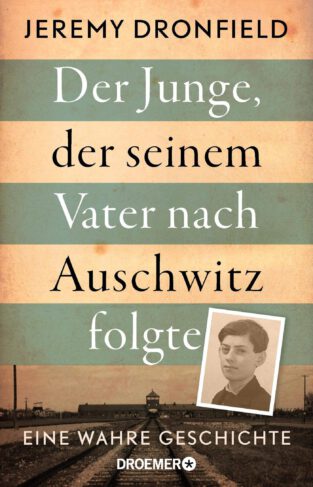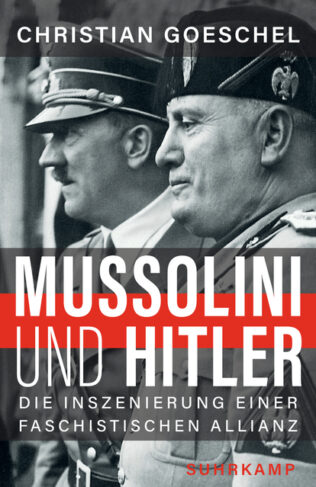Ariel Magnus: Das zweite Leben des Adolf Eichmann
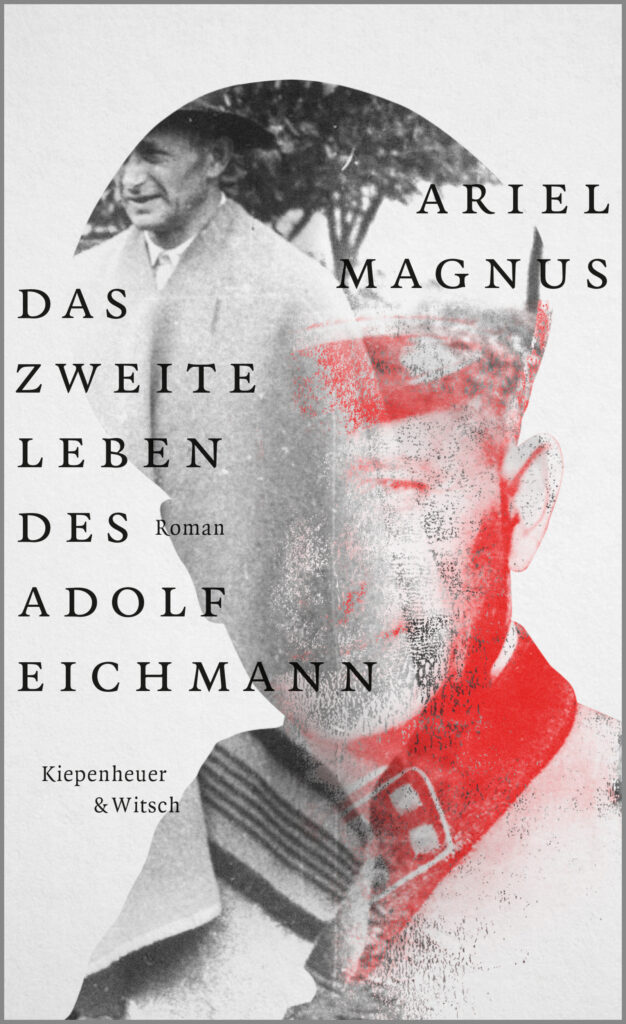
Inhalt:
Ein Roman aus der Perspektive Adolf Eichmanns über seine Zeit in Argentinien.
Mit beißendem Spot nimmt uns Ariel Magnus mit ins Innere des unbelehrbaren Nazis, dessen antisemitischer Irrglauben auch im argentinischen Versteck ungebrochen war und der dort bar jeder reue und völlig unbehelligt von einer Rückkehr nach Deutschland träumen konnte – bis zu seiner Verhaftung 1960.
(Klappentext)
Rezension:
Buenos Aires, 11. Mai. Ein Mann, seit fünfzehn Jahren auf der Flucht. Dann geht alles sehr schnell. Die Überwältigung und Entführung Adolf Eichmanns durch Agenten des israelischen Geheimdiensts Mossad im Jahr 1960 sorgte weltweit für Aufsehen.
Einem der größten Schreibtischtäter und Organisatoren des Holocausts sollte der Prozess gemacht und einem gerechten Urteil zugeführt werden. Seit 1950 versteckte sich der Bürograt des Todes, der einst die Deportationszüge in die Konzentrationslager organisierte und bei der berüchtigten Wannsee-Konferenz Protokoll führte, in Argentinien, unter falschen Namen, von den Geheimdiensten mehrerer Staaten schon länger beobachtet.
In Tel Aviv vor Gericht gestellt, plädiert der Mann, der sich als bloßer Befehlsempfänger sieht, auf „Nicht schuldig!“. Eichmann zeigt keine Reue und wird wegen seiner Taten zum Tode verurteilt. So viel zu den tatsächlichen Geschehnissen, doch wie kam es zu der Entdeckung des Mannes, der sich so lange einer gerechten Strafe entziehen konnte?
Wie lebte, was dachte der Mann, der Millionen von Menschen auf dem Gewissen hatte? Der Journalist und Schriftsteller Ariel Magnus hat einen Blick hinter der Fassade versucht. Dabei ist ein Roman entstanden, den man sich kaum entziehen kann.
Es ist eine Qual, in die Geschichte einzufinden, da gleich von Beginn an aus der Perspektive Eichmanns erzählt wird. Die Sicht eines Mannes, der verdrängt, wird eingenommen, nichts schlechtes an seinen Taten und Entscheidungen sehen will und sich dennoch ständig vor Familie und anderen Untergetauchten, nicht zuletzt vor sich selbst rechtfertigt. Dabei wirken die Sätze so spröde und starr, wie man sie nur einem Bürokraten angedeihen lassen kann, nicht leicht zu lesen.
Ariel Magnus hat es geschafft, dass immer eine gewisse Distanz zum Hauptprotagonisten gehalten wird, zugleich jedoch unwillentlich fasziniert ist von dieser Figur. Dabei bleibt der Autor sehr dicht an verbürgten Geschehnissen, Ergebnis intensiver Rechercheleistung. Ein paar Dialoge mögen der schriftstellerischen Phantasie entsprungen sein, der Rest lässt sich anhand von Protokollen etwa, Beobachtungen oder Tonbandaufnahmen aus dieser Zeit verifizieren.
„Erstens muss ich Ihnen sagen, mich reut gar nichts“, sagte er, auch wenn er vorgehabt hatte, das am Ende zu sagen. „Es wäre sehr leicht für mich, mich reuig zu zeigen, so zu tun, als wäre aus einem Saulus ein Paulus geworden.“
Ariel Magnus: Das zweite Leben des Adolf Eichmann
Auch wenn man die Geschichte und ihren Ausgang kennt, hat man einen ungeheuer dicht erzählten und spannenden Roman vorliegen, in dem der Protagonist verklärt auf seine Taten blickt, versucht, seine neue Rolle zu finden, in ständiger Angst, doch noch entdeckt zu werden. Die ständige Anspannung ist zwischen den Zeilen zu spüren, wird mit fortschreitender Handlung größer. Der Schriftsteller indes ist fortwährend bei einem eher ruhigen Erzählstil geblieben und hat es dabei auch noch geschafft, einen Teil seiner eigenen Familiengeschichte mit einzuweben.
Bleibt die Frage, darf man das? Einem der größten und schrecklichsten Schreibtischtäter des Holocausts in gewisser Weise wieder lebendig werden lassen? Ariel Magnus schafft es, Eichmann zu entlarven, als das was er war. Mittelmäßiger Trottel, Rachsüchtiger mit Komplexen. Ein Kackhaufen, dem es lange genug gelungen war, seinen Geruch zu verschleiern. So beschreibt ihn der Autor. Vielleicht ist es das, was aus der Erzählung mitgenommen werden kann? Irgendwann fällt jeder Geruch auf.
Die wahre Geschichte:
Wikipedia I Biografie I Operation Adolf Eichmann
Autor:
Ariel Magnus wurde 1975 in Buenos Aires geboren und ist ein argentinischer Schriftsteller und Übersetzer. Er besuchte die deutsche Schule und studierte von 1999 an Romanistik und Philosophie in Heidelberg und Berlin. An der Humboldt-Universität arbeitete er zudem am Lehrstuhl für Spanische Literatur. Für verschiedene argentinische zeitungen und Zeitschriften schreibt er regelmäßig Beiträge und veröffentlichte 2007 einen Roman, für den er mit dem Literaturpreis La otra Oriella ausgezeichnet wurde. Seine Werke wurden in zahlreichen Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er einer breiteren Öffentlichkeit mit seinem 2006 veröffentlichten Buch , in welchem er seiner deutsch-jüdischen Großmutter ein Denkmal setzte, welches 2012 ins Deutsche übersetzt wurde und unter dem Titel „Zwei lange Unterhosen der Marke Hering“ erschien.
Ariel Magnus: Das zweite Leben des Adolf Eichmann Weiterlesen »