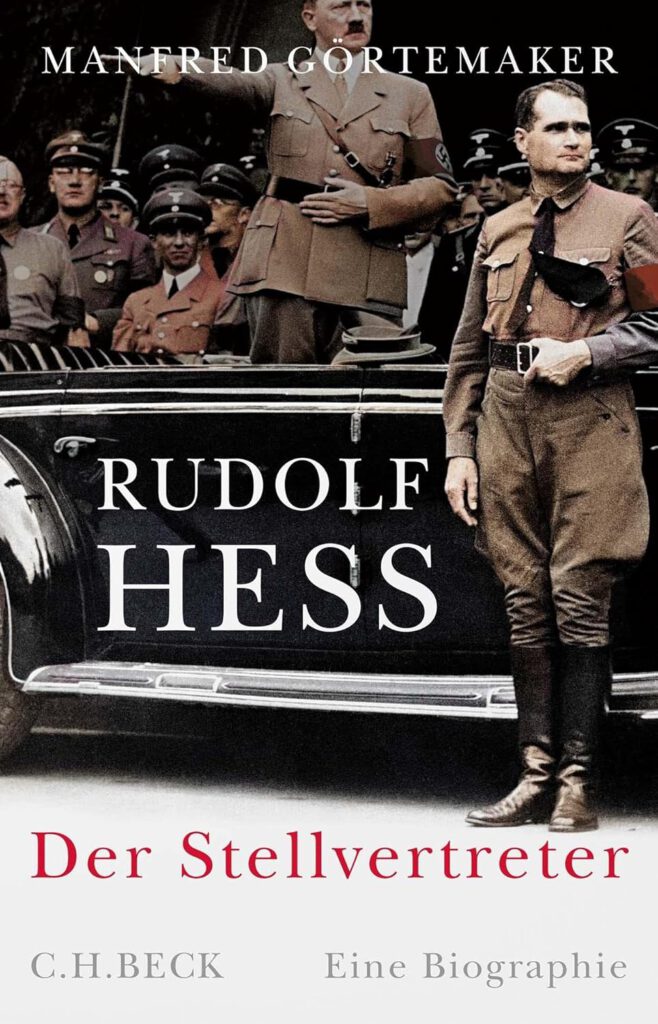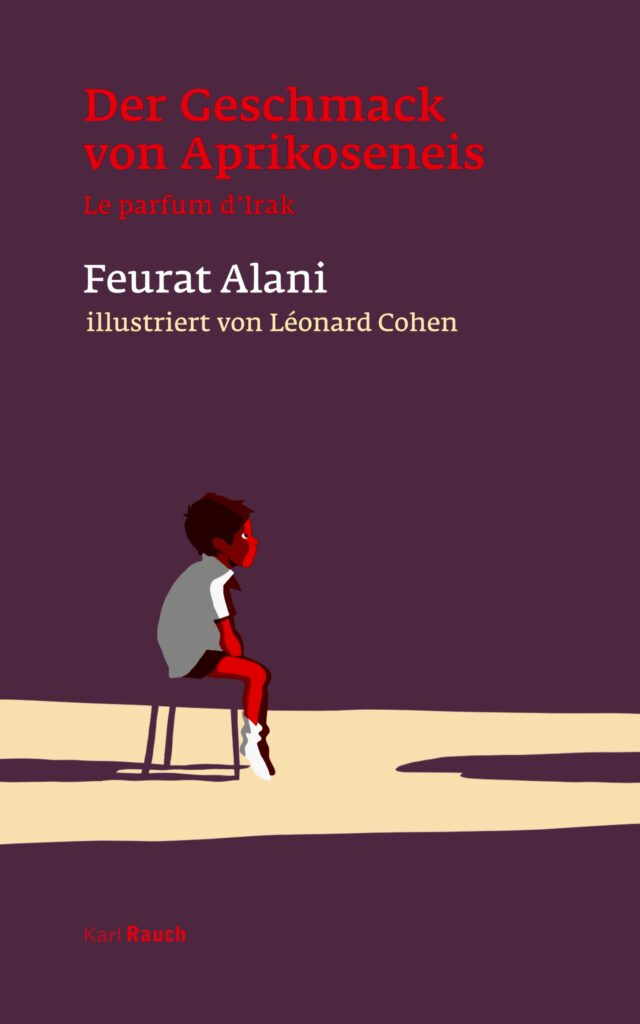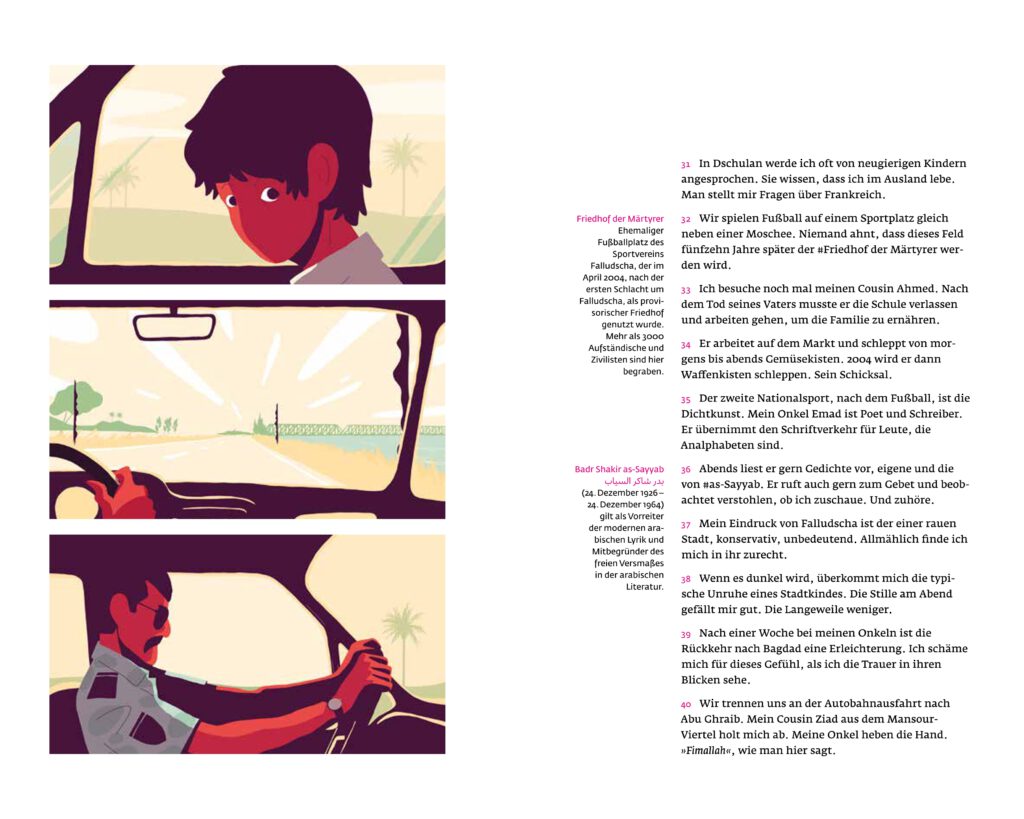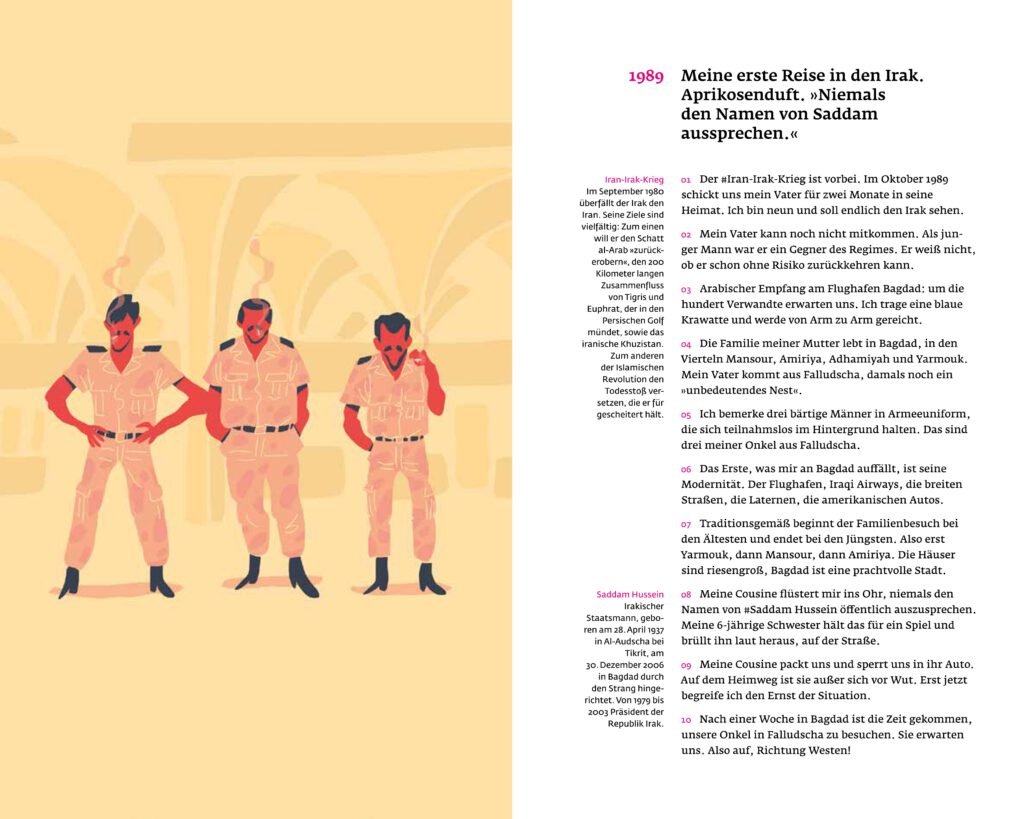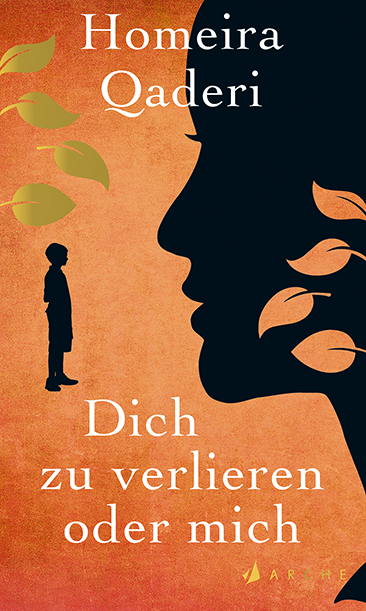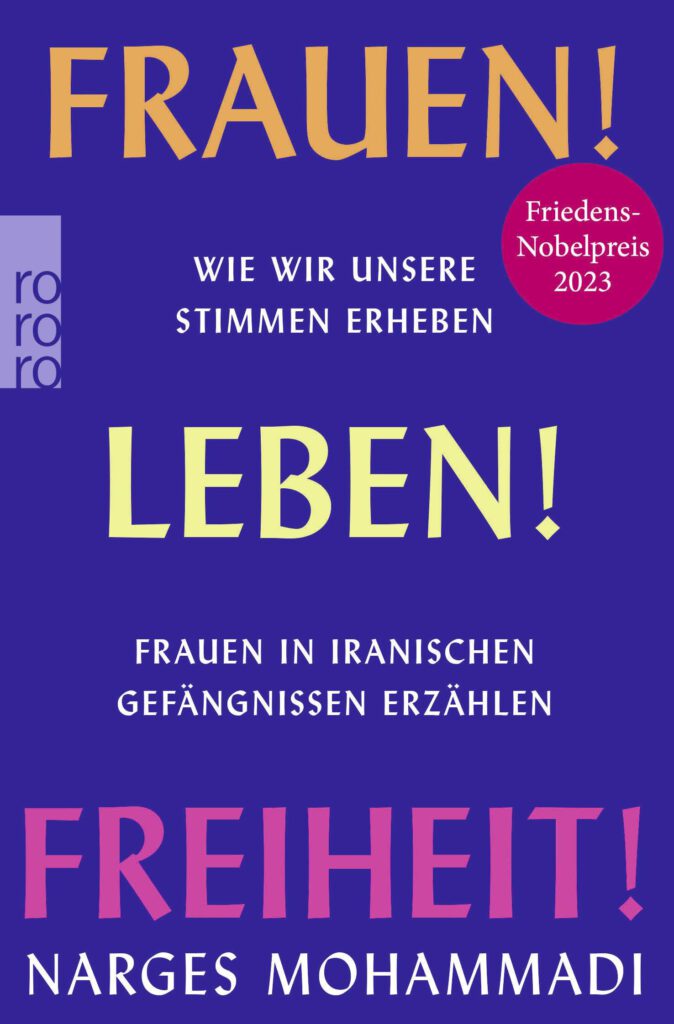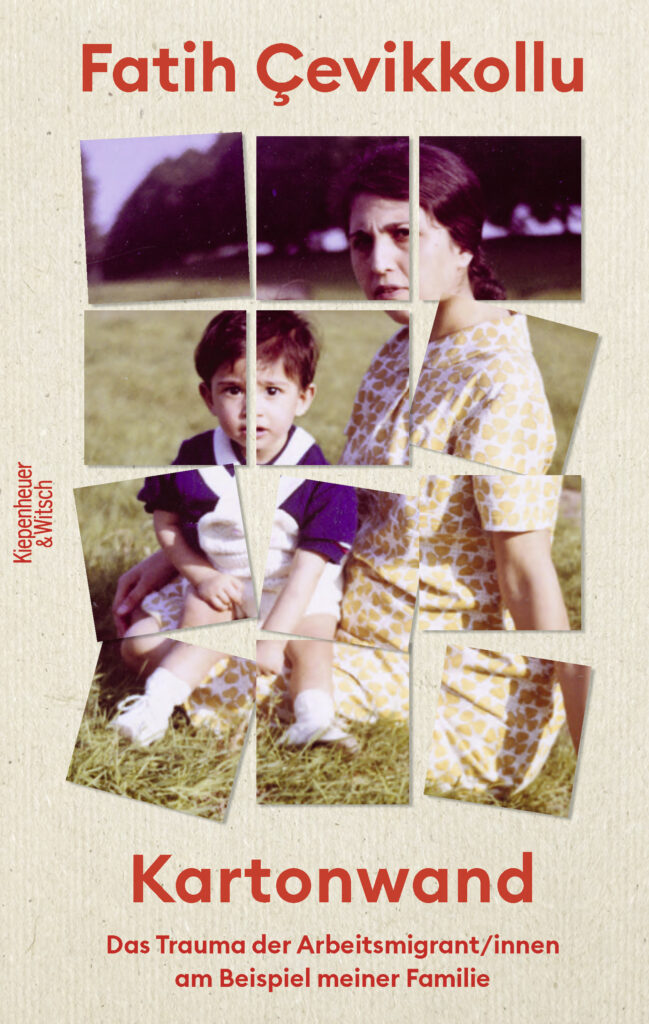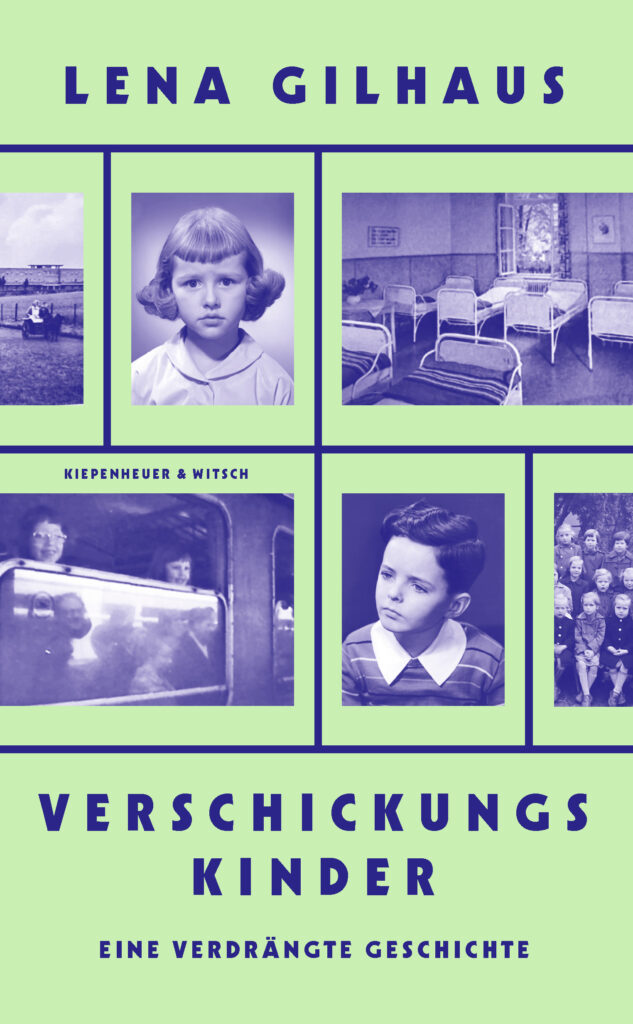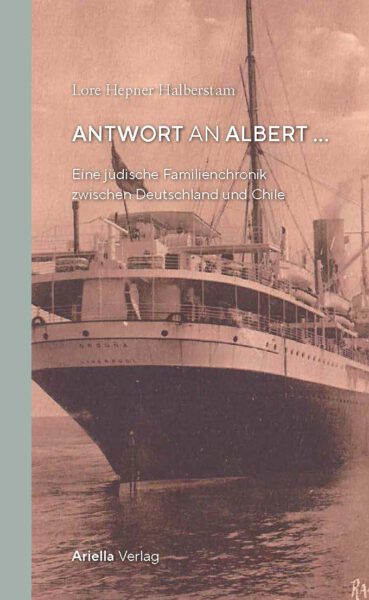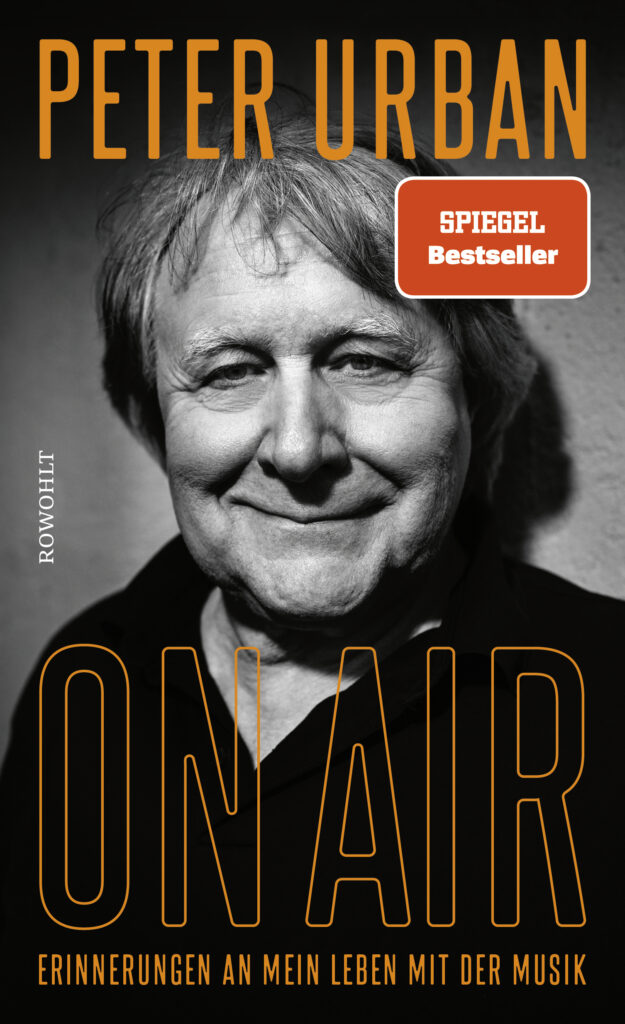Saul Friedländer: Blick in den Abgrund – Ein israelisches Tagebuch

Inhalt:
Israel steht am Abgrund. Das Israel, das wir kannten. Saul Friedländer, der große Historiker des Holocaust, hat ein Tagebuch geschrieben, in dem er die aktuellen Ereignisse schildert und kommentiert, in Rückblenden aus der Geschichte des Landes, das er mit aufgebaut hat, erzählt, Konflikte analysiert und über Lösungen nachdenkt. Sein Tagebuch geht unter die Haut und jeden etwas an, dem an Israel liegt. (Klappentext)
Rezension:
Nicht nur außenpolitisch sieht sich dieses kleine Land vor ständiger Herausforderung, auch innen ist es kompliziert. Die Gesellschaft Israels, sie befindet sich im Zangengriff radikaler Kräfte und verschiedener Sichtweisen jüdischer Religion und ihren Interpreten. Die politischen Köpfe dieses Systems agieren eigensinnig, sind teilweise korrupt und das zieht sich bis in die obersten Ebenen des Staates hinein.
Im Jahr 2023 versucht sich der israelische Präsident an eine Justizreform, die ihn vor einem Gerichtsprozess bewahren soll, seine Koalitionspartner suchen ebenfalls Wege, sich und ihren Anhängern Vorteile zu verschaffen. Die Demokratie und der Pluralismus des Landes, sie bleiben auf der Strecke. Immer mehr Menschen protestieren.
Einige denken gar ans Auswandern aus dem Land, welches einst Heimstatt aller Juden sein wollte. Der Historiker und Schriftsteller Saul Friedländer beobachtet die gesellschaftlichen Spannungen aus der Ferne, analysiert und zieht Verbindungen zur Vergangenheit, die auch die eigene ist. Entstanden ist dabei ein hochbrisantes und komplexes Tagebuch, zugleich ernüchternd und erschreckend.
Als Außenstehender fällt es bereits schwer, die außenpolitischen Ereignisse zu sortieren und eine Übersicht zu wahren. Zu viel ist bereits passiert mit diesem Land, in der Innenpolitik sieht es dabei nicht besser aus.
Von Januar 2023 bis zum Juli 2023 beschreibt der Autor Tag für Tag das aktuelle Geschehen, welches einem fassungslos werden lässt, angesichts der Herausforderungen, mit denen in der Region ohnehin alle Akteure konfrontiert werden oder sich gegenseitig aussetzen.
Hoch komplex ziehen sich die Fäden der Handlungen israelischer Spitzenpolitiker, deren Agieren die Unfähigkeit von Regierenden manch anderer Länder wie vorausschauendes und überlegtes Handeln aussehen lässt. Schon für jene, die tagtäglich mit rassistischen Aussagen von Ministern konfrontiert werden, aus einem Land, welches es eigentlich rein von der Historie besser wissen müsste, ist dies schwer zu ertragen.
Ohne Vorkenntnisse, etwa der Ausrichtung einzelner Gruppen und Parteien innerhalb Israels ist der Zugang zur Lektüre jedoch überhaupt nicht gegeben, selbst wenn zwischendurch Saul Friedländer einen Rückblick wagt, um bestimmte politische oder religiöse Denkweisen zu erklären, die das Bild Israels im Innern heute beherrschen.
Eine Lektüre für zwischendurch ist schon rein thematisch nicht möglich, doch einige fehlende Teile im Gesamtbild werden uns Lesenden geliefert. Sehr schnell kommt man dahinter, welche Politiker zur Seiten treten müssten, damit das Land auch innenpolitisch in ruhige Fahrwasser gerät. Das Handeln, welches beschrieben wird, führt in die Isolation. Selbst enge Freunde Israels gehen auf Distanz.
Es ist eine hervorragende und differenziert ernüchternde Diagnose, die wenig Raum für Hoffnung lässt. Die Form des Tagebuchs verdeutlicht die immer tiefere Spaltung des Landes, innerhalb von Monaten. Ratlos bleiben die zurück, die letztendlich damit leben und irgendwann versuchen müssen, die Situation aufzulösen. Für Saul Friedländer auch ein Blick auf ein Israel, welches er immer weniger als das erkennt, was er einst mitgestaltet hat.
Die Analyse zieht sich zwischen den religiösen Ausrichtungen in Verbindung der politischen Wirkung, vor allem nach innen, was aber das äußere bedingt. Die Frage, was kommt, wenn der Bruch vollständig ist, muss in Friedländers Buch unbeantwortet bleiben. Israel braucht jedoch jetzt schon, so das Gefühl nach dem Lesen, eine Menge Glück, dies nicht auszuprobieren.
Autor:
Saul Friedländer wurde 1932 in Prag geboren und ist ein israelischer Historiker und Autor. Kurz nach der Besetzung der Tschechoslowakei flohen seine Eltern nach Frankreich, erst nach Paris, später in die unbesetzte Zone. Nach Verhaftungen ausländischer Juden 1942 wurde er in einem jüdischen Kinderheim, später einem katholischen Internat versteckt und überlebte so den Holocaust.
Mit 15 Jahren ging er mit gefälschten Pass nach Palästina und absolvierte eine dreijährige Militärzeit und studierte schließlich in Paris und Genf, wo er 1963 in Geschichte promovierte. In verschiedenen Positionen arbeitete er für den israelischen Staat und ist ein bedeutender Historiker und war Mitglied verschiedener Organisationen. Er erhielt u.a. den Dan-David-Preis und den Balzan-Preis, sowie den Geschwister-Scholl-Preis und den Preis der Leipziger Buchmesse.
Saul Friedländer: Blick in den Abgrund – Ein israelisches Tagebuch Weiterlesen »