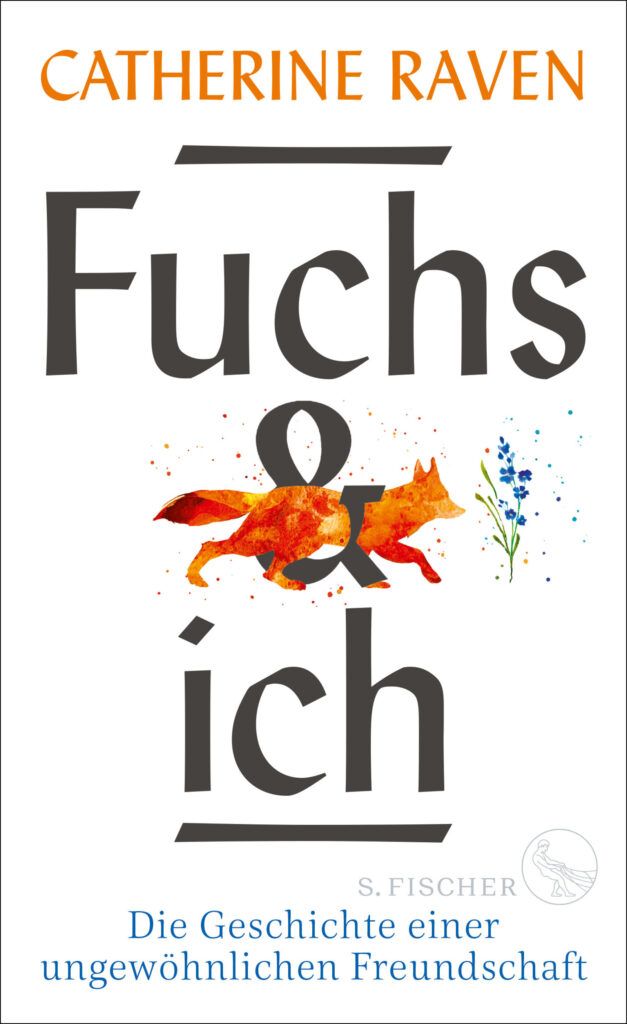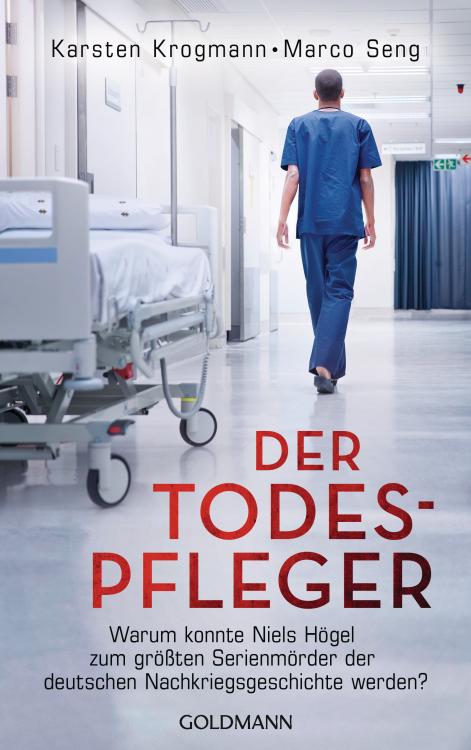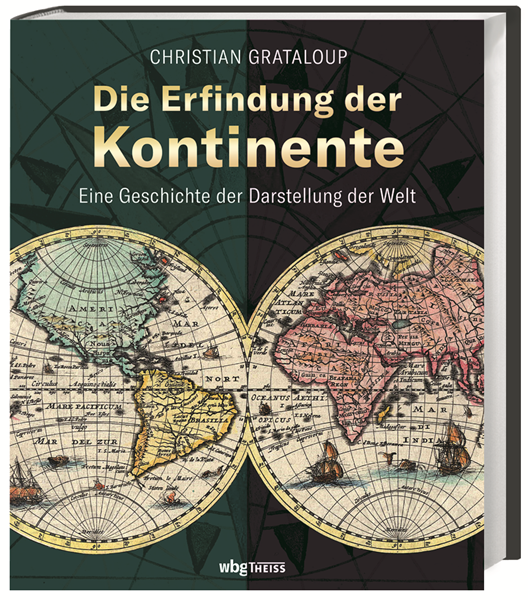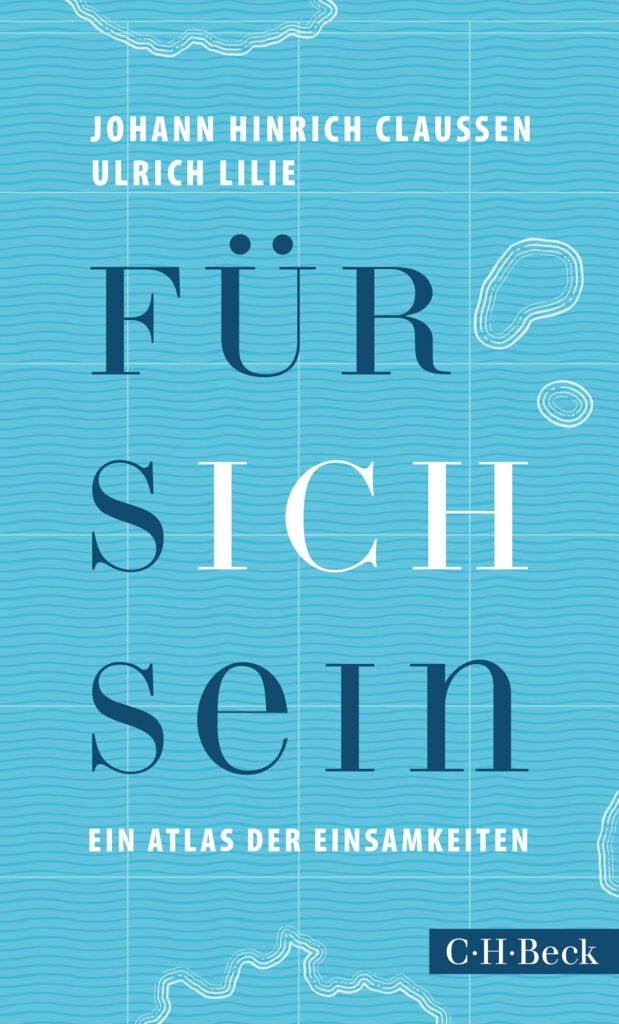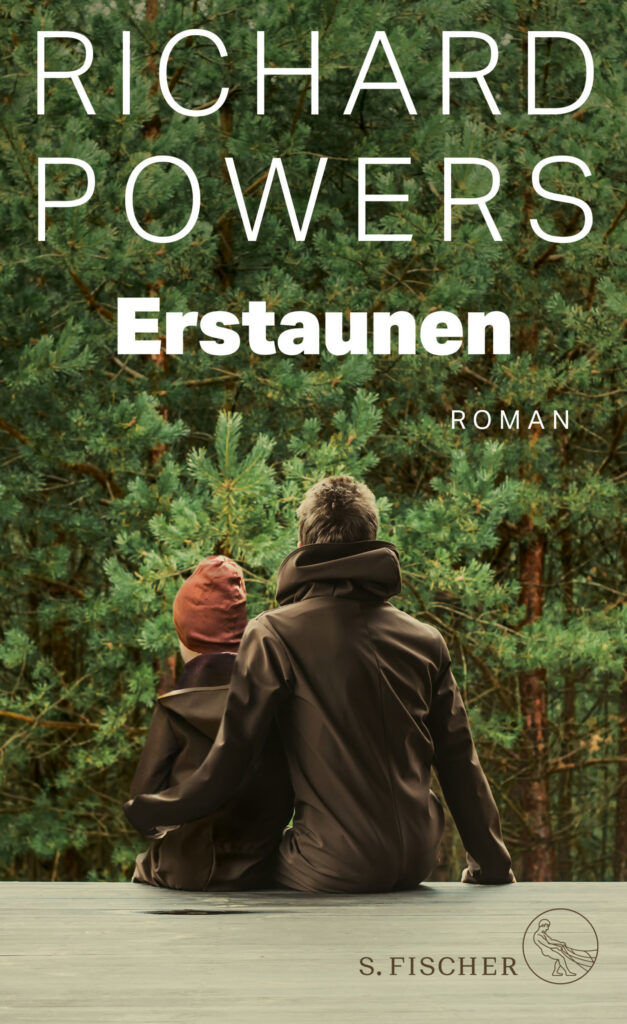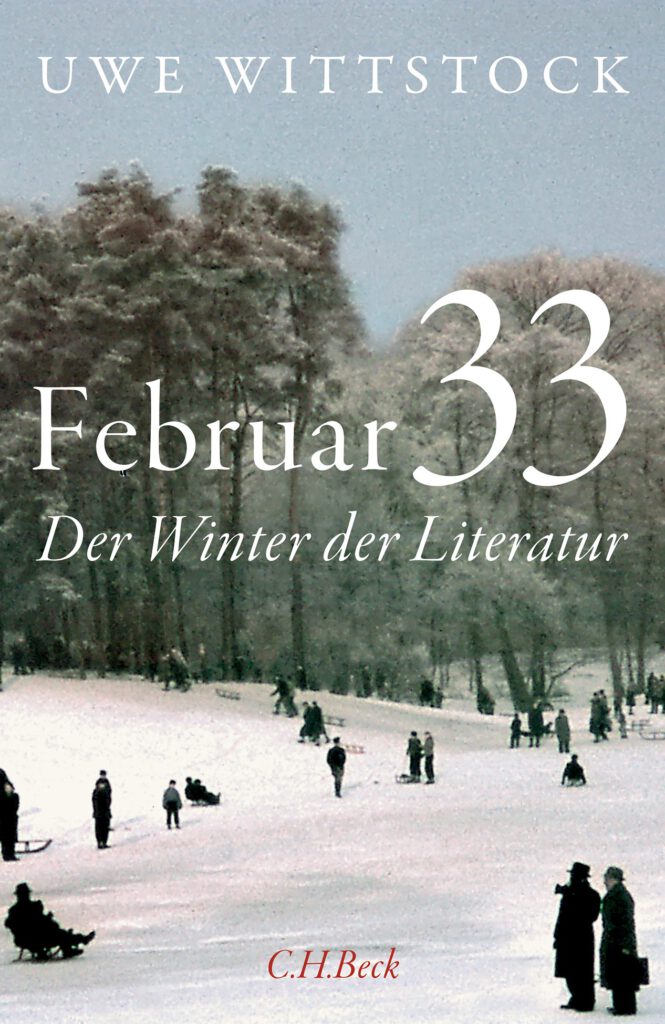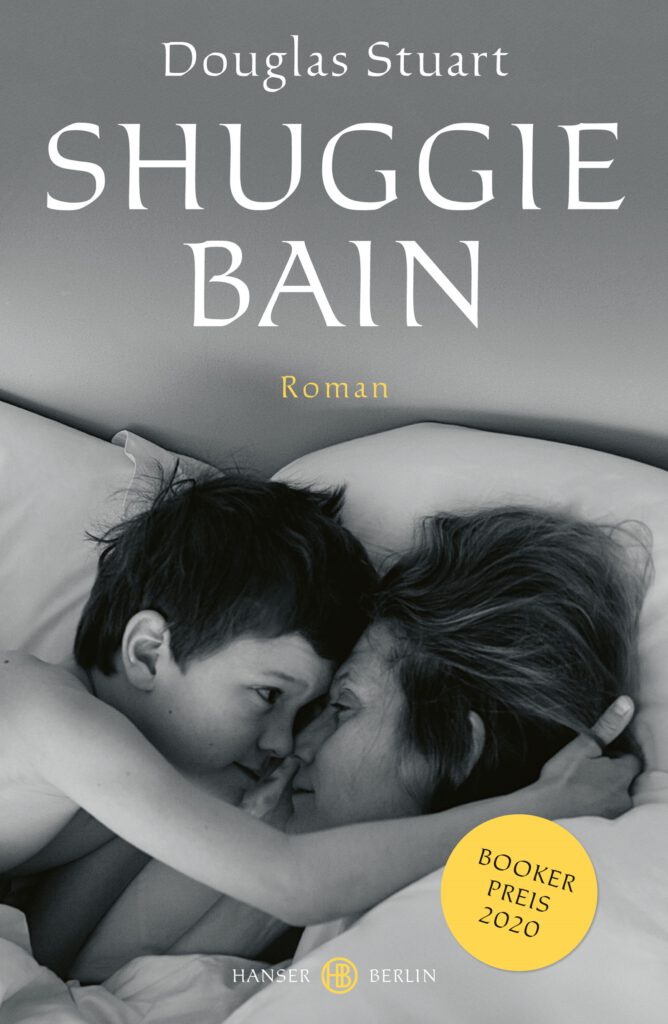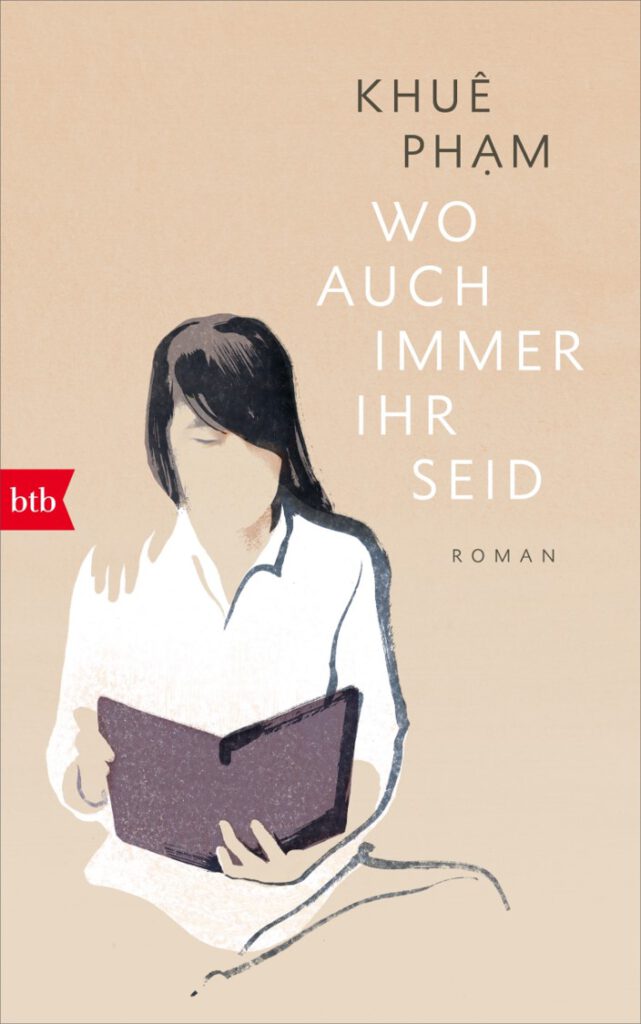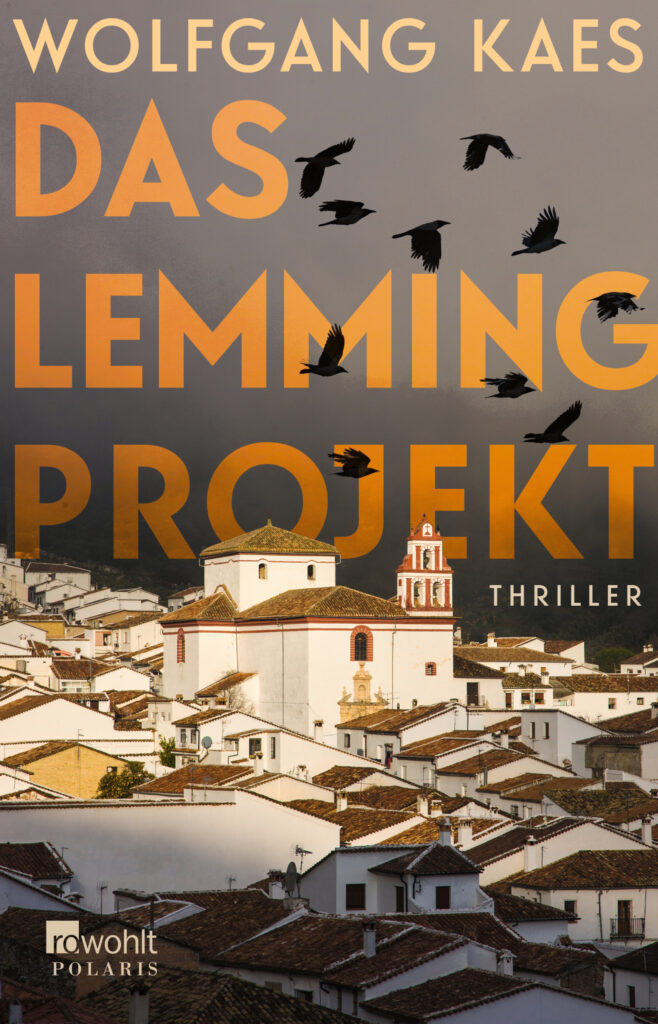Sophia Kimmig: Von Füchsen und Menschen
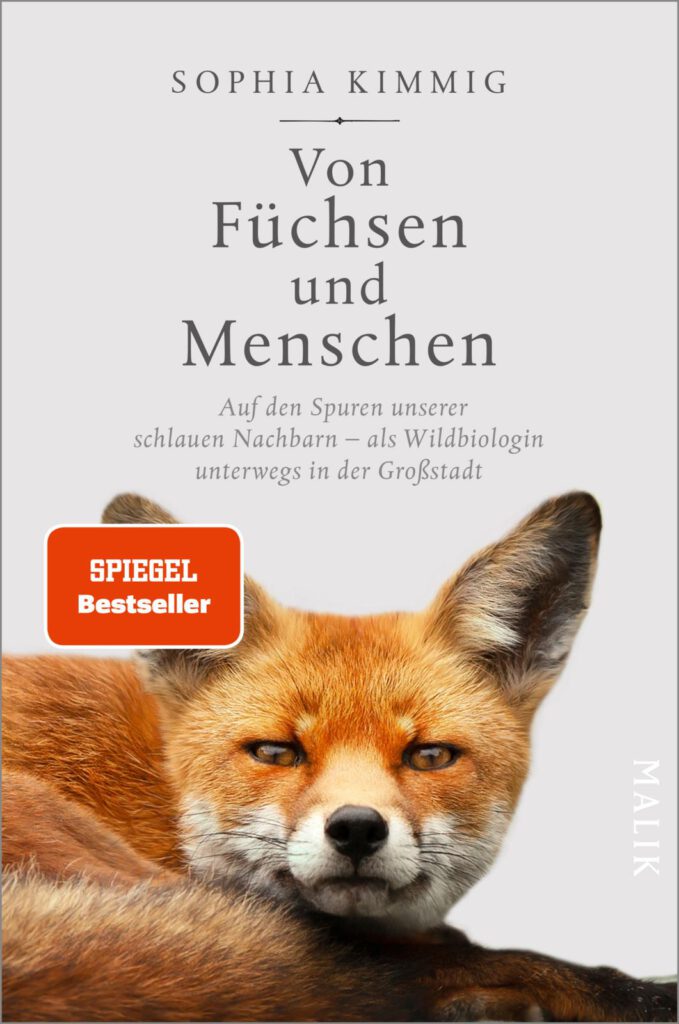
Inhalt:
Roter Pelz, bernsteinfarbene Augen, grazile Statur – wer ihm einmal begegnet, vergisst diesen Anblick nicht mehr. Doch der Fuchs ist nicht nur für seine Schönheit, sondern auch als schlau, gerissen und neugierig bekannt. Vom Polarkreis bis in den Norden Afrikas findet man ihn, und er besiedelt zunehmend unsere Städte. Wildbiologin Sophia Kimmig heftet sich dort an seine fersen und versucht, hinter das Geheimnis des Überlebenskünstlers zu kommen. Sie nimmt uns mit auf nächtliche Erkundungstouren, erzählt amüsant von den Tücken der Feldforschung und gewährt uns spannende Einblicke in das verborgene Leben unserer wilden Nachbarn. (Klappentext)
Rezension:
Diesen Tieren sagt man so einiges nach. Schläue und Gerissenheit sind die Eigenschaften, die sich häufig in Märchen und Fabeln wiederfinden und Füchsen angedichtet werden, doch vor allem sind sie eines. Flexible Generalisten, die sich veränderten Bedingungen bisher gut anpassen und damit umgehen konnten. So ist der Rotfuchs heute einer der erfolgreichsten Kulturfolger des Menschen und bewohnt, während es für seine Verwandten auf dem Land immer schwieriger wird, zunehmend unsere Städte.
Weitgehend von uns unbemerkt, bevölkert er Bahndämme, Brachgelände, Schul- und Friedhöfe und bedient sich dabei einem reichhaltigen, durch uns stetig gedeckten Tisch. Doch, wie findet sich der Fuchs überhaupt in einer eigentlich tierfeindlichen Umgebung überhaupt zurecht? Wie leben diese Tiere inmitten unter uns?
Die Wildbiologin Sophia Kimmig begibt sich auf Spurensuche durch Berlin, von den Randbezirken bis hinein ins Regierungsviertel und berichtet von ihrer Arbeit und dem Leben Meister Reineckes, welches beinahe unbemerkt parallel zu uns stattfindet.
Füchse vermögen zu faszinieren. Es sind die flüchtigen Begegnungen, die uns für einen kurzen Moment innehalten lassen. Ein Rascheln im Gebüsch, das Aufblitzen roten Fells am Wegesrand, manchmal sogar in Hauseingängen oder gleich in der U-Bahn. Ein Video eines solchen Fuchses, der sich in die Eingeweiden der öffentlichen Verkehrsmittel Berlins gewagt hatte, ging viral und selbst das Bundespräsidialamt ist inzwischen auf den Fuchs gekommen.
Wie kam es zu diesem Wandel? Einst wurde das Tier als Nahrungskonkurrent und Krankheitsüberträger stark bejagd. Heute ist es Kultobjekt und die meisten Menschen ihm gegenüber positiv aufgeschlossen.
Sophia Kimmig ergründet seit ihrer ersten Begegnung mit dem Rotpelzigen die Füchse Berlins, besendert sie und schafft uns damit einen Überblick über das verborgene Leben dieser Tiere und zeigt, dass die Städte längst nicht mehr nur für uns Menschen ein lebendiger Ort ist. Amüsant erzählt sie von den Unwägbarkeiten ihrer Arbeit, aber auch dem Wandel in der Forschung und räumt zugleich mit einigen Legenden auf, die unsere wilden Nachbarn umgeben.
Natürlich fehlt er nicht, der persönliche Blick durch die Fuchsbrille, aber die Autorin bleibt sich den kurzweiligen Kapiteln über treu und verbindet kenntnisreich Informationen, nach denen man mit anderen Augen durch die Städte gehen wird. In jedem Fall aufmerksamer.
Ich trage eine Fuchsbrille. Eine Brille, die mich eine verborgene Welt sehen lässt, die ich ohne nicht bemerkt habe. Wenn ich mich durch die Stadt bewege, sehe ich sie. Überall.
Sophia Kimmig: Von Füchsen und Menschen
Einblicke gewährt Kimmig sowohl in ihre alltägliche Arbeit, der Sicht von außen als auch in das Leben der Tiere, welches nicht etwa durch Bejagung oder Nahrungsmangel gefährdet ist, sondern, des Lebensraumes bedingt, zunehmend durch den Straßenverkehr.
Der Wandel der Sichtweise wird ebenso sachlich dargestellt, wie der der Forschung, aber auch, wie das Zusammenleben zwischen Mensch und Wildtier gelingen kann, in einer immer enger werdenden Welt. Ergänzt wird dies durch sog. Fun Facts am Ende eines jeden Kapitels, einem auflockernden Fototeil und nicht zuletzt durch Beschreibungen ausgewählter Fuchsleben inmitten Berlins.
Die Autorin schafft den Spagat zwischen informativen Sachbuch und unterhaltender Lektüre ohne erhobenen Zeigefinger, sowie ihre Begeisterungsfähigkeit auf Lesende überspringen zu lassen, sowie zu zeigen, wie Stadtökologie wirken kann.
Danach wird man Meister Reinecke mit anderen Augen betrachten. Muss man vielleicht auch. Kimmig zeigt, dass sich der Fuchs als unser, auch städtischer Nachbar, längst etabliert hat.
Autorin:
Sophia Kimmig wurde 1988 in Berlin geboren und arbeitet als Widlbiologin u.a. für das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, erforscht dabei die Anpassung der Wildtiere an sich veränderte Lebensbedingungen, am Beispiel des Fuchses und dessen Stadtleben. Neben ihrer Tätigkeit im Bereich Forschung und Umweltbildung erarbeitet sie zahlreiche Beiträge für Medien, in Vorträgen und Publikationen, um Akzeptanz für Natur- und Artenschutz zu schaffen. Die Autorin lebt in Berlin.
Sophia Kimmig: Von Füchsen und Menschen Weiterlesen »