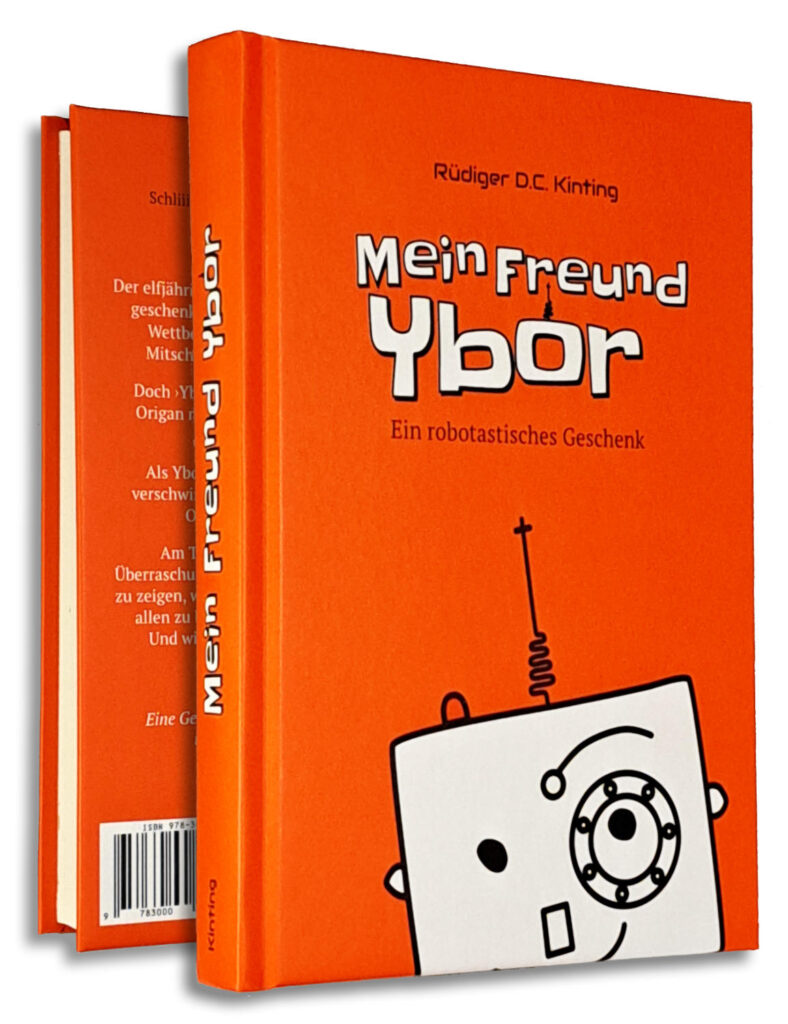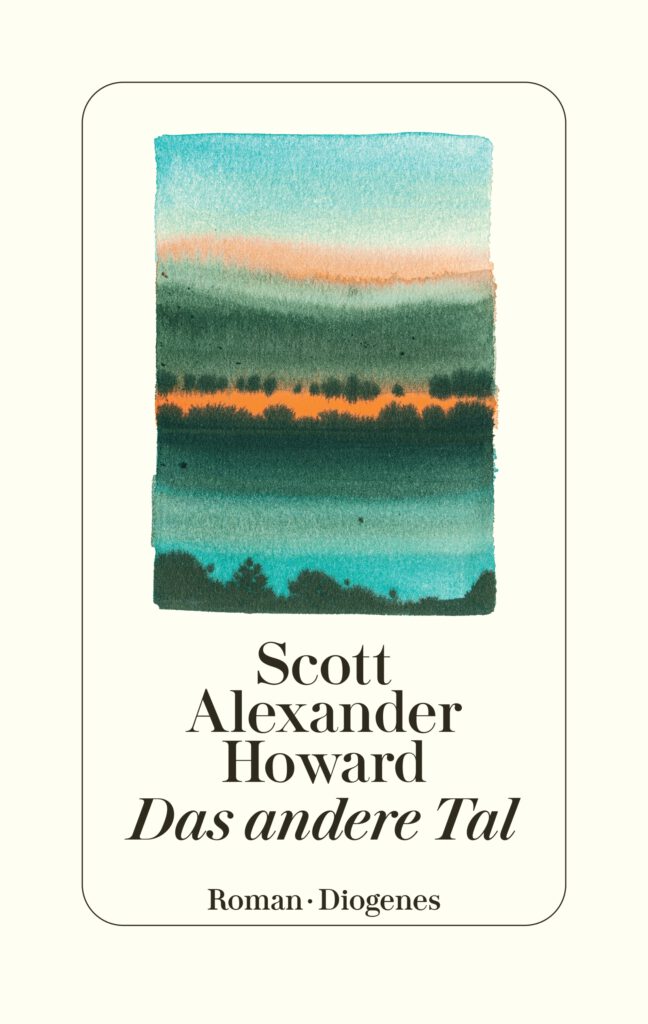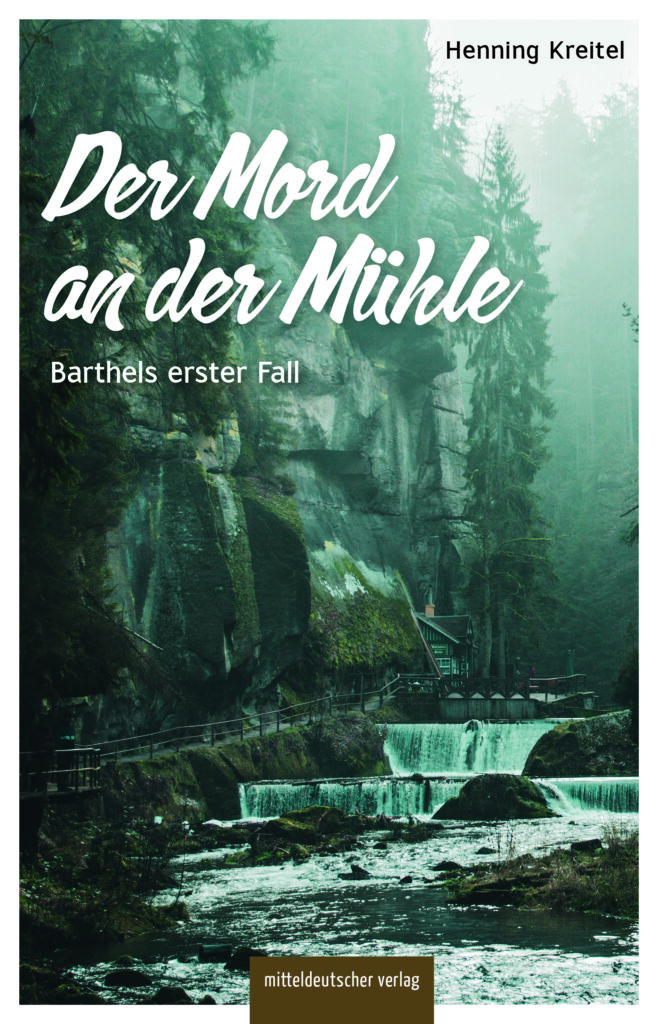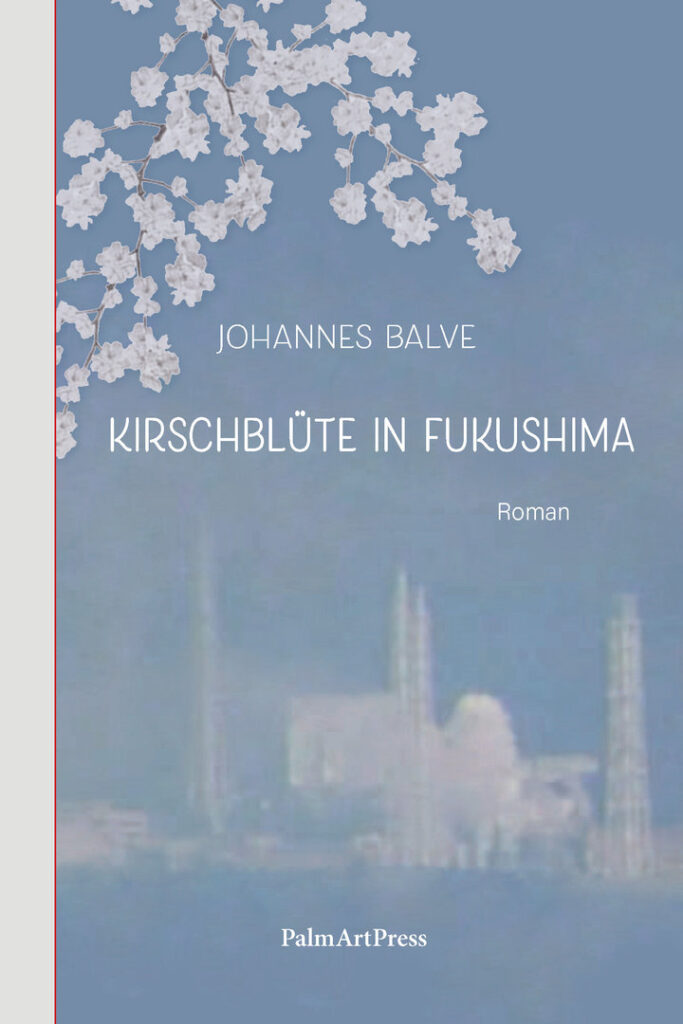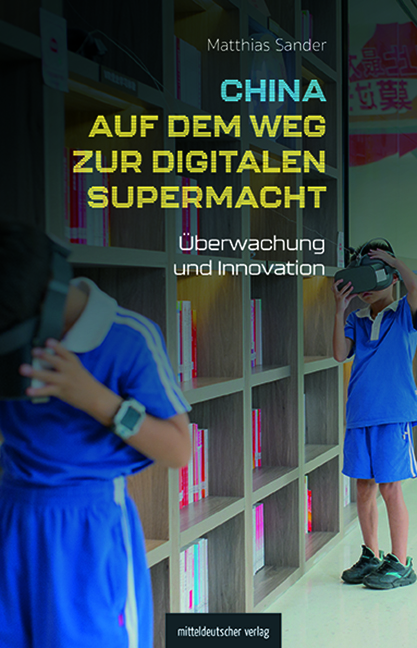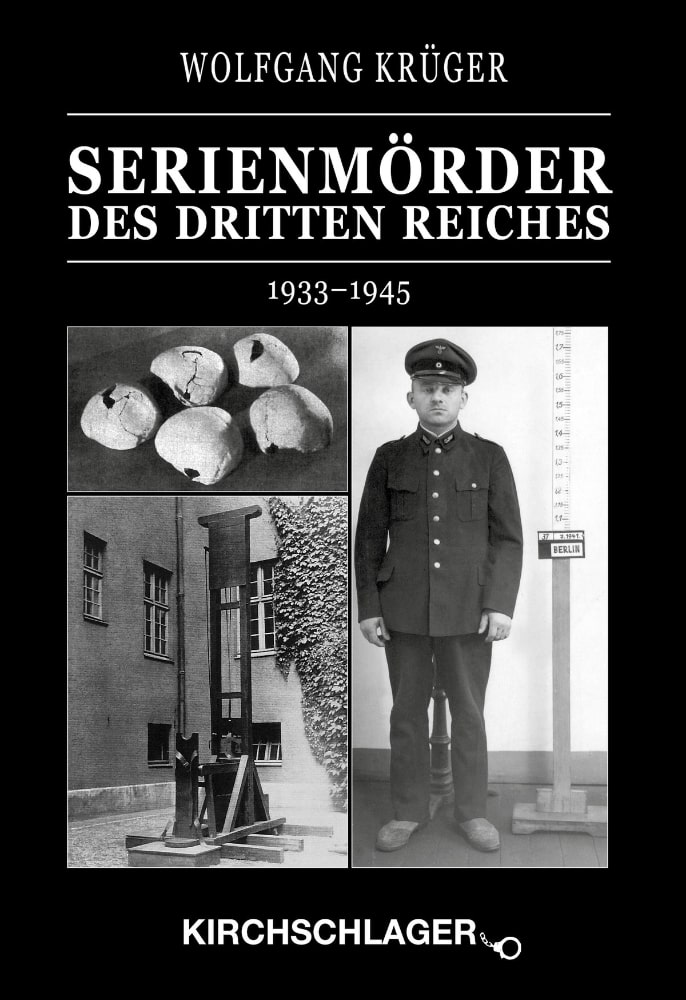Meine Premiere im vergangenen Jahr bedurfte einer Wiederholung und so bin ich auch diesmal wieder auf der Frankfurter Buchmesse gewesen, habe mich aber an meinem Vorsatz gehalten, nur die Fachbesuchertage zu nutzen. Im letzten Jahr war es stellenweise viel zu voll, was ich mir nicht mehr antun möchte, zumal, wenn ich schon die Gelegenheit habe, es anders machen zu dürfen. Einen Tag vorher bin ich mit der Bahn problemlos angereist, übrigens heute ebenso problemlos zurück, auch wenn der eigentliche Zug für die Rückfahrt bereits eine Woche zuvor von der Deutschen Bahn gecancelt wurde. Manchmal muss man halt Glück haben.
Auch mit meinem Hotel, welches im berüchtigten Bahnhofsviertel lag, war das so. Von außen sehr zweifelhaft, was noch freundlich ausgedrückt ist, war es zumindest von innen zwar sehr einfach, aber sauber, auf den Gang vielleicht etwas hellhörig, aber Fenster zum Hof ohne Straßenlärm, den ich eh nicht höre, wenn ich denn einmal schlafe.
Und mehr tut man ja eh nicht in einem Hotel, wenn man eine Städtereise macht, wegen was auch immer. Nach Einchecken im Hotel ging es dann auf das Messegelände, da ich in die Pressekonferenz zur Eröffnung hineinkommen wollte. Dafür aber hätte man extra Tickets gebraucht, die ich nicht hatte, auch nicht bekam und so habe ich den ersten „Eklat“ der Buchmesse verpasst, dem einige schon vorausgegangen waren und weitere folgen sollten.
Gastland war in diesem Jahr Italien, was aufgrund seiner Regierung, nicht allen gefällt, bestimmt doch das Gastland z. B. die Auswahl von Autoren und Autorinnen, die im Rahmen der Messe offiziell das Land vertreten „dürfen“. Kritiker der postfaschistischen Regierung kamen daher nicht auf offiziellen Wege auf die Buchmesse, konnten dennoch aber daran teilnehmen, auf Einladung ihrer Verlage hin.
Auf der Eröffnungsveranstaltung gab es jemanden, so zumindest Social Media, der diese demonstrativ verließ, als der italienische Kulturminister gesprochen hatte. Meine Frage ist, warum man sich eine solche Veranstaltung antut, auf der man weiß, wer sprechen wird und vor allem, mit welcher Ausrichtung sich der oder diejenigen wahrscheinlich präsentieren werden? Spart man sich das dann nicht lieber?
Wie dem auch sei, das ist eine kleine Randnotiz, trotzdem habe ich mir auch in diesem Jahr natürlich die Halle des Gastlandes angeschaut. Da konnte man jedoch die Klaviatur moderner Propaganda sehen. Ein Saal mit stilisierten römischen Säulen, die Bücher an den Rand gedrängt. Ein höherer Rückgriff als auf die Symboliken des alten Roms und der Bauten römischer Kaiser hätte nicht sein können, während im letzten Jahr das Gastland Slowenien noch die Bücher und ihre Übersetzungen in den Vordergrund gestellt hatte.
Los ging es aber mit einem anderen Italienbezug. Tobias Roth sprach am Stand von DLF Kultur über sein Werk „Florenz in der Welt der Renaissance“, an einem anderen Tag auf der Messe ebenso über „Rom in der Welt der Renaissance“, eines von denen wurde mir später übergeben zum Rezensieren, dem anschließend in einem Pavillon im Hof der Messe ein Gespräch über „Ein Jahr nach dem 7. Oktober“ folgte, als Versuch einer Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklungen in Israel. Auch das nächste Gespräch über Demokratien vs. Autokratien war nicht minder spannend, wie auch der Besuch des Bloggertreffens des Wagenbach-Verlags.
Am Stand hat sich der Verlag allen Anwesenden einmal vorgestellt, bevor dort für uns eine Lesung mit dem italienischen Autoren Mario Desiati startete. Nur leider kann er nicht ganz so gut Deutsch und hatte auch kein Mikrofon, so dass man ihn an den äußeren Ecken, wo wir teilweise auf Schaumstoffwolken saßen, kaum verstanden hat. Wenn ich also einen Wunsch frei hätte: Gebt den Autoren und Autorinnen bitte ein Mikrofon in die Hand und lasst sie entweder Englisch oder in ihrer Sprache sprechen und stellt jemanden daneben, der übersetzt. Ist für alle angenehmer, wäre es auch in diesem Falle sicherlich für den armen Autoren gewesen.
Besser hat dies am nächsten Tag für Martina Berscheid geklappt. Sie hat ihren Roman „Fremder Champagner“ auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage vorstellen und daraus lesen können. Hier gab es Mikrofone. Anschließend habe ich ein paar Worte mit ihr und der Verlegerin des Mirabilis-Verlags (welcher in diesem Jahr mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde) wechseln können.
Es war toll, beide zu treffen, wie auch Dmitry Glukhovsky, der ein wenig später am Stand der RandomHouse-Verlage sein neuestes Werk vorstellen durfte, eine Zusammenstellung vieler Zeitungsartikel und Kolumnen aus seiner Feder, über die Entwicklung Russlands. Gedanklich landete dieses Buch nebst vielen anderen natürlich auf meiner Wunschliste.
Nicht auf der Wunschliste, wie so viele, landete in meinen Koffer, wie ebenso viele, ein wenig später „Mein Freund YBor“, das Kinderbuch von Rüdiger Kinting, welchen ich danach treffen durfte. Diese Gespräche und Treffen sind es, die für mich diese Messen ausmachen. Wenn jemand ganz begeistert über sein Buch spricht, die Findung der Geschichte, der Gestaltung, ist das doch ansteckend. Ich bin in jedem Fall positiv gespannt auf dieses kleine Werk und freue mich schon, es zu lesen.
Ein anderer Aspekt der Messen, eher für den Blog wichtig oder den Schrittzähler, den ich nicht besitze, sind die Rundgänge zu den Verlagen. Das ist in Frankfurt ungleich schwieriger als in Leipzig, da alle ständig Termine haben und ich jetzt niemand bin, der selbige sprengt. Nach und nach hat es dann aber doch geklappt, auch wenn mir wiederholt Verlage begegnet sind, die keine Visitenkarten annehmen dürfen (Warum?) oder andere, die meinen, Bloggende nicht zu brauchen. Finde ich schwierig, in Zeiten, wo gerade kleine Verlage darum kämpfen müssen, sichtbar für das Publikum zu sein und doch jeder Beitrag doch nur helfen kann.
Man muss aber auch dazu sagen, dass das Ausnahmen waren. Viele freuen sich über das Interesse, erinnern sich an die eine oder andere Rezension und geben auch das Feedback, dass sie es tatsächlich an den Verkaufszahlen merken, wenn Beiträge über die Bücher erscheinen, übrigens auch in Literaturforen.
Den Abschluss des Tages bildete ein Umtrunk am Stand des Karl Rauch Verlags, dessen Bücher so unterschiedlich wie schön gestaltet sind und anschließend eine Veranstaltung des Netzwerks schöner Bücher von zehn unabhängigen Verlagen. Gott sei Dank, nachdem meine Kopfschmerzen wohl zu müde waren, um weiterzumachen. Die hatten mich von früh an leider begleitet. Aber zu den Zeitpunkt war alles wieder soweit in Ordnung, weshalb ich den Abend genießen und bei Pizza und Getränken mit Verlagen und Bloggenden ein paar wunderbare Stunden verbringen und wir Gleichgesinnte uns austauschen durften.
Natürlich ging es dabei auch um Bücher, aber schaut bitte selbst beim Netzwerk schöner Bücher vorbei. Einige davon werde ich im Laufe der Zeit vorstellen, aber hinter jedem stecken Verlegerinnen und Verleger, die tolle kreative Ideen umsetzen und sich nebenbei zum Teil gesellschaftlich engagieren, was viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte.
Der Abend endete spät, der nächste Tag startete früh und begann wieder mit Verlagsrundgängen und dem Bloggertreffen von Rowohlt. Dort wurde das kommende Verlagsprogramm vorgestellt und zwei Autorinnen durften zudem ihre Romane vorstellen. Jen Besser mit „Dirty Diana“ und Raphaelle Red mit „Adikou“. Von beiden Büchern lagen zu wenige Exemplare aus, als dass alle eines bekommen hätten, selbst, wenn alle sich nur für einem der beiden Romane entschieden hätten.
Ich habe keines genommen, da für mich die Programmvorstellung im Fokus stand und mich andere Sachen interessieren, aber wenn man sieht, dass so wenige Bücher ausliegen, nimmt man sich doch bitte nur eines, damit mehr Menschen die Chance bekommen, eines zu erhalten. So gehe ich zumindest bei solchen Veranstaltungen vor. Es ist ein Privileg, die Bücher kostenfrei zu erhalten, nur sollte man einschätzen können, was man daraus macht.
Ein Beispiel hierzu, ich hatte es wegen des Bloggertreffens nicht zu einer parallel stattgefundenen Signierstunde von Sasha Filipenko geschafft, der dort seinen neuesten Roman signiert hatte. Deswegen hatte ich vorher dem Verlag geschrieben, ob es vielleicht möglich wäre, für mich, eventuell eines signieren und zurücklegen zu lassen.
Nicht selbstverständlich auf einer Messe, wo alle Termine haben, auch noch solche Anfragen irgendwo zu vermerken und das auch nicht zu vergessen, was ich verstanden hätte. Aber das war ein ganz toller Moment, was mich riesig gefreut hat. Fast schon Tradition hat ein Gespräch mit einer mir bekannten Literaturagentin, bei dem wir uns über unsere Messeeindrücke unterhalten. Auch das ein Bälle einander zuspielen, weswegen ich solche Messen mag und das Bloggen liebe. Es hat schon was, zu sehen, dass auch andere diese Arbeit, die man macht, schätzen.
Danach ging es zum Bloggertreffen von Kiepenheuer & Witsch, wo die Übersetzerin und Autorin Isabel Bogdan ihren neuen Roman „Wohnverwandtschaften“ vorstellte und daraus las. Ich mag ihre Bücher sehr und freue mich darauf, auch dieses zu lesen. Meines hatte ich bereits, so dass ich mich anschließend nur mit meinen Büchern von ihr, die noch nicht signiert waren, in die Schlange einreihen konnte. Die Autorin hat sich jedenfalls sowohl beim Lesen als auch im Gespräch bei der Fragerunde sehr sympathisch gezeigt.
Bei Dorling & Kindersley (DK), Verlag toller Bildbände zu den verschiedensten Themen, wie auch Kochbücher oder Bildenzyklopädien, habe ich anschließend zusammen mit anderen den Tag ausklingen lassen, wieder mit tollen Gesprächen und (hier) mit einem Glas Kaffeecocktail. Am Samstag gab es dann nur noch ein Treffen mit meiner Ansprechpartnerin vom Verlag C. H. Beck, sowie ebenso beim Mitteldeutschen Verlag. Danach jedoch musste ich schon den Zug nach Hause nehmen. Oder wollte es, um den Besuchermassen zu entgehen. Hat geklappt, auch im ausgewählten (da nicht mehr an die Reservierung wegen Zugausfall gebundenen) Zug schnell einen Sitzplatz gefunden.
Im Zug erfuhr ich dann beim Verfolgen der Nachrichten und Social Media von der Debatte um Clemens Meyer, die hier zumindest einmal (und danach nicht wieder) erwähnt werden soll, welcher auf der Preisverleihung des Deutschen Buchpreises das Verhalten eines Kindergartenkindes gezeigt hat, was natürlich die mediale Aufmerksamkeit jetzt von der ausgezeichneten Preisträgerin Martina Hefter für ihren Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es Dir?“ ablenkt. Kurzfristig mag das Clemens Meyer ein paar Bucheinkäufe mehr einbringen, langfristig wahrscheinlich aber jeder Verlagsmarketingkampagne schaden, zudem wird er vielleicht so schnell nicht mehr für einen Preis überhaupt nominiert werden.
Und so endete eine tolle Messezeit für mich, mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen und Ideen, die ich jetzt erst einmal sortieren muss.
Der virtuelle Spendenhut
Dir hat der Beitrag gefallen? Dann freue ich mich über eine virtuelle Spende. Vielen lieben Dank.