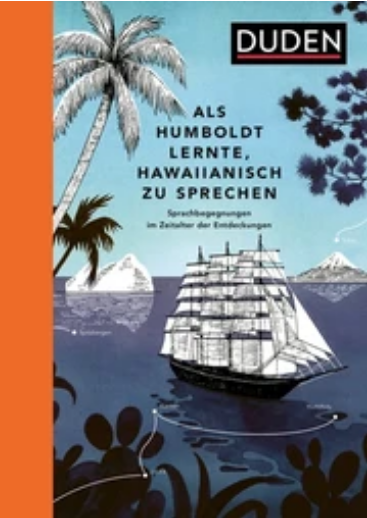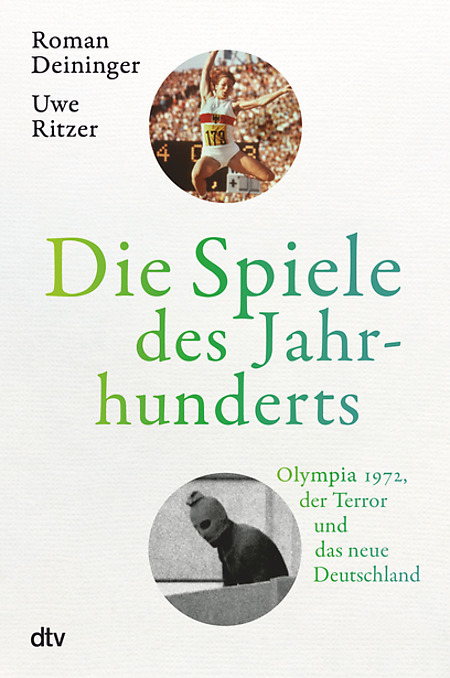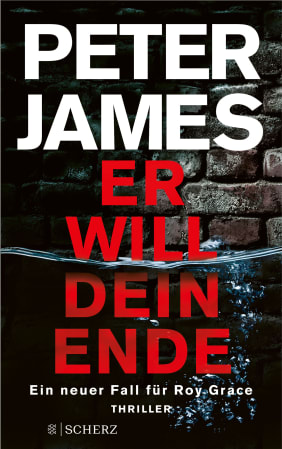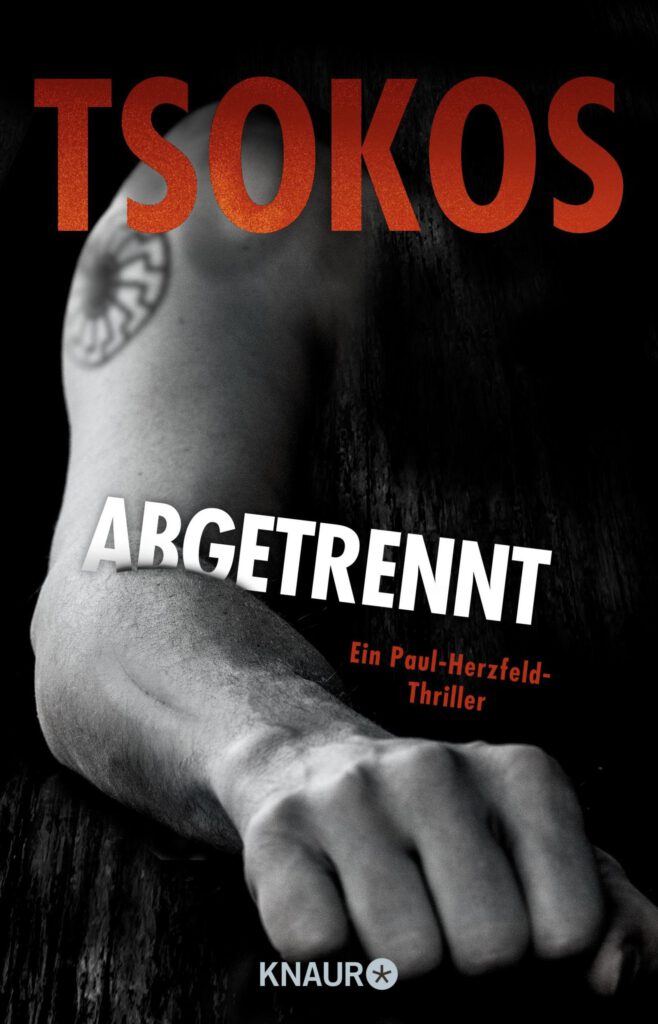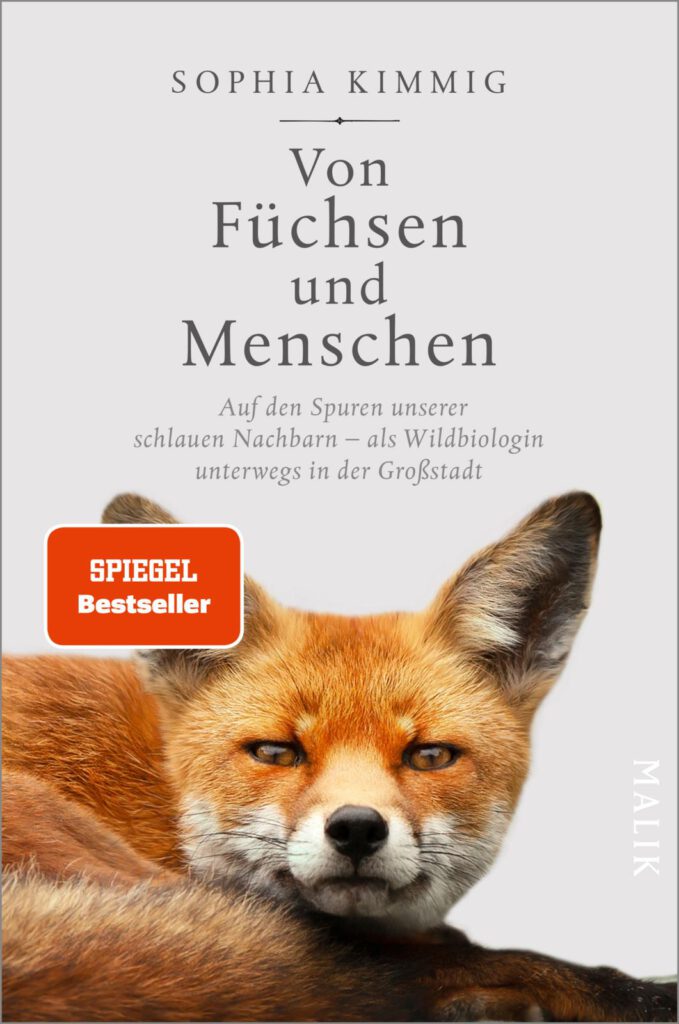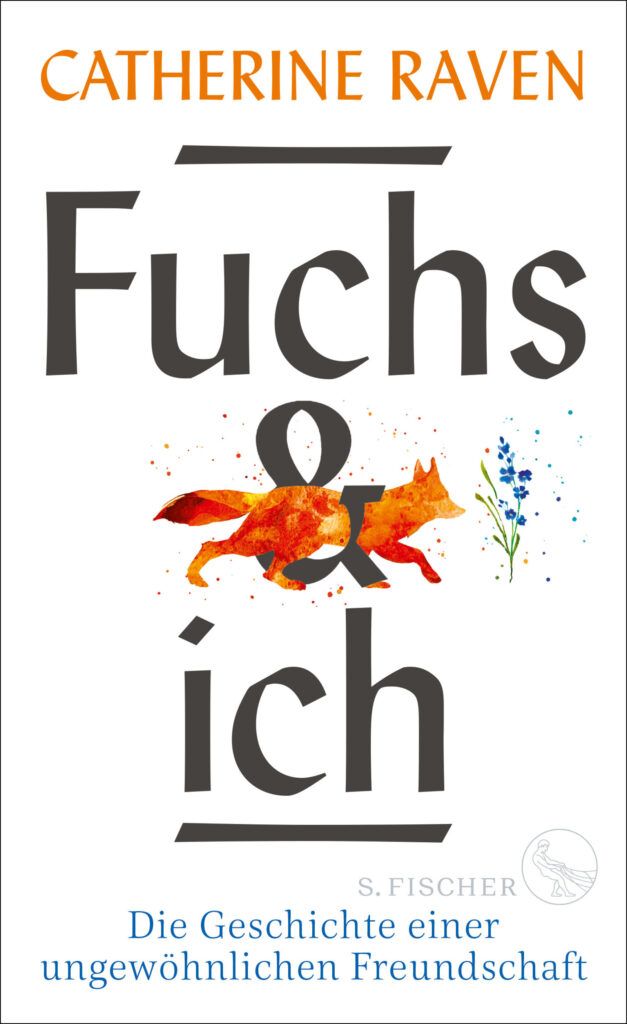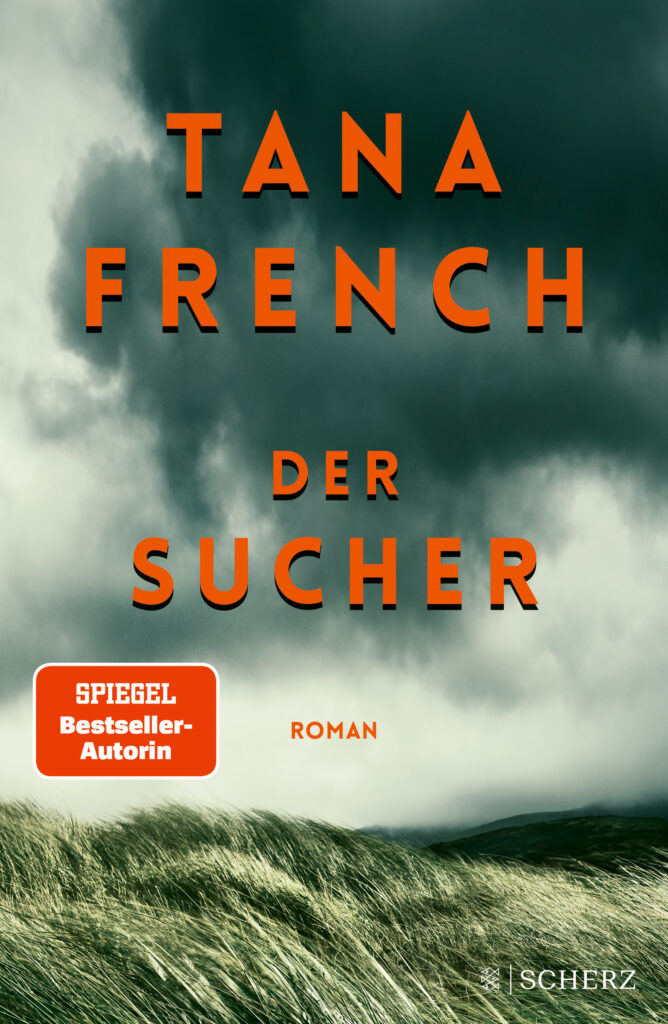Mieko Kawakami: Heaven
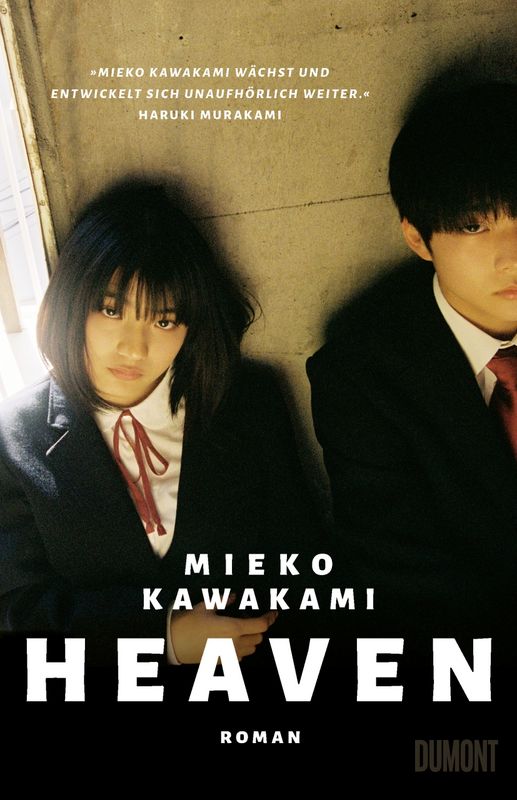
Inhalt:
Sie sind beide Außenseiter und Opfer übler Mobbing-Attacken und haben doch noch kein Wort miteinander gewechselt: der vierzehnjährige namenlose Ich-Erzähler und seine Klassenkameradin Kojima. Als Kojima aber beginnt, Nachrichten zu schreiben, entwickelt sich ein Dialog zwischen den beiden, entsteht etwas Schönes, Zartes. Bald jedoch wird die gerade geschlossene Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.
In ihrem packenden Roman erzählt Mieko Kawakami die Geschichte zweier Jugendlicher, die anders sind, in einer Gesellschaft, die kein Anderssein erträgt, und stellt damit abermals ihr schriftstellerisches Talent unter Beweis.
(Klappentext)
Rezension:
Mobbing wird definiert als fortgesetzte Handlung zumeist psychischer, aber auch körperliche Gewalt und Ausgrenzung gegenüber Schwächeren über einen längeren Zeitraum und das Ausnutzen überlegener Kräfte durch stärkere Personen. In zahlreichen Varianten kommt dies vor, verdeckt oder offen, und erstreckt sich auf Menschen aller Altersgruppen und sozialer Schichten. Wie gibt man einer solchen Thematik, die schon in der Realität kaum flächenwirksam diskutiert wird, fast immer nur dann, wenn sich die Opfer nicht anders zu helfen wissen, als zum Äußersten zu greifen, um sich dem zu entziehen, Raum, zumal in einer von Grund auf eher zurückhaltenden Gesellschaft?
Die japanische Autorin Mieko Kawakami hat dies versucht und erzählt die Geschichte zweier Schüler, wie sie wohl überall auf der Welt vorkommt. Aus der Perspektive eines namenlosen Ich-Erzählers erleben wir von Beginn an die Grausamkeiten, denen er sich ausgesetzt sieht, aufgrund einer Fehlstellung seiner Augen.
Er beschreibt die körperlichen Schmerzen und psychischen Quälereien, die ihm immer mehr verzweifeln und resignieren lassen, bis er eines Tages ein Brief von einer ebenso gequälten Mitschülerin erhält.
Zunächst nur wenige Worte, formen sich schließlich Säütze und ein reger Briefwechsel daraus. Kojima gibt dem Jungen Halt und wird selbst plötzlich gesehen. Zarte Bande, die von den Peinigern Beider nicht unbemerkt bleiben, was Konsequenzen haben wird. Dieses Zusteuern auf die Katastrophe, die Unausweichlichkeit, das Drama, man ahnt das schon zu Beginn, hofft und bangt, gerät gleichfalls der beiden Protagonisten in einem Sog, den man sich nicht entziehen kann.
Aber warum hatte ich Angst? Weil sie mich verletzten? Wenn ich fürchtete, verletzt zu werden, warum tat ich dann nichts? Was hieß das überhaupt: verletzt? Warum wehrte ich mich nicht? Warum ergab ich mich einfach? Was hieß das: sich ergeben? Wovor hatte ich Angst? was ist Angst? Doch so lange ich auch grübelte, zu einem Ergebnis kam ich nicht.
Mieko Kawakami: Heaven
Die Autorin schafft es die Verzweiflung des vierzehnjährigen Ich-Erzählers zwischen den Zeilen mit zunehmenden Seiten immer mehr einzustreuen, eindrucksvoll die inneren Monologe, die Erklärungsversuche des Protagonisten, ebeenso wird das Sinnfreie im Dialog mit einem der Mobber deutlich, dessen Sicht dem Opfer immer mehr die Luft zum Atmen nimmt. Kurze Sätze der Unausweichlichkeit wechseln mit ausufernden, die den Jungen immer mehr in die Tiefe ziehen. Der weg von Kojima nimmt einen anderen Verlauf.
Was bleibt da noch? Das Ende gibt kaum Antworten und bleibt halbwegs offen. So ist das auch im realen Leben. Ein Opfer findet keine einfachen Erklärungen, braucht sie auch nicht, da sie nicht helfen. Nur Hilfe von Außen schafft dies, was schwer genug ist. Wer vertraut sich von selbst schnell genug jemanden an? Das schaffen nur wenige sofort. So bleibt der Leidensweg meist lang. Im Land der Autorin ist die Quote von Fällen von Burnout sehr hoch, ebenso wie die Suizidrate derer, die mit den Konsequenzen einer Gesellschaft, in der jeder für sich bleibt, nicht mehr zurechtkommen. Mieko Kawakami gibt all jenen, nicht nur in Japan, eine Stimme, die so bitter nötig ist.
Autorin:
Mieko Kawakami wurde 1976 in Osaka geboren und ist eine japanische Schriftstellerin und Sängerin. Bekannt wurde sie mit einen Roman, der 2020 in mehreren Sprachen übersetzt wurde, im Deutschen unter den Titel „Brüste und Eier“. Das Buch wurde vom Time Magazine zu den zehn besten Büchern des Jahres gewählt. Doch bereits 2006 debütierte sie als Lyrikerin und veröffentlichte in Japan ihren ersten Roman. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Literaturüpreise, darunter den Akutagawa-Preis und den Murasaki-Shikibu-Preis.
Mieko Kawakami: Heaven Weiterlesen »