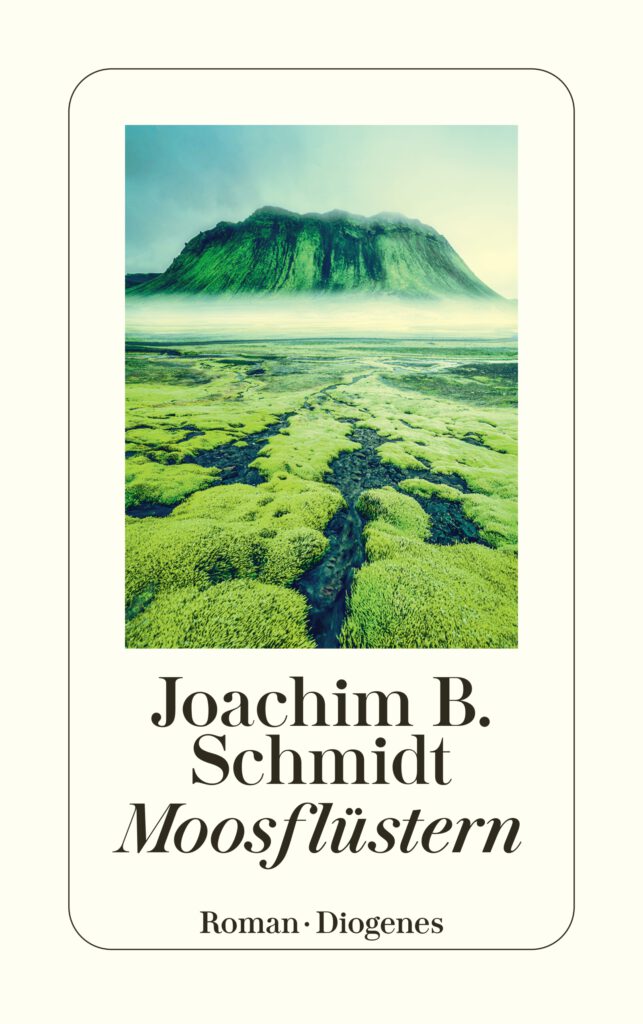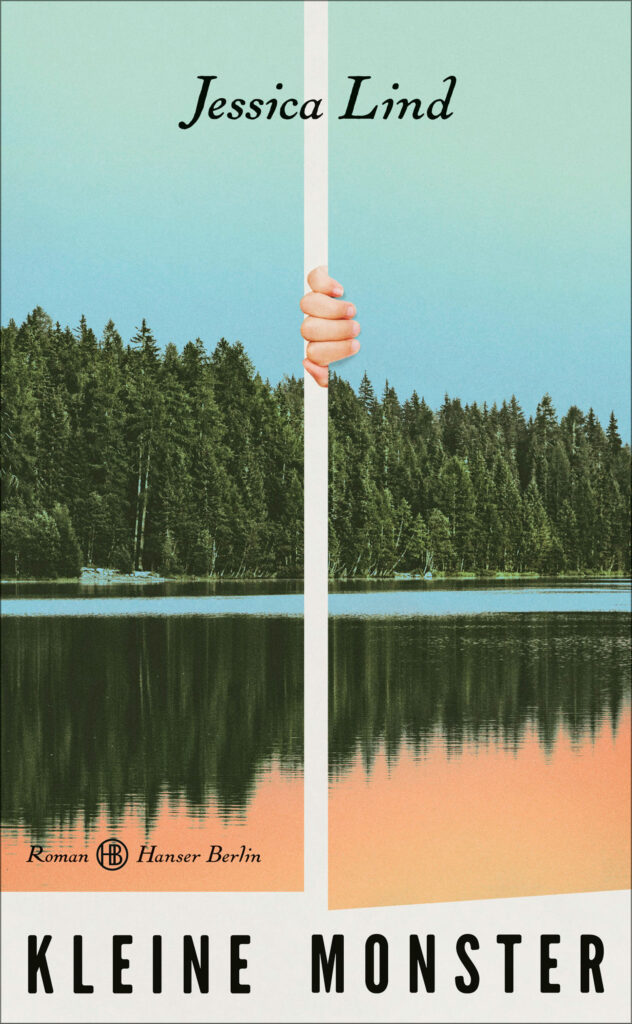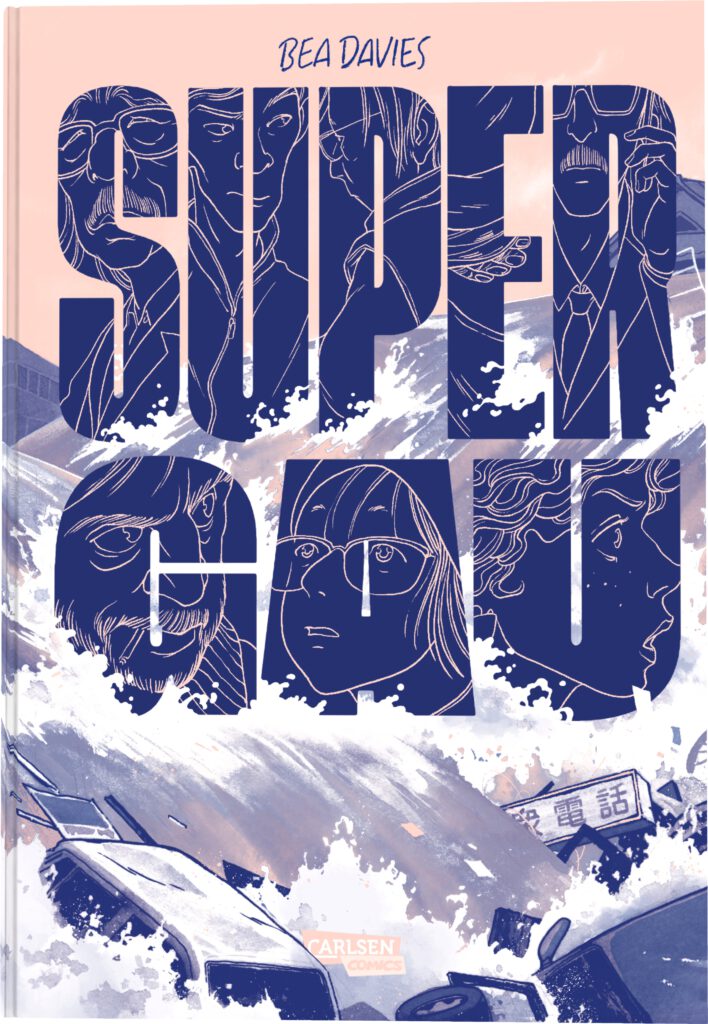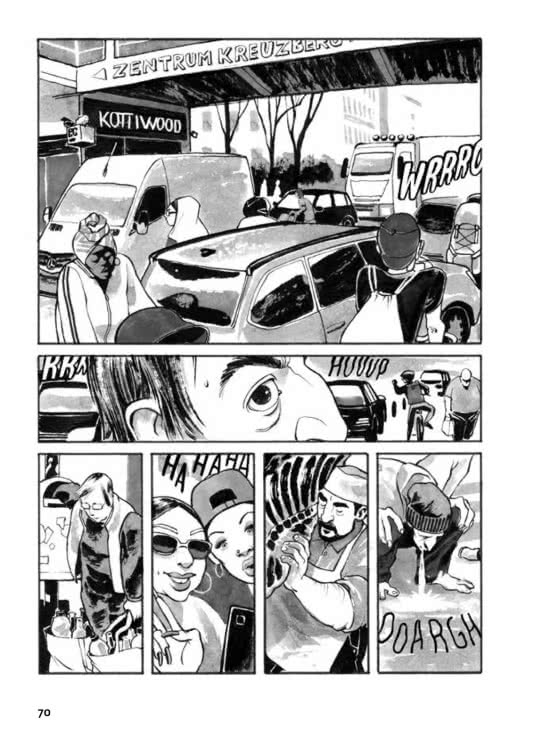Anna Seghers: Das siebte Kreuz
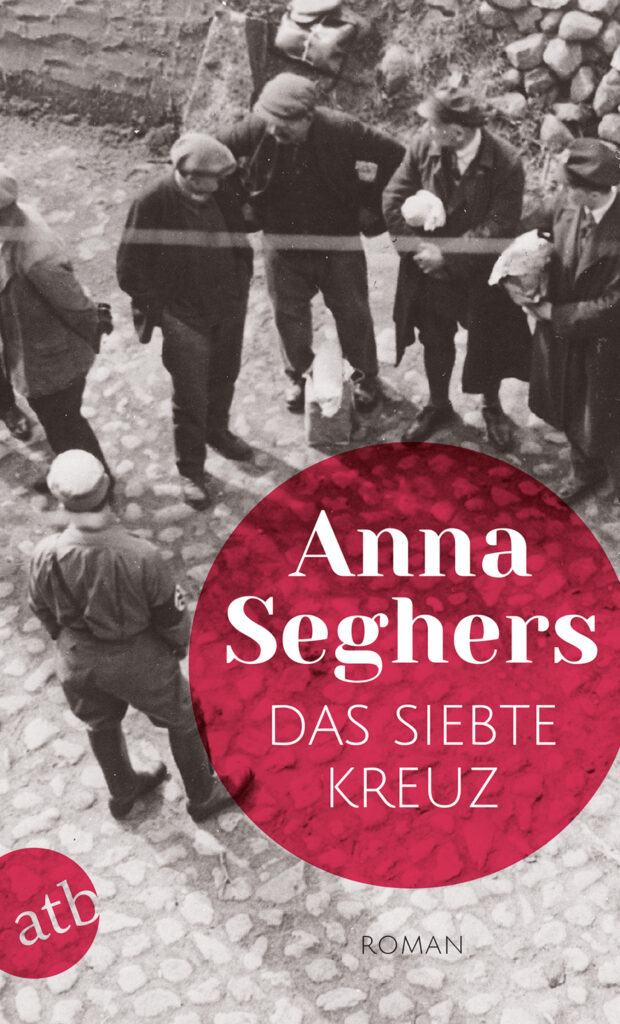
Inhalt:
„Das siebte Kreuz“ machte Anna Seghers mit einem Schlag berühmt und wurde zu einem bis heute anhaltenden Welterfolg. Die dramatische Geschichte einer Flucht vor den Nazis ist durchdrungen von Seghers‘ eigenen Fluchterfahrungen: Aus sieben gekappten Platanen werden im Konzentrationslager Westhofen Folterkreuze für sieben geflohene Häftlinge vorbereitet. Sechs der Männer müssen ihren Ausbruchsversuch mit dem Leben bezahlen. Das siebte Kreuz aber bleibt frei. (Klappentext)
Rezension:
In vielerlei Hinsicht besonders ist der im französischen Exil geschriebene und 1942 erstmals in Mexiko von Anna Seghers veröffentlichte Roman „Das siebte Kreuz“, der die Geschichte nicht nur einer Flucht, eben auch einer Gesellschaft in zahlreichen Facetten erzählt. Die konkrete Einordnung des Romans fällt dabei zunächst nicht leicht.
In einer Art Rückschau beginnt zunächst ein namenloser Erzähler von Ereignissen zu berichten, die einem lesend in den Strang der Haupthandlung einführen. Der Flucht von Georg Heisler aus dem fiktiven Konzentrationslager Westhofen, zusammen mit weiteren sechs, die nach und nach auf ihren Weg umkommen. Nur der Hauptprotagonist entgeht der sich immer enger zuziehender Schlinge, immer wieder. Der Weg ist die Geschichte, und die Menschen, die ihn säumen. Anna Seghers hat sich dafür Zeit genommen, diese zu beschreiben.
Ungewohnt langsam eröffnet sich die Erzählung, die sich nach und nach in mehrere parallel zueinander verlaufende Handlungen auffächert. Jede in ihrer ganz eigenen Tonalität und im dazu passenden Erzähltempo gehalten. Als wäre das nicht genug, kommt ein riesiges Figurentableau zum Tragen, welches nicht nur als Handlungstreiber funguiert, sondern auch all die unterschiedlichsten Schichten und Positionen innerhalb des Dritten Reiches darstellen soll.
Dies gelingt vortrefflich, auch wenn die Art und Weise des Erzählens für heutige Lesende zunächst ungewohnt wirken mag. Erst hineinfinden muss man sich in die Geschichte, die eingebettet im Frankfurter Umland dort geschieht, wo zuvor sich schon so einiges ereignet hat. Schon diese Punkte rechtfertigen mehr Seiten, doch ist der Roman vergleichsweise kompakt gehalten. Man kann darüber froh sein. Es ist nicht immer leicht, den Überblick zu behalten.
Wechselnde Perspektiven schildern das Fluchtgeschehen. Die grausame und bürokratische NS-Diktatur, die den Flüchtlingen unbedingt habhaft werden muss, ansonsten ihrerseits im Inneren Köpfe rollen zu drohen, die Flüchtigen, deren Vergangenheit nur zwischen den Zeilen durchscheint, die auf die Reaktionen ihrer Umgebung angewiesen sind oder durch sie ins entgültige Verderben stürzen werden.
Aus dem Exil heraus hat es Anna Seghers mit „Das siebte Kreuz“ geschafft, ein mögliches Portrait des Dritten Reiches zu schreiben, wie es Erich Kästner, der im Gegensatz zu ihr bleiben konnte, wenn auch mit Einschränkungen, hinterher nicht mehr schreiben konnte. Trotzdem beschränkt sich auch ihre Perspektive oder gerade deswegen auf einen herausstechenden Aspekt, den sie in ein Zeitraum von wenigen Wochen, mehr werden es kaum sein, erzähltet.
Seghers‘ Hauptprotagonist ist durchaus vielschichtig, nicht in allen Regungen seines Handelns sympathisch. Die Hintergründe Georg Heislers entsprechen dabei den ideologischen Idealvorstellungen der Autorin, zumindest zwischen den Zeilen. Trotzdem lässt sich die Erzählung auch heute noch gut lesen. Wenn man gewillt ist, den Roman die Hintergründe seiner Entstehungszeit zu Gute zu halten. Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, das einige Passagen sprachlich angestaubt wirken. Der gesellschaftliche Wandel hat es zudem mit sich gebracht, dass das dargestellte Frauenbild ebenso antiquiert wirkt.
Im Rahmen des ihnen zugestandenen Raumes haben die Nebenfiguren einen durchaus umfangreichen Spielraum zwischen Schwarz und Weiss. Anna Seghers hat ihnen ebenso Ecken und Kanten verpasst, so dass auch die Beweggründe der Antagonisten diese natürlich nicht sympathisch, aber gut nachvollziehbar machen. Die Atmosphäre indes bleibt dagegen die ganze Zeit über aufs Äußerste gespannt. Auch bei denen, die „Das siebte Kreuz“ heute lesen. Die von der Autorin gesetzten Stellschrauben funktionieren heute noch.
An den steten Perspektivwechsel muss man sich, ebenso wie an die verschiedenen Erzähltempo zunächst gewöhnen. Wer einmal da hinein gefunden hat, entdeckt nicht nur eine vielschichtige Fluchtgeschichte, sondern auch einen Roman, der von Symbolik nur so strotzt. Sieben Flüchtige, sieben Kreuze, sieben Kapitel und sicher mehr als genug Anspielungen, die man innerhalb der entfachten Sogwirkung überliest. Passend wirken bewusst gesetzte Leerstellen. Nicht alles offenbart sich sofort. Einiges muss man sich zwischen den Zeilen erzählen. Das Kopfkino spielt mit. Der Detailreichtum ist trotz mancher Auslassung atemraubend.
Ein Roman, der einem so in den Bann zieht, dass es zuweilen wirkt, als würde man praktisch neben den Figuren stehen, ist lesenswert, wenn die Handlung auch zuweilen schwergängig wirkt. Hier merkt man dann doch die Jahrzehnte, die die Erzählung auf den Buckel hat, was jedoch nur Jammern auf höchstem Niveau bedeutet.
Ein Klassiker der Literatur, der auch die Wendezeit überdauern und zuvor bereits in Starbesetzung verfilmt wurde, beiderseits der ideologischen Bruchlinie zweier Systeme so Fuß fassen konnte, ist „Das siebte Kreuz“, den man konzentriert lesen sollte. Schon der Thematik wegen ist dies keine leichte Kost, zudem wenn man die Punkte erkennt, die Anna Seghers aus ihrem eigenen Ereben in ihre Geschichte mit eingebracht hat.
Eine gewisse Trennung von Autorin und Werk ist erforderlich oder zumindest eine entsprechende Einordnung im Zeitgeschehen und in Bezug zur Biografie der Autorin. Wer sich darauf einlässt, bekommt eine vielschichte Lektüre zur Hand, nicht nur literaturgeschichtlicht interessant.
Media: Kein Transit ins gelobte Land – Anna Seghers aus Mainz (SWR 2021)
Autorin:
Anna Seghers wurde 1900 in Mainz gebohren und war eine deutsche Schriftstellerin. Sie studierte zunächst Geschichte, Kunstgeschichte und Sinologie, bevor sie 1924 ihre erste Erzählung veröffentlichte. Verheiratet mit dem ungarischen Soziologen Laszlo Radvanyi wandte sie sich der Kommunistischen Partei zu, der sie 1928 beitrat.
Eine Reise in die Sowjetunion folgte im Jahr 1930, bevor sie über die Schweiz nach Frankreich, zusammen mit ihren Kindern flüchten musste. Im Exil war sie eine der Mitgründerinnen des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller und schaffte es 1942 über Marseille nach Mexiko zu reisen, von wo sie 1947 zurückkehrte. Dort erschien 1942 ihr Roman „Das siebte Kreuz“, mehrere Jahre danach auch in Deutschland. 1947 wurde ihr der Georg-Büchner-Preis verliehen. 1952 wurde sie Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR und blieb es bis 1978. 1981 wurde ihr die Ehrenbürgerwürde der Stadt Mainz verliehen. 1983 starb sie in Berlin.
Ihre Werke wurden mehrfach verfilmt und ausgezeichnet.
Anna Seghers: Das siebte Kreuz Weiterlesen »