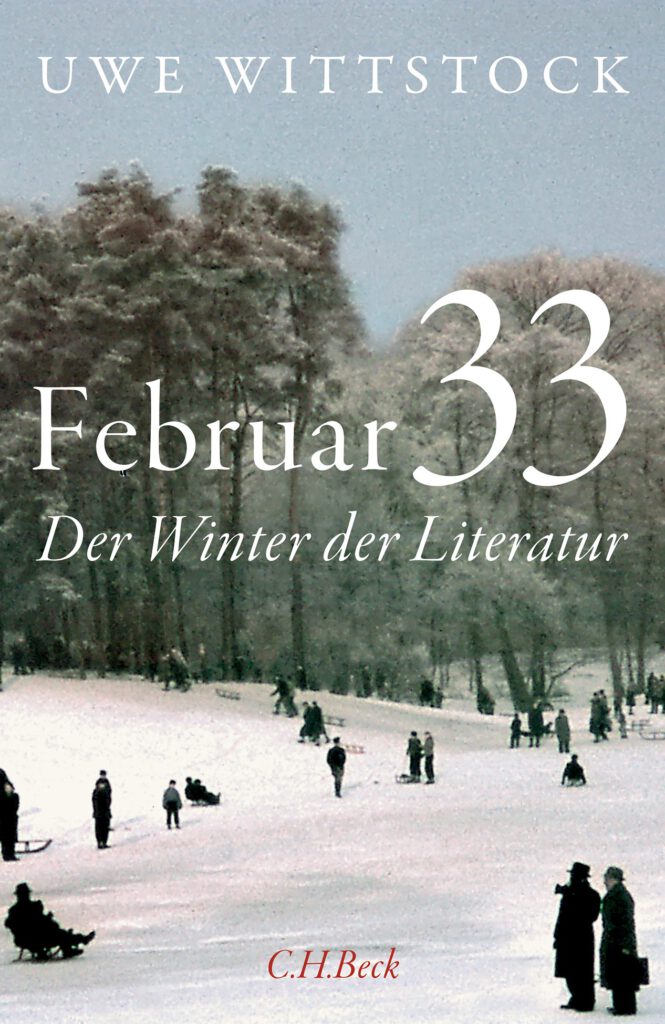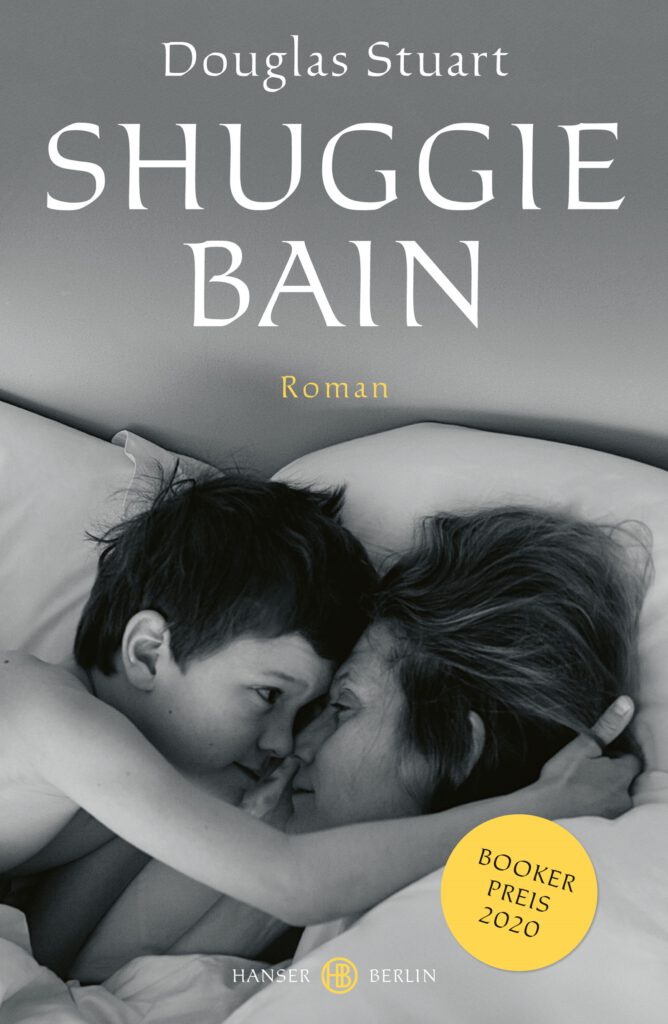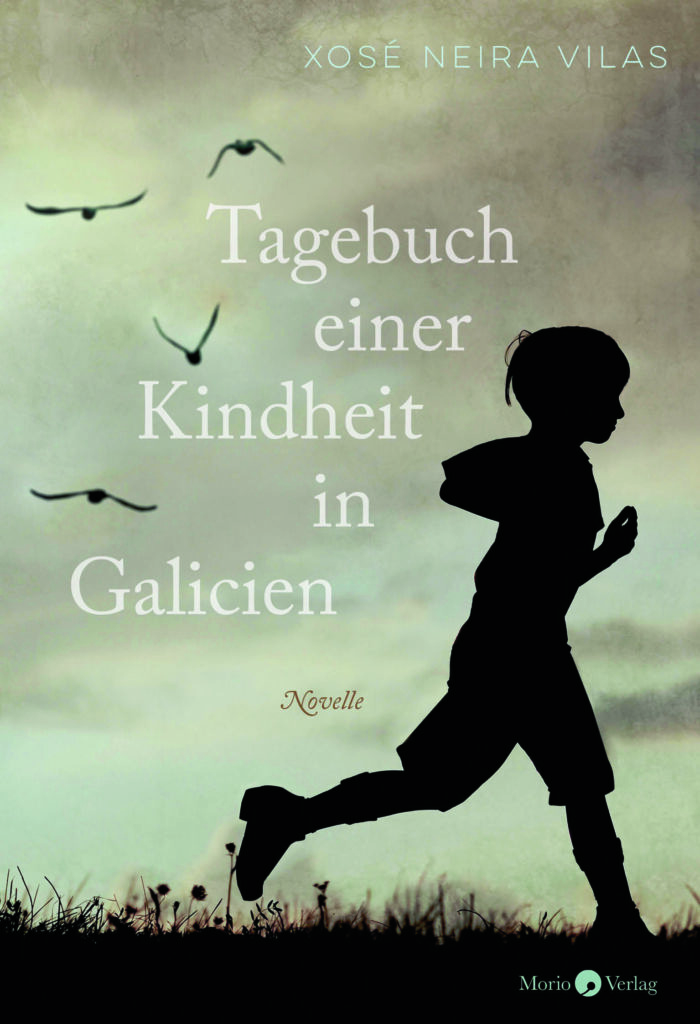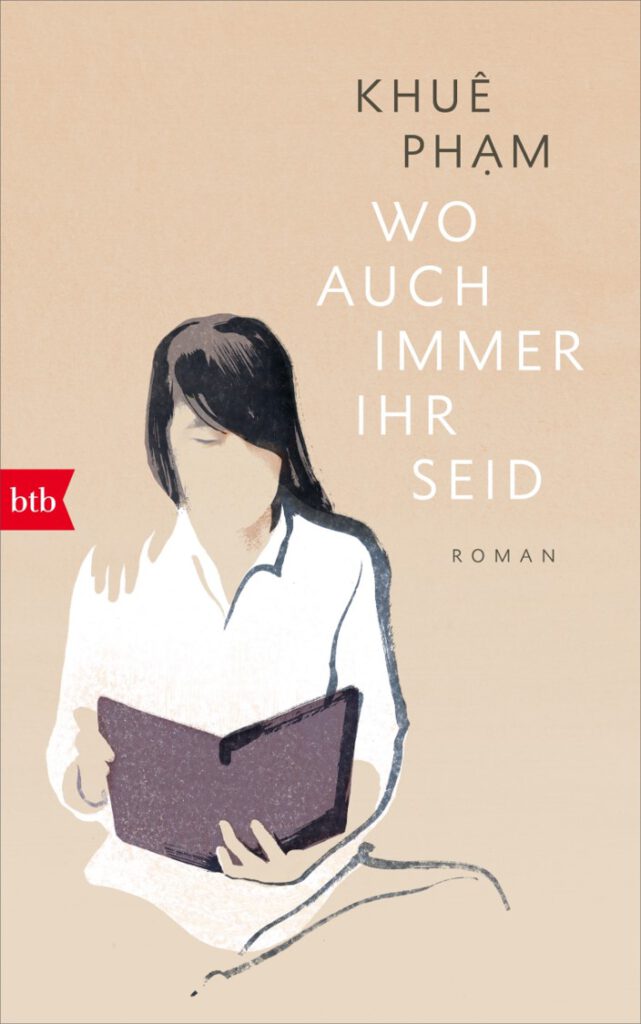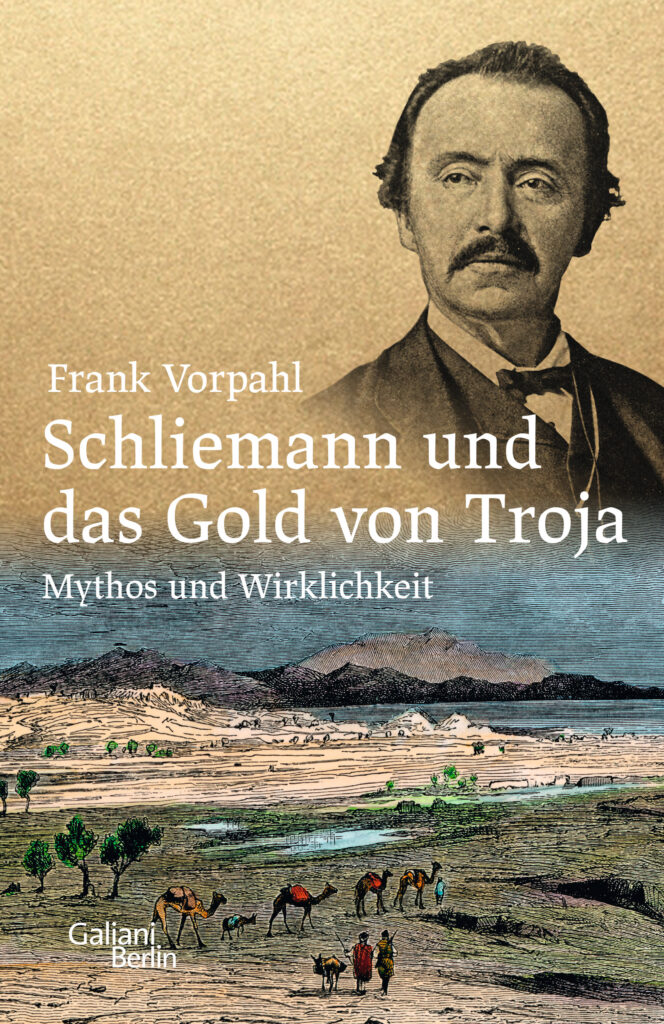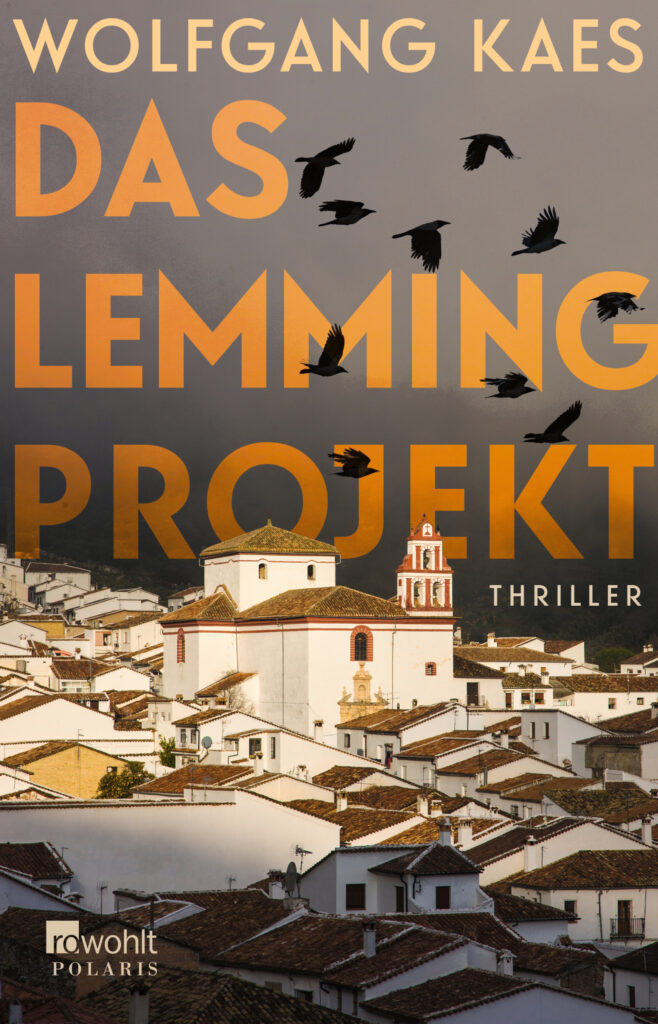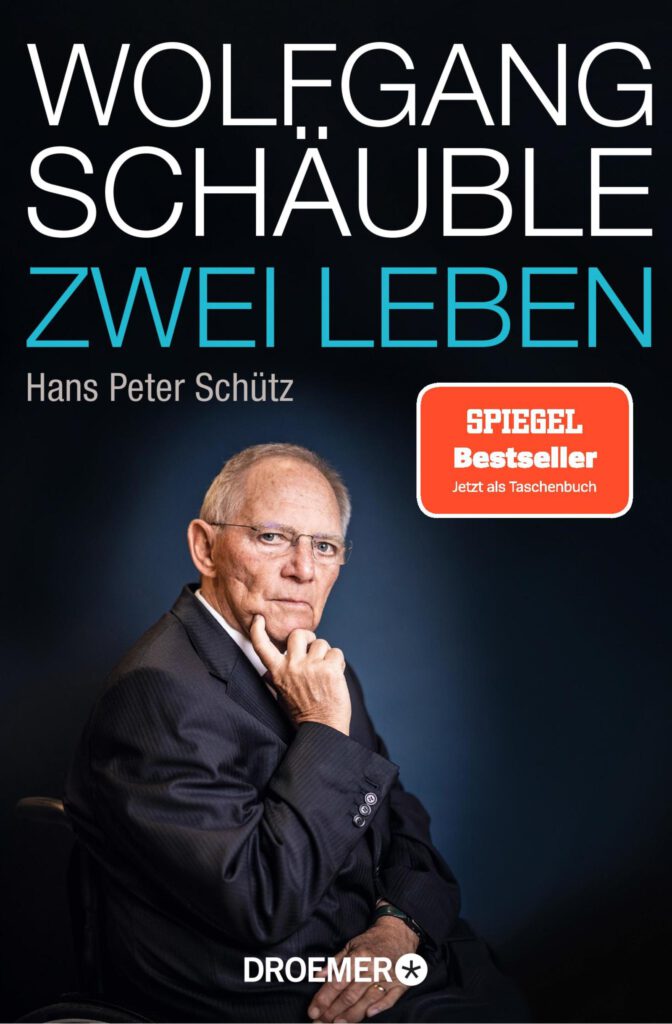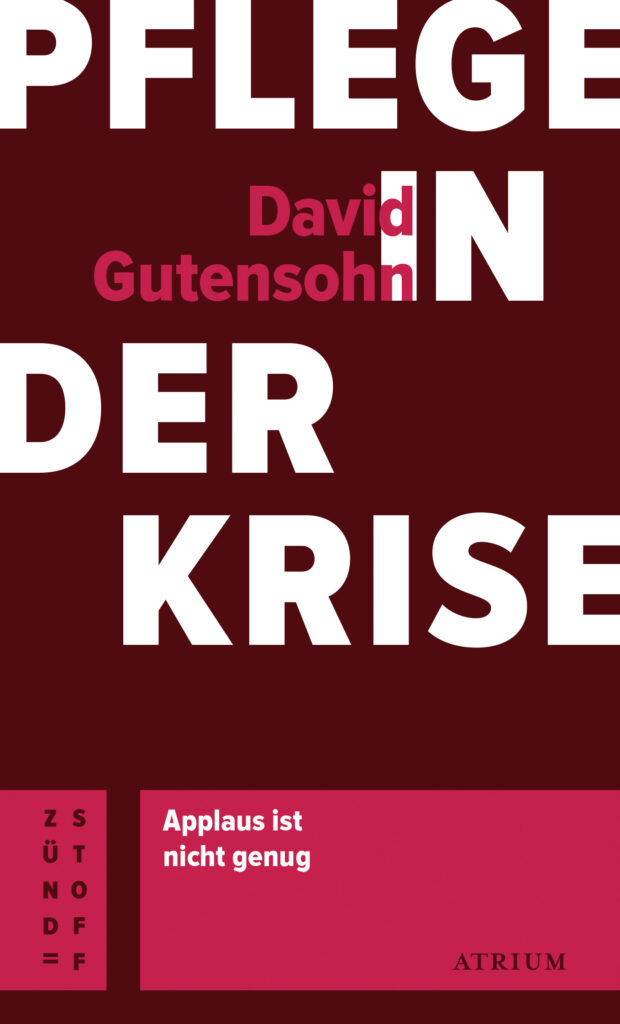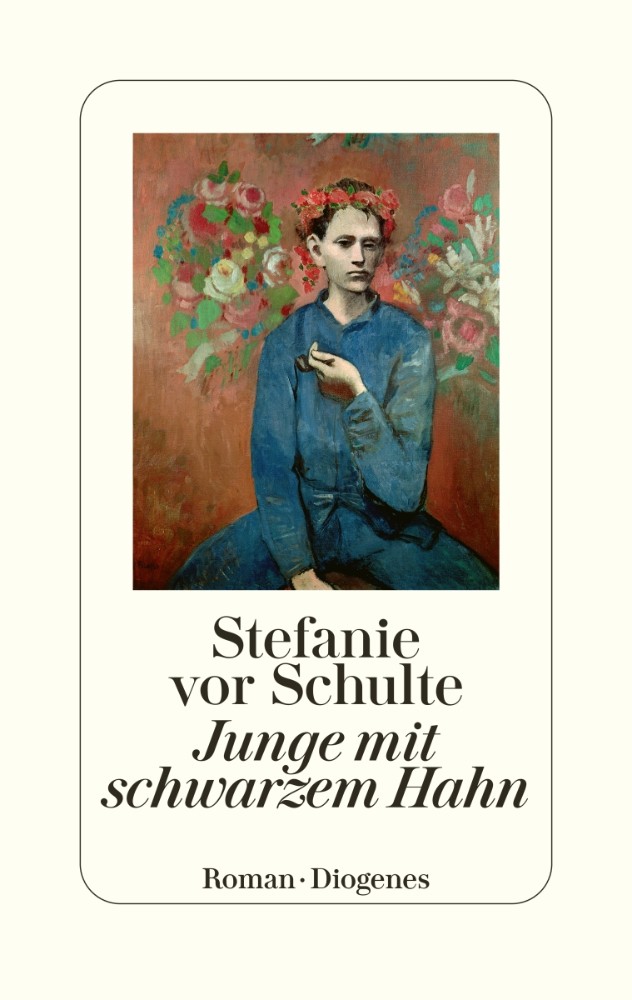Richard Powers: Erstaunen
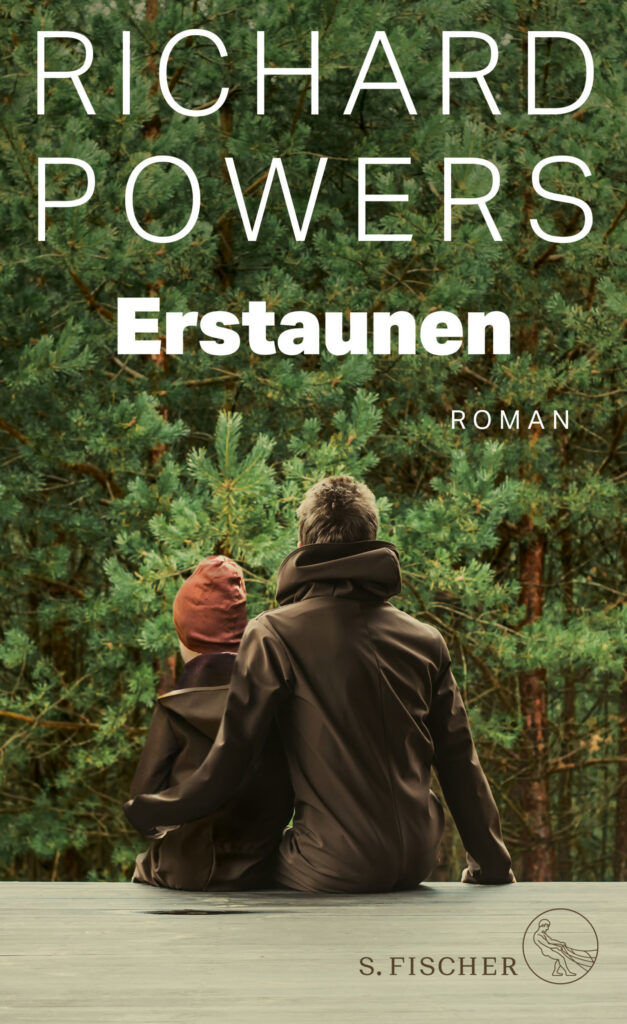
Inhalt:
Wie kann eine Familie in einer unberechenbaren Welt überleben?
Vater und Sohn allein: Der hochbegabte Robbie mit Asperger-Zügen kann den Tod der Mutter nicht verwinden. In der Schule unverstanden, will er die Mission seiner Mutter vollenden: Er malt Plakate und demonstriert auf den Stufen des Kapitols, um die Natur zu retten.
Der verzweifelte junge Vater will ihm mit ungestümer Liebe alles geben. Als Astrobiologe sind ihm die Sterne nah, und auf Wanderungen entdecken sie, dass die Wunder vor ihren Füßen liegen und sie einander brauchen. Doch was geschieht, wenn die Welt schneller endet, als unsere Zukunft beginnt? (Klappentext)
Rezension:
Gleich zu Beginn ist die Verzweiflung zu spüren, die dem Protagonisten zu schaffen macht, beschäftigt sich der Wissenschaftler Theo mit nichts weniger als der Frage nach der Entstehung des Lebens in den unendlichen Weiten des Alls. Mit seinem Team entwickelt er Modelle um sich dem Unbegreiflichen zu nähern und scheitert doch schon im Kleinen, in seinen eigenen vier Wänden.
Dort, zu Hause, bringt ihn sein neunjähriger Sohn an Grenzen. Robbie ist anders als Kinder seines Alters, begreift schneller, hoch intelligent, unverstanden von einem System, in das er sich nicht einordnen lässt, traumatisiert vom frühen Tod seiner Mutter.
Das Leben der beiden nun auf sich Gestellten ist in eine Sackgasse geraten. Nur Wanderungen in der Natur und gedankliche Reisen auf die Planetenmodelle Theos helfen, dem Alltag zu bewältigen, während sie dem Abgrund auf Erden immer näher kommen.
Richard Powers stellt die großen Fragen. Wie auch sein Kollege Jonathan Safran Foer legt er die Finger in die offenen Wunden Amerikas und zeigt die Spaltung Amerikas anhand der Themen auf, denen wir uns alle stellen müssen.
Welche Welt wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen? Gibt es eine Zukunft oder müssen wir uns dem Unvermeidlichen fügen? Sollten wir nicht einmal den vermeintlich Schwächsten unsere Aufmerksamkeit schenken, denen zuhören, die sich nicht in einem System einfügen können oder es wollen?
„Dad. Ich enwickle mich zurück. Das spüre ich.“
Richard Powers: Erstaunen
Verpackt wird dies in einem dicht geschriebenen Roman, der nur oberflächlich eine durch Gedankenspiele aufgelockerte Erzählung ist, eine Coming-of-Age-Geschichte, zugleich eine, in der der Vater bereit ist, alles für seinen unverstandenen Sohn zu geben, ohne ihn selbst wirklich begreifen zu können.
Es ist auch zugleich ein Zustandsbericht Amerikas, dessen Gräben schier unüberwindbar scheinen, zwischen Ideologie und Vernunft, Kurzsichtigkeit und langfristigen Denken.
Der Autor lehnt seine Protagonisten an reale Personen an, ohne sie konkret zu benennen, doch weiß jeder mit dem Lesen der ersten Zeilen, wer wann gemeint ist, wer die Vorbilder für den tönenden Politiker darstellt oder der Jugendlichen, die zum Gesicht des Kampfes um die Zukunft für ihre Generation wird.
Kapitelweise reiht Powers die großen Fragen unserer Zeit aneinander, lässt die klare Sicht des Kindes mit der der Erwachsenen aneinander prallen, bringt jeden Hoffnungsschimmer zum Verglühen, gleichsam den sterbenden Sternen im Weltall.
„Dad, ich vermassle dir dein ganzes Leben.“
Richard Powers: Erstaunen
Kunstvoll verwebt er Gesellschaftskritik mit Darstellungen der Wissenschaft und politischem Zeitgeschehen, positioniert sich dabei so klar, dass sofort ersichtlich ist, wer die Leserschaft in seinem Heimatland sein wird, wen er, wenn überhaupt nur oberflächlich erreichen wird.
Hierzulande ist „Erstaunen“ eine vielschichtige Geschichte voller Hoffnung, viel mehr Verzweiflung, Tragik und der Bitte, wenigstens es zu versuchen, zu verstehen, was schier unbegreiflich scheint.
Glaubwürdig erscheinen dabei die handelnden Protagonisten, der Wissenschaftler, der um den Erhalt seines Projektes kämpfen muss, gleichzeitig den Spagat zwischen beruflichem Erfolg und privaten Leben versucht, der Sohn, der begreift, dass er anders ist als der Schnitt seiner Altersgenossen und zugleich erste vorpubertäre Konflikte austrägt und eine Gesellschaft, die an die Grenzen dessen gerät, was den Kitt zusammenhält, wobei auch der Autor nicht umhin kann, eine zu sehr amerikanische Sichtweise durchscheinen zu lassen.
Sprachlich ist das nicht immer der große Wurf, doch Powers schafft es, seine Leserschaft versinken zu lassen, gleichwohl dazu anzuraten ist, dies sich nicht unbedingt zu Gemüte zu führen, wenn man sich selbst in einem tieferen Loch befindet.
Autor:
Richard Powers wurde 1957 geboren und ist ein US-amerikanischer Schriftsteller. Zunächst studierte er Physik, wechselte dann zu Literaturwissenschaften, um anschließend als Programmierer zu arbeiten. Im Jahr 1985 veröffentlichte er seinen ersten Roman, nahm später eine Lehrtätigkeit an der University of Illinois at Urbana-Champaign an und schrieb an weiteren Werken, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde.
2019 wurde „Die Wurzeln des Lebens“ zum Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet. Zehn Jahre zuvor hatte er eine Gastprofessur an der Freien Universität zu Berlin inne. Kennzeichen seiner Werke sind die Verarbeitung naturwissenschaftlicher und philosophischer Themen. Powers lebt in den USA.
Richard Powers: Erstaunen Weiterlesen »